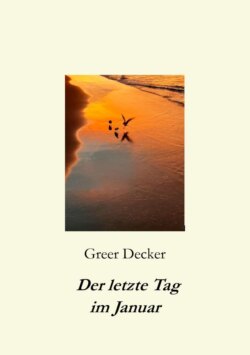Читать книгу Der letzte Tag im Januar - Greer Decker - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеWenn ich mit Freunden und Freundinnen in London über meine Mutter sprach, sagte ich immer, sie hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Queen. Mit ihrer Statur, ihrem Verhalten und auch in ihrer Kleidungsweise, auch wenn ihr Budget vermutlich ein anderes Niveau hatte.
Sie ging nie ohne Hut aus dem Haus und hatte elegante Autofahrerhandschuhe aus feinem Leder, die allerdings fast immer unbenutzt im Handschuhfach lagen. Mutter hatte auch sehr feste Vorstellungen von Rocklängen und eine starke Abneigung gegen lässige Sprache und schlechte Tischmanieren und lehnte das Trinken direkt aus der Flasche kategorisch ab.
Sie war ein Teenager der 1950er Jahre, hatte eine strenge Erziehung über sich ergehen lassen müssen, und war modisch vor allem von ihrer wohlhabenden Tante inspiriert worden. Von ihr hatte sie die lebenslange Liebe zu klassischen Schuhen und Handtaschen, die sie geschickt mit entsprechenden Kleidern und Bleistiftröcken kombinierte. Eine Hose oder ein T-Shirt hatte sie nie besessen. Ihre Kleidung kannte zwei Kategorien – einmal die für die besonderen, die besten Tage und einmal die für den Alltag. Ihre Alltagskleidung trug sie auf dem Weg zur Post oder zum Supermarkt, die besseren Kleider zu Hochzeiten, Tanzbällen und Taufen. Leider gab es seit vielen Jahren immer weniger feierliche Anlässe für sie, abgesehen von Beerdigungen.
Meine Mutter wurde in Blackpool geboren, einer Stadt, der sie stets mit gemischten Gefühlen gegenüberstand. Für sie war die Stadt mittlerweile komplett heruntergekommen – eine verfallende Betonwüste ohne einen einzigen Baum. Aber sie kannte noch die Blütezeit Blackpools in den 1950er Jahren. In ihren eigenen Zwanzigern hatte meine Mutter auf Schwarz-Weiß-Fotos eine auffallende Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Deborah Kerr, die übrigens die letzten Jahre ihres Lebens in einem nahegelegenen Dorf in Suffolk verbrachte. Und Mutter hatte bei einem Liveauftritt 1953 Frank Sinatra im Blackpool Opera House gesehen, ebenso wie Vera Lynn und die Beverley Sisters.
Völlig beiläufig hatte sie kurz nach dem Tod von John Lennon erwähnt, dass sie auch die Beatles in der allerersten Zeit ihrer Karriere dort live gesehen hatte. Und sie war auch bei Freddie Frintons allererstem Dinner for One-Auftritt in Blackpools Winter Gardens im Jahr 1954 dabei gewesen. Rachel erzählte mir, dass Millionen von Deutschen genau diesem Sketch seit 1972 jeden Silvesterabend mit beinahe religiöser Begeisterung folgten, während die allermeisten Briten diesen Sketch überhaupt nicht kannten.
Ich lernte in den langen Gesprächen mit meiner Mutter in dieser letzten Augustwoche 2019 mehr über die Familien meiner Eltern als in den fünfzig Jahren zuvor. Die Heraus-forderung bestand darin, zuzuhören und sich nicht von den Wiederholungen irritieren zu lassen.
Das Zusammenleben mit ihr erwies sich anstrengender, als ich es erwartet hatte. Zwischen den Zeiten, in denen wir entspannt am Esstisch oder auf dem Sofa saßen und über vergangene Zeiten plauderten, merkte ich zunehmend besorgt, wie sehr sie mit den alltäglichen Aktivitäten überfordert war. Es war für sie zu einer sehr großen Aufgabe geworden, den bloßen Überblick über die Zeit und ihre persönlichen Dinge zu behalten. Sie fragte gern, ob wir schon gefrühstückt hätten und ließ dabei jede Tasse Tee kalt werden. Ihr Appetit war ohnehin sehr gering.
Das Langzeitgedächtnis meiner Mutter war noch in Ordnung, aber ihre Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, war nahezu weg. Sie verbrachte die Hälfte des Tages damit, sich zu vergewissern, dass die ihre alltäglichen Gegenstände tatsächlich dort waren, wo sie von ihr vermutet wurden. Wenn wir unsere Tagesplanung abgeschlossen hatten, dann war diese innerhalb von zwei Minuten wieder komplett vergessen. Für Leute mit Erfahrung im Umgang mit Demenzkranken war dies völlig normal - für mich war es schwer zu ertragen.
Ständig fragte mich meine Mutter, ob es denn Rachel gut gehe. Sie hätte seit Monaten nichts mehr von ihr gehört. Und sie fragte, wie lange ich dann blieben wolle und wo ihre Sachen waren. Wo seien denn ihre Hausschuhe, ihr Lieblingsstift und ihre Bücher? Am Tisch sitzend leerte sie mehrmals am Tag ihre Handtasche, nahm ihre drei Brillenetuis heraus, kramte die jeweiligen Brillen heraus und betrachtete das alles mit einem Befremden, als ob sie diese noch nie gesehen hätte. Dann seufzte sie resigniert, packte die Brillen wieder in die Etuis, dann die Etuis in die Handtasche und fing nach wenigen Minuten das ganze wieder von vorne an.
Überall lagen kleine handbeschriftete gelbe Notizzettel - in jeder Schublade, in der Kiste neben dem Telefon, gebündelt mit Gummibändern in verschiedenen Dosen in der Küche und versteckt zwischen den zwei kleinen Vasen auf der Kommode. Am häufigsten fand ich ihre Bank-PIN – die hatte sie vermutlich zwanzigfach an verschiedenen Stellen im Haus schriftlich hinterlegt.
Nachdem sich meine Erschütterung über ihren mentalen Zustand gelegt hatte, konnte ich mit den Verdächtigungen und den neuen Versionen altbekannter Geschichten besser umgehen. Mir wurde nun klar, warum Mutter häufig mir gegenüber vorwurfsvolle Bemerkungen machte. Sie meinte es nicht böse.
Hätte ich das früher begriffen, hätte ich mir einigen Unmut über ihre für mich grundlosen Anschuldigungen ersparen können. Nein, ich hatte nicht die Wände vollgeschrieben, als ich drei war (es war ein einziger Bleistiftstrich). Nein, ich hatte nicht ihre Uhr ausgeliehen und dann verloren. Und nein, ich hatte nicht ihr Adressbuch verlegt und sie somit davon abgehalten, Geburtstagskarte und Weihnachtskarten zu schreiben. Offenbar lösten sich Teile von Mutters Gehirn auf, und es gab nichts, was wir hätten tun können. Oder doch?
Irgendwie fühlte ich mich schuldig. Ich war so selten dort gewesen. Ich hätte sie öfter besuchen sollen, mehr den Dialog mit ihr suchen können, mehr über Demenz herausfinden können, darauf bestehen können, mit den Ärzten zu sprechen. Jetzt war es zu spät.
Immerhin gab es auch ein paar positive Aspekte der Erkrankung. So glaubte meine Mutter, dass sie an viel mehr Orten der Welt gewesen sei, als dies tatsächlich der Fall war und erzählte von einigen wunderbaren Reisen mit meinem Vater und gemeinsamen Urlauben, die niemals stattgefunden haben konnten. So vermittelte sie mir eine große innere Zufriedenheit über ein erfülltes Leben.
Mit ihrem Humor und ihrer fast immer sehr fröhlichen Art hatten wir auch viele schöne gemeinsame Stunden. Auch meine Laune war tagsüber meist optimistisch, vor allem wenn wir im Garten arbeiteten und meine Mutter die Namen aller Pflanzen und Blumen korrekt benennen konnte. Später am Abend wandelte sich die Stimmung aber oft in Momente der Verzweiflung, wenn ich sah, wie verwirrt sie dann wurde.
Meine Gedanken wurden nachts oft noch schwerer, wenn mir Zweifel an meinem Umzug nach Suffolk kamen und ich mich auch dafür noch schuldig fühlte.
Rachel und ich hatten im Sommer vage über die Option eines Umzuges in ein Altenheim für meine Mutter nachgedacht. Da ich jetzt ein besseres Bild über ihren tatsächlichen Gesundheitszustand hatte, mussten wir uns mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen. Mutter hatte ein wunderschönes Haus mit Garten, das für sie immer perfekt schien. In den letzten Monaten hatte sie sich aber am Telefon darüber beklagt, dass ihr der Garten zur Last werde. Aber allein der Gedanke, dass sie in absehbarer Zeit vermutlich ihr Haus verlassen würde, stimmte mich traurig. Ich empfang große Achtung, wie es manche schafften, ihre alten und kranken Angehörigen jahrelang zu Hause zu pflegen.
Ich nahm mir vor, einen sehr schönen Heimplatz für meine Mutter zu suchen, auch wenn das nicht ganz einfach sein würde. Mum hatte sich vor ein paar Jahren selbst einige Seniorenheime angesehen und zeigte uns einige Prospekte. Damals hatten wir sie nicht wirklich ernst genommen. Um ehrlich zu sein, hatten Rachel und ich sie in den letzten Jahren insgesamt zu wenig ernst genommen - was mir jetzt leidtat. Ich hatte mich damals lediglich gewundert, warum sie sich Altenheime ansah, obwohl sie noch so fit war.
Am Donnerstagabend klingelte das Telefon.
»Sarah Wills.«
»Hallo, hier ist Alison, ich wollte fragen, ob es in Ordnung wäre, morgen zu kommen und Joans Haare zu machen?«
»Ja, prima, danke! Um wie viel Uhr kommst du normalerweise?«
»Um zwei. Passt euch das?«
»Ja, perfekt.«
Ich informierte meine Mutter, dass Alison morgen kommen wolle. Mir fiel auf, dass meine Mutter sie stets Alice nannte.
»Sie heißt Alison, oder?«
»Ja, ich glaube schon. Oder Alice. Vielleicht kann sie dir auch mal die Haare machen. Sie sehen richtig schlimm aus.«
In unserer Familie gab es immer nur schwarz und weiß. Da gab es den kleinen, beliebten Labour-Premierminister, der in den Augen meiner Eltern an allem scheiterte, schon weil er aus Yorkshire und nicht aus Lancashire kam, außerdem war er noch in der falschen Partei. Dem folgte ein PM ausgerechnet aus Portsmouth, ebenfalls Labour und schon deshalb ebenso zum Scheitern verurteilt. Als dann schließlich die Eiserne Lady an die Macht kam, war mein Vater zufrieden. Er bewunderte sie und es grämt mich heute noch, dass ich mich für die politische Ansichten meines Vaters schämte, der sonst so ein toller Mensch gewesen war.
Samstagfrüh läutete es an der Tür. Es war die Avon-Vertriebsdame. War das immer noch dieselbe Dame, die bereits in meiner Jugend Kosmetik an der Haustür verkaufte? Es sah so aus – das spräche ja dann tatsächlich für eine hohe Qualität ihrer Pflegeprodukte. Nein, es war eine andere Dame. Mutter sprach sehr lange mit ihr und war davon überzeugt, dass sie noch nicht für Käufe der letzten Male gezahlt hatte. Die Dame versicherte ihr jedoch mehrmals, das Geld bereits bekommen zu haben.
Danach wollten wir zum Supermarkt fahren. Mutter sagte, sie hätte noch Bargeld im Haus. Ich schlug vor, ich könnte die Einkäufe mit meiner Karte zahlen. Trotzdem begann sie hektisch in einem der unteren Schränke in der Küche zu wühlen. Sie wollte mir unbedingt zeigen, wie klug sie ihr Bargeld versteckt hatte – nur war das Geld nicht auffindbar. Daraufhin ärgerte sie sich massiv über all diese Tupperdosen, die im Weg standen, und schleuderte diese sogar genervt an die Rückwand des Schranks. Dann wankte sie in ihrem Zorn rückwärts, um aufzustehen, stürmte anschließend ins Esszimmer und begann nun hektisch in der Anrichte zu wühlen.
»Ich hatte hier tausend Pfund drin.«
Ich schaute sie regungslos an.
»Nur kann ich es jetzt nicht mehr finden. Hast du es genommen?«
»Nein.«
Die Tür des kleinen Schranks zu meiner Rechten flog auf. Zwei Landkarten fielen auf den Boden.
»Hier ist es. In diesem Umschlag, ganz unten. Zähl mal nach.«
Ich nahm die Scheine und zählte sie auf dem Tisch. Zehn Fünfziger.
»Hier sind fünfhundert, Mum.«
»Das kann nicht sein. Es waren tausend Pfund. Jemand muss es genommen haben.«
Ich seufzte.
»Bist du sicher? Vielleicht waren es fünfhundert.«
»Nein. Ich bin mir ganz sicher. Das war mein Notgroschen für die Flucht. Deshalb habe ich es mit den Landkarten aufbewahrt.«
»Okay, dann nehmen wir es erst einmal mit. Mir gefällt es nicht, dass das ganze Bargeld hier herumliegt. Wir werden es auf der Bank einzahlen, sobald wir dazu Gelegenheit haben.«
»Aber ich habe gerne etwas Bargeld zu Hause.«
»Ja, aber fünfhundert sind wirklich zu viel.«
»Es sind tausend Pfund. Zähl nochmal nach.«
Ich zählte noch einmal.
»Nein, es sind definitiv fünfhundert, Mum.«
»Nein, es sind eintausend Pfund.« Meine Mutter runzelte die Stirn.
Ich zwang mich, das Geld zu vergessen. Ich würde später noch einmal in der Anrichte nachsehen.
Das nächste Problem für sie war, was sie anziehen sollte. Mutter wollte ihr bestes Kostüm anziehen, was auch in Ordnung war, obwohl der Rock mir viel zu lang erschien. Hauptsache, sie war glücklich, und wir kamen endlich los. Dann holte sie ihren marineblauen Wollmantel heraus.
»Mum, heute ist es ziemlich warm draußen. Du brauchst keinen Mantel.«
»Okay. Ich lege ihn ins Auto.«
Ich verstand zwar den Sinn dieser Aktion nicht, widersprach ihr aber nicht. Sie machte jetzt schon einen genervten und überforderten Eindruck.
Auch der Supermarkteinkauf erwies sich alles andere als einfach, obwohl die schlechte Laune wieder verflogen war, als wir den Laden betraten. Mutter legte ein paar Artikel in den Einkaufswagen, von denen ich wusste, dass wir sie noch in großen Mengen zu Hause hatten, oder sie diese gar nicht mochte. Sie schien froh zu sein, wenn ich Vorschläge machte und stimmte allem zu, sichtlich erleichtert, dass jemand die Initiative ergriff. Ich legte zwei Artikel diskret ins Regal zurück, als sie nicht hinsah.
Zu Hause aßen wir gleich ein Stück von dem Fruit Cake, der eigentlich für Gäste gedacht war. Meine Mutter erzählte mir noch einmal von damals, als Patsy und Michael sie besucht hatten und drei Stücke von ihrem Fruit Cake gegessen hatten, außerdem hatte Patsy aus Versehen ihr kleines Picknickmesser eingesteckt.
»Dann ist es doch gut, dass wir ihn heute allein essen.«
»Ja. Ich habe jedes Jahr Fruit Cake als Spende für das Dorffest gebacken, aber eine dieser Damen im Komitee hat ihn immer weggeschnappt, bevor das Fest überhaupt richtig los ging!«
»Wirklich? Das war ja dreist!«
»Ja, und ich glaube nicht, dass sie jemals dafür bezahlt hat. Wahrscheinlich sah sie es als ihr Vorrecht an, nach all ihrer harten Arbeit. Sie war ein richtiger Snob, um ehrlich zu sein.«
Abends legte ich einen Film in den DVD-Spieler ein, der nach Mutters Geschmack sein sollte: The Ladies in Black aus dem Jahr 2018. Ich fand den Film großartig. Mutter schien konzentriert dem Film zu folgen.
Am Ende fragte ich, »Hat dir der Film gefallen, Mum?«
»Ja, er hat mir gefallen. Ich habe ihn aber schon öfters gesehen. Du übrigens auch. Es ist ein sehr alter Film.«
Ich hatte angenommen, dass meine Mutter viel fernsehen würde, so wie früher. Allerdings schaltete sie niemals den Fernseher tagsüber ein, denn das war nicht mit ihren Werten vereinbar. Mit Sorge sah ich, dass meine Mutter – wenn sie nicht gerade nach irgendwelchen persönlichen Gegenständen suchte, oder mir etwas aus der Vergangenheit erzählte – einfach oft ins Leere starrte.
Am Nachmittag überredete ich sie zu einem kurzen Spaziergang zum Dorfteich.
»Du bist so unruhig. Ich bin müde und will mich aus-ruhen.«
»Lass uns einfach die Beine vertreten und die Enten füttern.«
Sie seufzte, verließ das Zimmer und kam in ihren Hausschuhen zurück. Ich wagte kaum ihre Sandalen vorzuschlagen, aber es führte kein Weg daran vorbei. Ich holte sie aus dem Schuhschrank und half ihr beim Anziehen. Dann füllte ich eine kleine Papiertüte mit Haferflocken und reichte sie ihr.
Bis Sonntagabend hatte ich ein paar Dinge im Haushalt geändert. Um alle Risiken zu minimieren, zog ich den Stecker des Backofens und versteckte das Bügeleisen. Vor dem Einschlafen begann ich im Internet über die Krankheit nachzulesen. Nach den dortigen Beschreibungen schien meine Mutter gegenwärtig leichte bis mittlere Demenzsymptome zu haben. Sie war oft verwirrt oder desorientiert, aber man konnte sich immer noch gut mit ihr unterhalten und sie war häufig sogar scharfsinnig und sehr wortgewandt.
In einem anderen Artikel las ich, warum viele Menschen mit Demenz nicht mehr gerne fernsehen. Sie können der Handlung nicht mehr folgen und finden die bewegten Bilder irritierend. Meine Mutter behauptete, sie habe sämtliche Filme und Serien bereits gesehen und nutzte dies als Rechtfertigung, warum sie gerade nicht fernsehen wolle. Sie war sehr geschickt in ihrer Argumentation. Dass das Lesen unmöglich für sie geworden war, empfand ich als großen Verlust. Mutter hatte immer gerne gelesen. Um diesen Zustand bestmöglich zu verbergen, sprach sie deshalb nicht selten über Bücher, die sie angeblich gerade las.
Ich hatte das Gefühl, die Krankheit auf einmal zu verstehen, und diese Erkenntnis nahm mir eine große Last von den Schultern. Es war Zeit, meiner Mutter Geduld und Liebe zu schenken.
In meiner ersten Woche hier vermied ich jeden Gedanken an London. Was mir aber sofort hier auffiel, war das hohe Durchschnittsalter der Leute, denen ich begegnete und das zeitlupenhafte Tempo im Alltag. In London hatte ich mich von der Hektik der Großstadt anstecken lassen und war es gewohnt, mit hoher Geschwindigkeit zu agieren. Hier waren alle deutlich langsamer unterwegs, abgesehen von den paar verrückten Jugendlichen, die stets die Kurven der schmalen Landstraßen zu schnell fuhren. Aber mit etwas Glück würde ich die zwei üblen Kurven auf der täglichen Heimfahrt von der Schule auch künftig überleben. Ich mochte die hübschen Dörfer der Grafschaft mit ihren rosa reetgedeckten Häuschen, den Ententeichen, und insbesondere die Ruhe des Landlebens. London war elegant, voller architektonischer Vielfalt und multikulti. Und Suffolk? Suffolk war menschenleer.