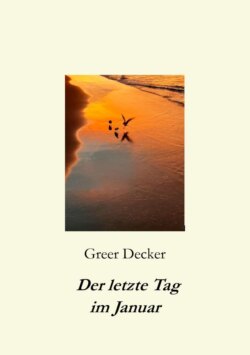Читать книгу Der letzte Tag im Januar - Greer Decker - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеNach der Schule war noch Zeit, das Pflegeheim im Nachbarort anzusehen. Die Bewertungen waren nicht umwerfend, aber ich wollte mir mehrere Heime anschauen, um besser vergleichen zu können.
Das Haus war modern und lag an der Hauptstraße, direkt neben einer riesigen Hühnerfarm.
Ein kleiner glatzköpfiger Mann stand an der Rezeption und fragte mich freundlich, ob er helfen könne.
»Ich suche einen Heimplatz für meine Mutter. Könnte ich einen Besichtigungstermin vereinbaren?«
»Sehr gerne. Lassen Sie mich einen Blick in den Terminkalender werfen.« Er gab mir eine Broschüre des Pflegeheims. »Jessica, unsere Managerin, ist gerade nicht da, aber sie wird Sie morgen anrufen. Ich kann Ihnen aber jetzt gleich einen der Aufenthaltsräume und den Speisesaal zeigen, wenn Sie möchten.«
»Das wäre nett, danke schön.«
Wir gingen durch einen langen Gang zu einem relativ kleinen Essbereich mit ein paar runden Tischen, die mit hellen Tischtüchern eingedeckt waren. Gerade trafen sich mehrere Damen zum Abendessen, sodass etwas Gedränge herrschte. Es kam mir sehr eng vor. Obwohl auf jedem Tisch eine kleine Vase mit Blumen stand, wirkte das gesamte Ambiente trist. In einem weiteren Raum saßen eine ältere Dame und zwei Herren apathisch vor dem Fernseher. Als ein Mitarbeiter ihnen zurief, dass es Zeit für das Abendessen wäre, gab es von dieser Gruppe keine Reaktion.
Ich bedankte mich bei dem Mann an der Rezeption, ging zum Auto und warf die Broschüre auf den Rücksitz. Das war für mich eine ernüchternde Erfahrung gewesen, die meine Stimmung den ganzen Abend drückte.
Später auf dem Sofa sah ich meine Mutter an. Sie schien noch nicht so weit zu sein – sie war nicht ausdruckslos und erschien mir – verglichen mit dem Trio im Pflegeheim - als körperlich und geistig noch ziemlich fit, trotz ihres nachlassenden Kurzzeitgedächtnisses. Vieles von dem, was sie sagte, vermittelte mir immer noch etwas von ihrem wunderbaren Humor. Manchmal überraschte sie mich mit der klaren und scharfen Wahrnehmung ihrer Umgebung. Auf ihren Gedächtnisverlust reagierte sie oft mit einer gewissen Gleichgültigkeit, wobei ich das viel lieber mochte, als wenn sie sich darüber ärgerte. Das war meistens dann der Fall, wenn sie Dinge nicht finden konnte.
Die Menschen, die ich heute im Heim gesehen hatte, schienen einsam zu sein, obwohl sie von zahlreichen anderen Menschen umgeben waren. Unbeteiligt. Das war für mich ein äußerst ernüchternder Einblick in eine Welt, von der ich bisher wenig mitbekommen hatte. Ich fragte mich, ob auch der Besuch des Pflegeheims von James’ Vater bei mir das gleiche Gefühl hervorrufen würde.
Am Samstagmorgen hatte ich Mühe, etwas zum Anziehen zu finden. Ich hätte gestern bügeln sollen; die meisten Sachen lagen noch zerknittert im Korb. Ich überlegte, ob ich meine Mutter mitnehmen sollte. Ich war mir nicht sicher, wie ich es ihr erklären soll, wo ich gerade hinfahre.
James war pünktlich. Ich hatte meiner Mutter gesagt, dass ich mich mit ein paar Kollegen treffen würde. Das Heim war etwa dreißig Minuten mit dem Auto entfernt. Es regnete leicht. Wir unterhielten uns über London, James wollte wissen, in welchem Stadtteil ich gelebt hatte und ob ich oft ins Theater ging – ihm gefiel das Norwich Playhouse gut.
The Grange war ein großes, attraktives Herrenhaus am Rande des Dorfes. Es stand zurückgesetzt von der Straße, das Gelände war von großen und gepflegten Hecken gesäumt. Das Haupthaus hatte Charakter und war frisch gestrichen. Es gab reichlich Parkplätze. Von dort aus konnte ich einen modernen Anbau sehen, einen großen Garten und nach hinten raus Felder.
Wir wurden von Karen in Empfang genommen und trugen unsere Namen in das Gästebuch ein. Karen bot mir an, mir die Aufenthaltsräume und den Speisesaal im Erdgeschoss zu zeigen, während James direkt nach oben zu seinem Vater ging. Sie stellte mich auch drei Mitarbeitern vor, die alle jung waren und dem Aussehen und Akzent nach vermutlich aus Osteuropa stammten. Karen bat Elena, mir den ersten Stock und dabei auch ein leeres Zimmer zu zeigen. Wir betraten den Aufzug, wo der aktuelle Speiseplan und der wöchentliche Aktivitätsplan an der Spiegelwand neben einem verblassten Aufkleber mit Brandschutzhinweisen hingen.
»Wie lange arbeiten Sie schon hier, wenn ich fragen darf?«
»Vier Jahre«, antwortete Elena. Das Namensschild hing etwas schief an ihrem Kittel.
Ich lächelte. »Gefällt es Ihnen hier?«
»Ja, sehr gut, aber ich vermisse meine Familie. Ich bin aus Rumänien. Ich besuche meine Eltern jedes Jahr im Sommer.«
»Wo in Rumänien lebt denn Ihre Familie?«
»In Bukarest. Ich möchte, dass sie zu Besuch kommen, aber mein Vater ist sehr krank, deshalb ist es schwierig. Aber wir skypen viel.«
Sie war mir sympathisch. Sie gestikulierte viel mit ihren Armen während des Sprechens und nahm dabei fast eines der Blumenbilder mit, als wir um die Ecke bogen. Wir blieben kurz an einem kleinen Aufenthaltsraum stehen, wo drei Leute Tee tranken. Das Muster der Tapete war mir etwas zu blumig, aber der wunderschöne Blick aus dem Fenster auf die weiten Felder glich dies aus. Während Elena weiter erzählte, gingen wir in den Fernsehraum, wo fünf Bewohner saßen, von denen vier fest schliefen.
Das Zimmer von James‘ Vater war Nr. 22. Stanley saß aufrecht in seinem Bett und erwartete gespannt den Beginn des Fußballspiels zwischen Norwich City und Manchester City. Ich brauchte nicht zu fragen, für welche Mannschaft Stanley war; es hing ein alter Norwich-City-Schal am Spiegel, und eine Norwich Tasse stand neben seinem Bett. Am Fenster befand sich ein Fotorahmen mit einem Bild von ihm, offenbar seiner Frau und James, der nicht älter als zwanzig aussah.
Er schien sich über den Besuch zu freuen, machte sich dann aber plötzlich große Sorgen, dass er mir nichts anzubieten hatte. Als er mich zum dritten Mal fragte, ob ich eine Tasse Tee möchte und James wiederholt aufforderte, mir einen Tee zu holen, wurde dieser etwas ungehalten und meinte, er solle sich doch entspannen, wir seien schließlich hier, um uns mit ihm zu unterhalten. Ich warf James einen Blick von der Seite zu. Er wirkte mit der Situation etwas überfordert.
»Erzähl doch Sarah von dem Spiel gegen Bayern München, Vater.«
»Oh ja, das war unglaublich. Das war ein Erlebnis, wirklich. Und ich durfte dabei sein. Norwich gewann 2:1 gegen die Bayern, das beste Team Deutschlands. James und ich sind für das Spiel nach München geflogen. Mein erster und letzter Flug, das hat mir aber auch gereicht! Er lachte laut und lächelte dann nachdenklich. »Ich werde das nie vergessen. 1993 war das, am neunzehnten Oktober. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass wir gewinnen! Als erstes englisches Team gegen Bayern München. Biete der Dame doch mindestens ein Toffee an, James.«
Stanley zeigte auf die bunt eingewickelten Quality Street Toffees, die in einer Kristallschale am Tisch standen.
Stanley erinnerte mich auch an meinen Nachbarn in London. Groß, schlank und ein schmaler Kopf mit einer hohen Stirn. Mein Nachbar war auch um die neunzig Jahre alt und lebte allein. Ich sah ihn selten und hätte rückblickend bestimmt öfters nach ihm sehen sollen. Eine Unterhaltung mit ihm blieb mir besonders im Gedächtnis.
»Ich habe nicht gewählt«, hatte er mir am Tag nach dem Brexit-Entscheid gesagt. »Warum sollte ich jetzt mit neunzig über so etwas entscheiden; das ist Sache der Jungen.«
Wir verabschiedeten uns von Stanley, als die zweite Halbzeit begann. Stanley begleitete uns zum Aufzug. Ich bemerkte jetzt erst, wie gebrechlich er war. Er umarmte James. Mir gab er die Hand und bedankte sich für den Besuch.
Auf dem Rückweg gingen wir an zwei weiteren Räumen im Erdgeschoss vorbei. Die meisten Türen standen offen. Eine Dame rief »Hilfe, Hilfe«. Ich blieb stehen und wollte wissen, ob man ihr wirklich helfen konnte. James berührte meinen Arm kurz, und deutete an, dass wir besser gehen sollten. Draußen blieb er stehen und sah mich an.
»Diese Dame ruft fast den ganzen Tag um Hilfe. Die Mitarbeiter machen hier einen ordentlichen Job, aber sie können sich natürlich nicht den ganzen Tag um sie kümmern. Ich weiß, dass es nicht schön ist, und du bist offensichtlich ein fürsorglicher Mensch.«
Es nieselte, als wir ins Auto stiegen. Als wir wieder auf der Straße waren, schaute er kurz wieder in meine Richtung.
»Ich weiß, es ist schwer, mit solchen Dingen umzugehen. Sie ist über neunzig und hat wohl ein gutes Leben gehabt. Es mag uns schrecklich vorkommen, aber sie wird die Tage nicht auf die gleiche Weise erleben wie du und ich. Ich glaube, sie leidet wahrscheinlich nicht so sehr, wie es scheint.«
»Ja«, war alles, was ich sagen konnte.
»Wie findest du das Heim?«
»Gut. Es gefällt mir. Dein Vater scheint sich dort wohlzufühlen. Ich weiß nur nicht, wie meine Mutter reagieren wird, wenn ich vorschlage, dass wir über ein Pflegeheim nachdenken sollten. Ihr das zu eröffnen, bereitet mir große Angst.«
»Versuch dir nicht zu viele Gedanken zu machen. Wir müssen unsere Sorgen filtern.«
»Stanley scheint auf alle Fälle glücklich zu sein.«
»Ja, er ist normalerweise gut gelaunt. Aber manchmal muss ich versuchen, ihn ein bisschen aufzumuntern.«
James und ich fingen an, über das Leben als Lehrer zu sprechen. Wie man sich erst an seine Schüler emotional bindet und dann jedes Jahr ein ständiges Gehen erlebt. James wählte seine Worte mit Bedacht, hatte eine warme Stimme und sprach mit einer sensiblen Mischung aus Selbstvertrauen und Mitgefühl, die ich mochte. Ich war fast versucht, all meine Sorgen um Mutter bei ihm abzuladen, aber damit hätte ich vermutlich unsere neue Freundschaft etwas überfordert. Ich wünschte, wir hätten noch viel länger weiterfahren und reden können. Für mich hatte unser Gespräch schon eine bemerkenswerte Tiefe erreicht – und das innerhalb der kurzen Zeit, die wir uns kannten.
Mutter wollte wissen, wo ich gewesen war. Als ich ihr sagte, wir hätten ein schönes Landhaus besucht, fragte sie mich, warum ich sie nicht mitgenommen hätte. Darauf hatte ich leider so schnell keine Antwort parat und schlug vor, dass wir morgen zusammen einen Ausflug machen könnten.
Beim Abendessen ging es diesmal um eine meiner Tanten, über die meine Mutter sich gerne immer wieder aufregte, obwohl diese schon vor über zehn Jahren verstorben war. Ihre Gründe wechselten häufig, ihre grundsätzliche Verstimmung über diese Tante blieb.
»Sie dachte nur an sich selbst.«
»Stimmte das, Mutter? Ich fand sie immer nett.«
»Nur wenn sie es sein wollte. Sie war auch keine gute Ehefrau oder Mutter.«
»Das ist nicht fair. Ich hatte nicht diesen Eindruck. Ich mochte sie ganz gerne.«
»Du hast keine Ahnung. Du warst noch ein Kind. War sie eine bessere Mutter als ich? Sie gab immer Geld aus und nutzte ihre Mitmenschen aus.«
»Naja, dann habe ich das wohl nicht so richtig mitbekommen.« Ich fühle, es war an der Zeit, besser einen Rückzieher zu machen, um eine Eskalation zu vermeiden.
»Genau. Und ich war diejenige, die sie am allermeisten ertragen musste.«
Wir gingen nach oben. Ich hörte, wie meine Mutter aus dem Bad ins Bett ging. Ich schloss die Augen. Es war anstrengend.
Mitten in der Nacht wachte ich auf, als ich die Toilettenspülung hörte. Ich sah, dass sie vor ihrer Tür stand, wie ein Gespenst in ihrem langen weißen Nachthemd. Ich wartete, um zu sehen, ob sie ins Bett zurückkehrte.
Es war noch zu dunkel, um die Zeiger meiner Nachttischuhr zu erkennen, aber ich ahnte, dass es gegen fünf war. Das war die Zeit, zu der ich oft aufwachte und anfing, über Dinge zu grübeln, ohne jede Ordnung oder Logik. Ich dachte an meinen Ex-Mann, Nick. Und dann an die andere Frau. Dann an die neue Schule. Ich fragte mich, ob der Junge aus der 7c in der großen Pause am Freitag wirklich von sich aus umgefallen war, oder ob ihn jemand geschubst hatte. Ich dachte an James. Ich frage mich, wie James wohl ausgesehen hatte, als er jünger war. Sein Vater war nett. Mist, hatte ich die Mülltonne rausgestellt? Die kamen schon um sechs. Dann fiel es mir ein, dass es Sonntag war, und die Müllabfuhr montags kam.
Ich wachte um kurz nach neun auf, und alle Probleme waren erstmal wieder auf eine überschaubare Größe geschrumpft. Ich dachte immer wieder daran, wie einsam meine Mutter hier gewesen sein musste, monatelang allein, aber sie hatte sich nicht ein einziges Mal beschwert.
Es war ein wunderschöner sonniger Tag, ideal für unseren Ausflug. Meine Mutter entschied sich zum Frühstuck für eine Scheibe Toast und brauchte eine ganze Viertelstunde, um diese zu essen. Um hier zu überleben, musste ich diese Langsamkeit für mich entdecken.
Nachdem wir uns auf ein Ausflugsziel geeinigt hatten, führten wir die übliche obligatorische Diskussion, auf welcher Route wir am besten dort hinkommen. Meine Mutter bestand auf der Strecke, die uns über kleine Straßen durch abgelegene Dörfer führte. Sie konnte sich an die Ortsnamen nicht erinnern. Es gab dort auch nicht so viel Sehenswertes, aber sie freute sich über jedes strohgedeckte Häuschen und noch mehr über jedes Tier, das wir in den Feldern sahen. Wir kamen an mehreren Feldern mit großen Schweineherden vorbei, die im Freien lebten, mit im Feld verstreuten, halbkreisförmigen Blechhütten als Unterstand, wie das in East Anglia weitverbreitet ist.
Es freute mich, meine Mutter so glücklich zu sehen, auch wenn die engen kurvigen Straßen nervenaufreibend zu fahren waren. Diese ständige Kollisionsgefahr ließ meine Mutter völlig unberührt. Sie fand es fast amüsant, dass mich eine Fahrt über das Land so stressen konnte.
Am Dienstagnachmittag hatte meine Mutter eine Routine-Untersuchung beim Arzt. Ich hoffte, bei dieser Gelegenheit mit dem Arzt über ihre offensichtliche Demenz sprechen zu können. Gleichzeitig bereitete es mir Unwohlsein, dieses Thema im Beisein meiner Mutter anzusprechen.
Für meine Mutter erschien dieser seit langem vereinbarte Termin als ein völlig neues, plötzliches und reichlich unwillkommenes Ereignis. Sie argumentierte, es fehle ihr nichts. Wie lästig, sagte sie. Andererseits machte es ihr offensichtlich Spaß, sich zu überlegen, was sie für diesen Arzttermin
anziehen könnte. Dann verschwand sie dreimal innerhalb kürzester Zeit in der Toilette.
»Du warst doch gerade erst, Mutter.«
»Das sind die Nerven«, antwortete sie. »Wohin gehen wir?«
»Zum Arzt. Nur eine Routineuntersuchung. Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Wir werden in einer Stunde schon wieder zurück sein.«
Zehn Minuten später parkten wir schon direkt vor der Praxis. Wir nahmen im Wartebereich Platz, und meine Mutter gefiel sich in ihrer »Feinen Dame«-Rolle. Meine Hoffnung, das Thema Demenz mit dem Arzt besprechen zu können, zerschlug sich, als meine Mutter mir einen strengen Blick zuwarf und murmelte: »Du kannst hier warten. Ich komme allein klar.«
Sie beobachtete die anderen Leute im Wartezimmer mit einem leichten Anflug von Misstrauen. Lediglich die beiden spielenden Kleinkinder fanden sofort ihre Gunst. Wir warteten etwa dreißig Minuten lang, bevor Mutter aufgerufen wurde.
»Wo soll ich hin?«
Ich begleitete sie zu der Schwingtür, die uns von den Behandlungsräumen trennte.
»Raum 1. Es ist die erste Tür geradeaus.«
»Okay. Du gehst nicht mit.«
Wie ein begossener Pudel kehrte ich in den Warteraum zurück. Nach ein paar Minuten beschloss ich, das Mädchen an der Rezeption zu fragen, ob die Praxis bei der Behandlung von Demenz helfen könne. In der Broschüre vom National Health Service, die ich gerade durchgeblättert hatte, klang alles sehr einfach. Als ich ihr sagte, dass ich noch nicht hier registriert war, reichte sie mir ein Formular. Ich könnte gerne bei einem Termin mit dem Arzt über die Demenz meiner Mutter sprechen, aber leider nur in ihrer Begleitung. Und damit war die erste Hürde da. Wie sollte das gehen? Ich müsste erst zu Hause offen mit ihr reden. In diesem Moment kam Mutter durch die Schwingtür und auf mich zu.
»Alles in Ordnung? Worüber hast du mit der Dame gesprochen?« Mum runzelte die Stirn.
»Nichts. Ich vereinbare gerade einen Termin.«
»Was hast du?«
»Nichts Ernstes. Ich erzähle es dir zu Hause. Wie war es bei dir?«
»Alles in Ordnung. Er hat mir nur ein paar Tabletten verschrieben.«
Ich sprach erneut mit dem Mädchen an der Rezeption und es stellte sich heraus, dass Mutter einen Termin für eine Blutuntersuchung brauchte. Wir vereinbarten einen Termin für Mittwochmorgen.
Wir machten uns auf den Weg in das Zentrum der Kleinstadt, die insgesamt nur sechs oder sieben Straßen hatte. Der Ort war menschenleer, und uns standen zahlreiche Parkplätze zur Auswahl. Meine Mutter hatte plötzlich eine Idee.
»Sollen wir zu diesem Kleiderladen gehen? Ich könnte eine neue Strumpfhose gebrauchen. Oder glaubst du, dass heute da zu viel los ist? Normalerweise ist um diese Zeit einiges los, wenn alle von der Arbeit kommen und auf dem Heimweg vorbeischauen.«
»Ja, klar. Gute Idee.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass hier jemals viel los sein könnte. Vielleicht etwas mehr am Freitagmorgen, wenn Markt ist, dann würde der eine oder andere auch in der Marylin Boutique vorbeischauen. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals mehr als zwei Leute zeitgleich in diesem Laden gesehen zu haben und fragte mich, wie er überhaupt überleben konnte. Meine Mutter suchte sich in Windeseile nicht nur ein paar Strumpfhosen, sondern auch noch eine Bluse aus. Diese Anschaffung war sicherlich eine gute Idee, da viele ihrer Blusen mittlerweile deutlich zu groß waren.
»Ich glaube, ich suche noch einmal die Kundentoilette auf.« Schon war sie verschwunden.
Die Apotheke war nur paar Schritte entfernt. Auf dem Weg dorthin setzten wir uns für ein paar Minuten auf eine Bank. Meine Mutter musste erst einmal Luft holen. Ich hatte überlegt, noch in den Buchladen zu gehen, aber der hatte bereits um fünf geschlossen. Die Auswahl der Geschäfte war hier begrenzt, ihre Öffnungszeiten kurz. Auf dem Heimweg tankte ich das Auto und erkannte an der Kasse der Tankstelle einen Mann, den ich am Elternabend gesehen hatte. Er hatte einen breiten Suffolk-Akzent und war gesprächig. Ich war mir nicht sicher, ob er mich wieder erkannt hatte oder einfach nur freundlich war, wie viele Leute hier auf dem Land.