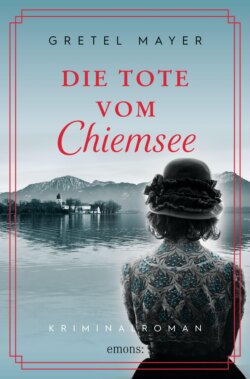Читать книгу Die Tote vom Chiemsee - Gretel Mayer - Страница 12
7
Оглавление»Ihr müsst gleich nach der Andacht naus in den Klostergarten und nachschauen, was des Unwetter alles angrichtet hat. Da gibt’s sicher viel zum tun«, wies Schwester Kreszentia die beiden Novizinnen an.
Der Klostergarten, von vielen Besuchern der Insel bewundert, war neben der Küche Kreszentias Leidenschaft. Jetzt, zu Beginn des Frühherbstes, war der Garten eine Pracht gewesen, bis der Schneefall einsetzte. Gladiolen, bunte Astern und Dahlien, Kirchweihblümerl, Stockrosen, Sonnenblumen und noch so einiges mehr hatten das Auge des Betrachters erfreut. Nach dem Kälteeinbruch sahen viele Pflanzen zerzaust und geknickt aus, doch Kreszentia hoffte, dass sich das meiste wieder erholen würde, genau wie im angrenzenden Gemüsegarten.
Hilda freute sich, Sophie stöhnte auf. Während Hilda sich gleich die Gartenschürze umband und Gartengerät aus dem Schuppen holte, setzte sich Sophie erst mal auf die Gartenbank.
»Ich lese nur noch das Kapitel fertig, dann helfe ich dir«, rief sie der Mitschwester zu.
Hilda verdrehte die Augen.
Sophie versenkte sich wieder in ihr Buch, doch die Buchstaben verschwammen ihr vor den Augen, und ihre Gedanken schweiften zu Flora. Wie oft war sie hier auf der Bank neben Sophie gesessen, hatte nachgefragt, was sie denn gerade lese, hatte manchmal ein wenig über »ihre Heiligen« gespöttelt und dann Geschichten erzählt vom Theater, von den Ballettstunden, die sie genommen hatte, und noch so einiges mehr an Ratsch und Tratsch aus der großen Stadt München, die Sophie noch nie besucht hatte. Manchmal hatte Sophie sich dann vorgestellt, wie sie mit der Flora wie zwei ganz normale junge Mädchen Arm in Arm durch die Stadt bummeln, Kleider anprobieren, Kaffee trinken und dabei eine Menge Spaß haben würde.
Zu Hause in Coburg hatte es Ella gegeben, die, in Sophies Alter, eine Mischung aus Dienstmädchen, Zofe und Vertrauter gewesen war. Sophie erinnerte sich gern daran, wie Ella ihr jeden Morgen das Haar mit hundert Strichen gebürstet, sie bei der Auswahl der Tageskleidung beraten und ihr abends das heiße Bad mit Rosmarinessenz oder Baldrian eingelassen hatte. Manchmal waren sie auch zusammen ins Städtchen zum Hutmacher oder zur Schneiderin gegangen. Ella hatte so einiges über die Einwohnerschaft Coburgs gewusst, was der höheren Tochter Sophie nie zu Ohren gekommen wäre, und vor allem hatten sie viel zusammen gelacht. Nur eines hatte Sophie nicht gemocht: Wenn Ella über männliche Bekanntschaften und den einen oder anderen Verehrer, den sie hatte, plauderte. Ein eigenartiges Gefühl, das sie nie recht deuten konnte, war dann in ihr aufgestiegen.
Natürlich war auch Sophie zu den Winterbällen und den zahlreichen sommerlichen Unternehmungen ihres Städtchens eingeladen gewesen, doch sie hatte sich in dieser Gesellschaft immer ein wenig fremd gefühlt. Wenn wirklich einmal ein Verehrer auftauchte, wusste sie überhaupt nicht damit umzugehen, und spätestens nach ein, zwei Versuchen hatten sich die Herren dann wieder zurückgezogen. Natürlich drängten ihre Mutter und ihre älteren Schwestern sie dazu, sich endlich einmal auf dem Heiratsmarkt zu zeigen, und ließen auch nichts unversucht, um sie zu verkuppeln, doch nichts hatte so richtig gefruchtet.
»Du bist einfach ein kalter Brocken«, hatte ihre älteste Schwester einmal sehr direkt gesagt.
Als dann die von ihrer Familie ziemlich krampfhaft initiierte Verlobung mit Eberhard Baron von Münnerstadt so peinlich fehlgeschlagen war und der große Skandal gerade noch abgewendet werden konnte, hatte sich Sophie zuerst zu ihrer Tante nach Bad Kissingen zurückgezogen und war schließlich bei den Benediktinerinnen auf Frauenchiemsee eingetreten. Doch nie hatte sie das Gefühl gehabt, eine eigene Entscheidung getroffen zu haben, es wurde über sie bestimmt, und sie nickte dazu.
Im Kloster hatte sie sich anfänglich recht wohlgefühlt. Die ganzen gesellschaftlichen Anforderungen fielen weg, sie konnte in ihre Bücher abtauchen und musste sich nicht mehr entscheiden, welches Kleid und welchen Hut sie heute tragen sollte. Doch dann war Flora gekommen und hatte die Welt von draußen in die klösterliche Abgeschiedenheit gebracht. Sophie war von einer seltsamen Unruhe ergriffen worden, die sie sich nicht erklären konnte.
Hilda hatte mittlerweile schon ein ganzes Beet geharkt und hoffte, dass der von der Schneelast platt gedrückte Salat sich irgendwann wieder aufrichtete. Sie hatte gar nicht erwartet, dass sich Sophie zu ihr gesellen würde, und eigentlich war es ihr auch lieber so. Ihre Mitschwester hatte keinerlei Interesse an Pflanzen und konnte ein Unkräutlein nicht von einer Blume unterscheiden. Da sie aber zu stolz war, jedes Mal nachzufragen, harkte sie oft die falschen Gewächse aus dem Beet, und Hilda blutete das Herz.
Wie anders war da Flora gewesen. Sie hatte Interesse gezeigt, nachgefragt und sich schließlich recht geschickt angestellt. Und während Sophie bei der Gartenarbeit immer ächzte und stöhnte und sich den Rücken hielt, hatte Flora geplaudert und vor sich hin gepfiffen.
Hilda hatte ihr vom Bauernhof in Brannenburg, von ihren acht Geschwistern und von der Krankheit der Mutter erzählt. Als die Mutter vor drei Jahren gestorben war, hatte der Vater mit viel Enzian ein halbes Jahr getrauert und nach einem Jahr die Rosa Gfellner aus Bad Aibling geheiratet. Für Hilda hatte dies das Ende bedeutet. Als Älteste war sie wie eine Mutter für die jüngeren Geschwister gewesen und hatte die Stelle der Hausfrau übernommen. Es war viel Arbeit gewesen, doch sie hatte es sehr gern getan und sich oft vorgestellt, selbst einmal mit einem tüchtigen Mann einen Bauernhof zu bewirtschaften und viele Kinder zu haben. Aber Rosa Gfellner hatte alles an sich gerissen, sie war nun die neue Frau im Haus, und der Vater hatte keinerlei Anstalten gemacht, seiner ältesten Tochter beizustehen. Nein, er war froh, als Hilda fort war, da musste er kein schlechtes Gewissen haben und vor allem die Reibereien zwischen den beiden Frauen nicht mehr ertragen.
Hilda hatte noch ein wenig gewartet, ob ihr nicht der Franzl Ottinger vom Nachbarhof, mit dem sie oft bei der Kirchweih getanzt und der sie auch ein paarmal sehr leidenschaftlich geküsst hatte, einen Antrag machte. Aber der Franzl äußerte sich nicht, und nach einigen Nächten voller Schmerz und Tränen entschied sie sich für Frauenchiemsee. Doch Hilda war ehrlich zu sich; sie war eine leidenschaftliche Person und hätte gerne einmal den Körper eines Mannes an ihrem gespürt. Sie wusste, dass die Phantasien, die sie zuweilen hatte, keineswegs klösterlich waren.
An einem schönen Sommerabend – Sophie war schon zu ihren Heiligen gegangen – sprach sie mit Flora darüber. Flora hörte ihr lange zu und meinte dann, dass diese körperlichen Wünsche doch ganz normal seien und es wohl keine Nonne gebe, die nicht immer mal wieder davon heimgesucht werde. Sie, Hilda, sollte doch einmal in sich gehen und sich fragen, was ihr wichtiger wäre: Eine Braut Jesu zu sein oder eine Frau mit einem Mann aus Fleisch und Blut an ihrer Seite, dem sie auch Kinder gebären wollte. Auch von sich erzählte Flora ein wenig; von ein paar ihrer Liebeleien am Theater, die aber mehr ein Spiel gewesen seien, vom promiskuitiven Leben ihrer Eltern, das sie ganz und gar nicht billigte, und von ihrer tiefen Zuneigung zu Theo, dem Sohn des Seewirts.
Hilda richtete sich auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wo war eigentlich Sophie? Vermutlich in der Klosterbibliothek, um ein neues Buch zu holen. Hilda setzte sich noch ein wenig auf die Bank und spürte, wie sich Schweißperlen mit Tränen vermischten und in ihren Augen brannten. Flora war tot, nie mehr würde sie die Beete harken, nie mehr hier neben ihr sitzen, mit ihr lachen oder ihr Zuspruch geben. Was war Schreckliches geschehen mit ihr? Und warum starben denn gerade die Menschen, die sie in ihr Herz geschlossen hatte, wie die Mutter, wie Flora?
»Hilda, auf zum Küchendienst«, rief Schwester Kreszentia aus einem Fenster des Küchentraktes.
Wie lange würde wohl die alte Schwester noch da sein, die ihr so herzlich zugetan war, die sie manchmal drückte und »mei liabs Madl« zu ihr sagte?
»Waren denn nicht gestern schon Floras Eltern da?«, fragte Hilda, als sie in der Küche vor einem Berg zu schälender Kartoffeln saß.
Kreszentia nickte und antwortete nur mit einem kurz angebundenen »Ja«. Sie wollte nicht weiter darüber reden, und Hilda bemerkte das sofort.
Es war eine schreckliche Zusammenkunft zwischen der Äbtissin und Floras Eltern gewesen. Kreszentia hatte Tee serviert und sich dann sofort zurückgezogen. Doch schon in der kurzen Zeit, als sie den Tee in die Tassen goss und die Zuckerdose zurechtrückte, hatte sie eine ungeheure Spannung im Raum gefühlt. Die Äbtissin hatte die Hände ineinander verkrampft, dass die Knöchel weiß hervortraten, kreisrunde rote Flecken brannten auf ihren Wangen in dem ansonsten leichenblassen Gesicht. Vom Gesicht ihrer Schwester sah man nichts, da es vom Schleier verhüllt war, nur hie und da schluchzte sie auf, und Schwester Kreszentia empfand bei diesem Schluchzen das Gleiche wie Fanderl und Benedikt. Es waren Bühnenschluchzer, es fehlte ihnen an Ehrlichkeit. Siegfried von Prielmayer saß leicht gekrümmt auf der Kante seines Stuhles, ein wenig sah er aus wie eine schwarze Krähe, die gleich aufflattern und der Äbtissin die Augen aushacken würde. Als Schwester Kreszentia gerade dabei war, die Türe hinter sich zu schließen, ertönte seine Stimme, und es war deutlich seine Bühnenstimme, die in das eiskalte Schweigen hinein ertönte.
»Du hast uns das Liebste genommen, das wir hatten, Elisabeth.«
Schwester Kreszentia kannte die Geschichte der Äbtissin und ihrer Schwester sehr gut. Als Elisabeth Rottmann, die kurz darauf Schwester Klara wurde, ins Kloster gekommen war, hatte sie zu der mütterlichen Schwester Kreszentia, die damals in ihren mittleren Jahren war, bald Vertrauen gefasst und ihr ihre Geschichte erzählt.
Elisabeth und Henriette Rottmann waren die Töchter des Hofapothekers Rottmann und wuchsen sorglos in gediegener, wohlhabender Umgebung auf. Allerdings waren die Schwestern von klein auf sehr verschieden. Elisabeth, die Ältere, war schon immer die Ernsthaftere, Besonnenere der beiden und eher zurückhaltend im Umgang mit anderen Menschen. Sie blieb gerne für sich, las jedes Buch, das ihr in die Hände fiel, und gab, eher knochig, mit schmalem Gesicht und glattem brünetten Haar, nicht allzu viel auf ihr Aussehen.
Henriette, drei Jahre jünger, war die Extrovertierte, Lustige, die immer eine Schar von Freundinnen um sich hatte, ihr lockiges blondes Haar jeden Tag in einer anderen Frisur präsentierte und schon mit vierzehn verführerische weibliche Kurven entwickelte, was die Blicke der Männer auf sie zog. Den zahllosen Bällen, an denen Henriette ab ihrem sechzehnten Lebensjahr teilnahm, immer mit voller Tanzkarte, blieb Elisabeth lieber fern. Gelegentlich allerdings legte die Mutter Wert auf ihr Erscheinen, kam sie doch langsam ins heiratsfähige Alter.
Auf einem dieser Bälle lernte Elisabeth Erhard Strassner kennen, einen Studienassessor aus gutem Hause. Er hatte beste Manieren, trug eine Nickelbrille und machte Elisabeth unaufdringlich formvollendet den Hof. Seine ruhige, etwas altmodisch seriöse Art gefiel ihr.
So unternahm man einiges zusammen, machte Spaziergänge im Englischen Garten, ging in Museen und las sich gegenseitig Gedichte vor. Zwischendurch griff Erhard nach Elisabeths Hand, und einmal küsste er sie zum Abschied sanft auf die Lippen. Die ganze Familie und auch Elisabeth erwarteten in Bälde seinen Antrag; Elisabeth konnte sich ein ruhiges Leben an Erhards Seite ganz gut vorstellen. Dass natürlich auch geschlechtliche Vereinigung und möglicherweise schmerzhafte Geburten zu einer Ehe gehörten, war ihr klar, doch sie stellte sich diese als kurze Episoden vor, die man eben hinnehmen musste, ehe man wieder am Kamin saß und in Ruhe ein Buch las.
Eines Sommerabends, als es schon dämmerte, kam Elisabeth von einem Besuch bei Ilse, einer ihrer wenigen Freundinnen, nach Hause zurück und hörte im Durchgang zum Dienstboteneingang seltsam seufzende, keuchende Geräusche. Warum sie nachforschte und nicht einfach weiter durch den Garten zur Haustür ging, konnte sie später nie sagen. Es waren Erhard und Henriette, die diese Laute ausstießen, an die Wand gelehnt küssten sie sich mit weit geöffneten Lippen. Erhards Hand bewegte sich unter Henriettes hochgeschobenen Röcken, während diese mit einer heiseren, dunklen Stimme, die Elisabeth nicht an ihr kannte, »Ja, ja, ja« keuchte.
Einige Tage später reiste Elisabeth zu Verwandten der Mutter nach Freising, bevor sie dann nach Frauenchiemsee ging und dort Schwester Klara wurde.
Während des Besuchs der von Prielmayers wirtschaftete Schwester Kreszentia in der Klosterküche, die einige Räume weit von denen der Äbtissin entfernt lag, und obwohl sie sich bemühte, nicht zu lauschen, drangen Fetzen der lautstarken Auseinandersetzung bis zu ihr herüber.
»Du hast nicht auf sie geachtet!« – »Mit diesem Gastwirtssohn … du hättest dem sofort Einhalt gebieten sollen … Wer weiß, ob nicht er dahintersteckt.« – »Sie hätte eine glänzende Karriere vor sich gehabt … das wolltest du unterbinden, weil du das Theater hasst, immer schon gehasst hast … von deinem lächerlichen Äbtissinnenthron hast du auf uns herabgeblickt, als wären wir dreckige Zigeuner!«
»Ja, du hast sie mir genommen … aus Rache für damals, für diese Lächerlichkeit«, schrie Henriette von Prielmayer abschließend mit gellender Stimme.
Als die von Prielmayers gegangen waren und Schwester Kreszentia das Geschirr abräumte, sah sie die Äbtissin in ihrem Schlafzimmer über den Betschemel gebeugt, ihre Schultern zuckten, und ihr Schluchzen ähnelte dem Gewimmer eines verwundeten Tieres. Kreszentia konnte nicht anders, als zu ihr zu treten und ihr tröstend die Hand auf die Schulter zu legen.