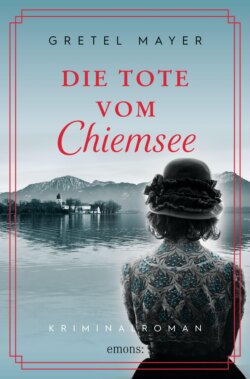Читать книгу Die Tote vom Chiemsee - Gretel Mayer - Страница 9
4
ОглавлениеFanderl und Benedikt hatten sich für den nächsten Morgen beim »Seewirt« verabredet. Dem Hinweis der alten Schwester Kreszentia, dass sich dort eventuell eine kleine Liebschaft Floras angebahnt habe, wollten sie unbedingt nachgehen.
Beide wirkten etwas übermüdet und angeschlagen. Fanderl war immer wieder durch das herzzerreißende Weinen seines Sohnes, der offensichtlich einen großen Backenzahn bekam, geweckt worden, und Benedikt hatte die halbe Nacht versucht, seine Franzi zu beruhigen, was ihm jedoch kaum gelungen war.
Seit fast dreihundert Jahren befand sich der Seewirt nahe der kleinen Dampferanlegestelle, von der aus das Boot hinüber zur Fraueninsel verkehrte. Genauso lang war das Wirtshaus auch im Besitz der Familie Habegger, inzwischen allerdings ausgebaut und erweitert sowie von einem schattigen Biergarten umgeben.
Während die ersten Habeggers nur einen kleinen Ausschank geführt und an vorbeikommende Fuhrleute und die wenigen Leute, die zur Insel hinüberwollten, etwas Proviant und Getränke verkauft hatten, erlebte der Seewirt Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts durch die stark anwachsende Zahl von Ausflüglern und Sommerfrischlern einen enormen Auftrieb. Man erzählte sich, dass Hieronymus Habegger, der Vater des jetzigen Wirts Josef, sogar die königliche Familie bewirtet habe. Hieronymus Habegger war sehr geschäftstüchtig gewesen und seine Frau eine begnadete Köchin, sodass aus dem Seewirt wohl eine Goldgrube hätte werden können, wäre da nicht der verhängnisvolle Hang des Hieronymus zum Glücksspiel gewesen. Aber so stand nach dem Tod des alten Seewirts sein Sohn Josef mit einer nicht unbeträchtlichen Menge Schulden da. Obwohl er schon seit Jahren mit der hübschen Maria aus Stephanskirchen verbandelt war, blieb ihm nichts anderes übrig, als die schwerreiche Bauerntochter Veronika Stammler zu ehelichen. Deren Eltern waren froh, die schmallippige, immer etwas griesgrämige und nicht mehr ganz junge Veronika loszuwerden. Sie kochte nicht schlecht, hielt eisern das Geld beisammen, und sie und der Josef schafften es, trotz der wahrlich nicht häufig stattfindenden Beischlafbesuche drei Kinder zu zeugen.
Allerdings gab der Josef seine Besuche in Stephanskirchen nie ganz auf, und so liefen auch dort zwei Buben mit der typischen Habegger-Visage – etwas feistschädelig und mit wulstigen vollen, fast weibischen Lippen – umher.
Der Älteste aus Josefs Verbindung mit Veronika war Alfred, der vom Aussehen her seinem Vater sehr ähnelte. Äußerst kräftig, schon jung zur Korpulenz neigend, hatte Alfred die dicken Habegger-Lippen und einen breiten roten Schädel, der auf einem viel zu kurz geratenen Hals saß.
Doch vom Wesen her glich Alfred seinem Vater keineswegs. Während dieser von beschaulich behäbiger Gemütlichkeit war und freundlich im Umgang mit den Gästen, wenn auch ein wenig umständlich und schwerfällig, besaß Alfred von klein auf ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Schon in der Schule war er von Anfang an der Anführer, und es gab nicht viele, die es wagten, ihm zu widersprechen. Wie kein anderer verstand er es, mit sprachlicher Gewandtheit und seinem gebieterischen Auftreten seine Geschwister und seine Altersgenossen in eisernem Griff zu halten. Als einer der Ersten trat er der Rosenheimer Hitlerjugend bei, weil es im Dorf so etwas noch nicht gab, und arbeitete sich rasch in der Organisation hoch. Schließlich gelang es ihm, auch in seinem Dorf einen NSDAP-Ortsverein zu gründen, und als am 30. Januar 1933 Hitler an die Macht kam, marschierte Alfred mit seinem inzwischen schon beträchtlich angewachsenen Tross mit Fahnen und Fackeln durch die Dorfstraße.
Die meisten Dörfler blieben in ihren Stuben, doch es gab auch einige, die sich ihnen mit der Hoffnung auf nun anbrechende große neue Zeiten anschlossen. Fritz Bergleitner hisste eine kleine rote Fahne an seiner Dachrinne, aber da sein Haus ziemlich außerhalb lag, fiel das niemandem auf.
Die zweitgeborene Habegger, die Lisi, ähnelte sehr ihrer Mutter und wurde deshalb von den Dorfkindern immer »die dürre Goas« genannt. Seit ihr einmal bei einem Sturz auf dem zugefrorenen See zwischen Dorf und Insel die selige Irmengard mit einer Kerze in der Hand erschienen war und sie gerettet hatte, war sie sonderbar geworden. Alle wussten, dass es sich in Wirklichkeit um die Fischersfrau Gruber mit einer Laterne gehandelt hatte, die ihr aufgeholfen und sie nach Hause gebracht hatte; doch die Lisi war von der Erscheinung fest überzeugt und widmete von da an der Seligen ihr Leben. Mindestens dreimal die Woche und natürlich sonntags ruderte sie hinüber zu ihrer Irmengard, und in der Votivkapelle des Münsters hing gut sichtbar ein Taferl, das die Lisi blutend auf dem Eis zeigte, zusammen mit der seligen Irmengard, die hilfreich über ihr schwebte. Der 16. Juli, der Todestag von Irmengard, der ersten Äbtissin von Frauenchiemsee, die vor nicht allzu langer Zeit vom Papst seliggesprochen worden war, war für viele Gläubige in der Gegend, aber besonders für Lisi Habegger der wichtigste Festtag des Jahres.
Das jüngste Habegger-Kind, der Sohn Theo, war zwei Jahre nach der Lisi am Fronleichnamstag auf die Welt gekommen. Da der Altar für die Prozession unmittelbar vor dem Seewirt aufgebaut war, hatten sich die Gebete der Prozessionsteilnehmer mit dem Wimmern und Schreien der Gebärenden vermischt.
Theo hatte weder den typischen Habegger-Kopf noch wie sein Vater eine Neigung zur Korpulenz oder zur Magerkeit wie seine Mutter. Nein, er war ein äußerst ansehnlicher hübscher Kerl, nur seine Lippen waren etwas voll, was ihm aber gut zu Gesichte stand. Er war ein freundlicher, eher zurückhaltender junger Mann und hatte im Gegensatz zu seinem Bruder mit der Partei, ihren Uniformen und Fahnen gar nichts am Hut. Seit er begonnen hatte, politisch zu denken, schwebte ihm eine friedliche, freie Gesellschaft ohne Standesunterschiede und mit gleichen Rechten und Pflichten für alle vor. Natürlich war er wie seine Geschwister sehr in den Betrieb der Gastwirtschaft eingebunden, doch er war der Schöngeist unter ihnen. Er las gerne und spielte schon, seit er fünfzehn war, die Orgel in der Kirche. Gelegentlich sah man ihn bei Anbruch der Dämmerung auch mal im Häusl des roten Bergleitners verschwinden.
»Mei, die Flora, des arme Madl!«, empfing der Wirt Fanderl und Lindgruber. »Wer macht denn so was? Und Sie sind a wieder mit dabei, Herr von Lindgruber. Des ist ja wunderbar! Was darf ich den Herren anbieten?«
Benedikt und Gustav bestellten Kaffee und setzten sich an einen Tisch, von dem aus man auf den See blicken konnte. Auch heute schien die Sonne immer wieder durch die grauen Wolken und ließ den aufgewühlten See funkeln. Auf dem Weg zum Dampfersteg blitzten noch die letzten Schneereste.
»Haben Sie die Flora besser gekannt, Herr Habegger?«, fragte Benedikt.
»Mei, sie war halt oft herüben zum Einkaufen und hat die Post bracht, immer lustig und freundlich war s’. Mit meinem Jüngsten hat sie sich a bissl angfreundet ghabt. Die haben viel diskutiert, die zwei.«
»Diskutiert?«, fragte Fanderl ein wenig zweifelnd.
»Ja, ja, über Politik, übers Theater und über Bücher, die sie glesen haben. Des mit der Politik hab ich nicht so gernghabt. Und vor allem mein ältester Sohn hat sich immer furchtbar aufgregt. Der is nämlich a ganz a Wichtiger in der Partei, müssen S’ wissen.«
»Und Sie, Herr Habegger?«, unterbrach Benedikt.
»I?«, meinte der Wirt. »I führ hier mei Geschäft, i komm mit alle gut aus. Mit der Politik hab i nichts am Hut. I les mei Gastwirtszeitung und sonst nix.«
»Sind denn Ihre Söhne zu sprechen?«, fragte Fanderl.
»Der Groß ist am Schlachthof, aber der Kloane hilft grad meiner Frau in der Küch. Mir habn heut Abend a Vereinsfeier. Da gibt’s viel vorzubereiten.«
So machten sich Fanderl und Benedikt auf in die Küche. Am großen Herd stand vor einer Menge von Töpfen die Frau des Hauses.
Ohne einen Gruß sagte sie mit äußerst unfreundlicher Stimme: »Mir ham vui Arbeit und gar koa Zeit!«
Neben ihr stand eine jüngere Frau, die genauso dünn war, ebenso mürrisch blickte und ein goldenes Kettchen mit einem Anhänger der seligen Irmengard um den Hals trug. Sie würdigte die beiden Ermittler keines Blickes.
Aus einem Nebenraum trat ein junger Mann mit einem großen Korb Kartoffeln. Das musste Theo, der Jüngste, sein.
»Wir müssten uns mal mit dir unterhalten, Theo«, sagte Fanderl.
»Wegen der Flora?«, erkundigte sich Theo, und Tränen traten ihm in die Augen.
Unter den missbilligenden Blicken der beiden Frauen folgte er den beiden Polizisten zum Tisch in der Wirtsstube. Da die Gaststätte am frühen Vormittag noch leer war und der alte Wirt im Nebenraum herumräumte, konnten sie sich ungestört unterhalten.
»Die Flora war die Liebste, Schönste und Gescheiteste, die ich bisher kennengelernt habe«, sagte Theo, und wieder schwammen seine Augen in Tränen. »Mit ihr konnte ich über alles reden.«
»Hatten Sie denn auch eine Liebesbeziehung?«, erkundigte sich Benedikt.
Theo zögerte. »Ja, schon so a bisserl.«
»Also wie jetzt, des musst uns schon genauer erklären«, bohrte Fanderl nach.
Theo errötete und wand sich ein wenig. »Sie wollte sich niemandem ganz hingeben, sie wollte sie selbst bleiben. Erst wolle sie sich selbst genau kennenlernen, bevor sie sich auf jemanden einlässt, hat sie gemeint. Geküsst haben wir uns schon, und ich hätt schon auch ganz gern mehr wollen, aber da ist sie hart geblieben. Dabei war sie sonst so fortschrittlich, sie war ja schließlich früher beim Theater, und da geht’s bekanntlich locker zu. Aber vielleicht hat sie da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Sie is ja auch wegen ihrem Vater weg vom Theater, weil der unbedingt eine große Schauspielerin aus ihr machen wollt.«
»Wie war sie denn politisch eingestellt, die Flora?«, erkundigte sich Benedikt.
Theo zögerte abermals.
»Wenn Sie sich in allem so gut verstanden haben, haben Sie doch bestimmt auch in dieser Hinsicht Ansichten geteilt?«, bohrte Benedikt noch einmal nach.
Theo straffte sich. »Wenn Sie’s genau wissen wollen, wir haben die Hitlerschen ganz und gar abgelehnt. Ab und zu haben wir uns mitm Bergleitner und mitm Xaver, dem Knecht vom Huberbauern, unterhalten. Das sind ja noch die Einzigen hier im Dorf mit vernünftigen Ansichten.«
»Und deine Eltern und Geschwister? Was haben die dazu gemeint?«, wollte jetzt der Fanderl wissen.
»Ach, meinen Eltern war das eigentlich egal. Mein Vater hat manchmal gmeint, so eine aus der Stadt wär nichts für mich. Meine Mutter hat gar nichts gsagt, nur grantig gschaut wie immer, und die Lisi hat zu ihrer Irmengard gebetet. Bloß mein großer Bruder, der Alfred, der hat furchtbar gschimpft. Der ist ja sehr aktiv in der Partei, für den gilt ja nichts anderes mehr. Der will ja schon seit Jahren, dass ich da mitmach, und mit der Erna, der Tochter von der Vorsitzenden der NS-Kreisbäuerinnen, will er mich auch immer verkuppeln. Der war einfach stocksauer auf die Flora, vor allem, weil sie nie mit ihrer Meinung hinterm Berg ghalten hat.«
Theo schüttelte den Kopf. »Der Alfred hat nur Angst ghabt vor die berühmten Theaterleut in München und vor der Äbtissin, sonst hätt er die Flora womöglich noch anzeigt. Vollkommen ausgerastet ist er, als die Flora dann noch auf die Idee kam, eine Laienschauspieltruppe zu gründen und jeden Monat im Seewirt was aufzuführen. Von wegen ›subversivem Gedankengut‹ hat er rumgeschrien und dass er sie zum Teufel jagen wird!«
Theo liefen nun die Tränen über die Wangen.
»Sie war mein Lebensmensch«, stammelte er schluchzend. »Des muss doch ein Unfall gwesn sein, wer würd denn meine Flora umbringen?«
»Der Form halber müssen wir dich jetzt noch fragen, wo du gestern zwischen acht Uhr abends und zwei Uhr nachts warst, Theo«, sagte Fanderl.
»Hier in der Wirtschaft, im Ausschank, von abends sieben bis nach eins. Und dann hab ich noch aufgräumt«, antwortete Theo. »Meine Eltern und die Lisi können’s bezeugen. Der Alfred hat freighabt.«
In diesem Moment öffnete sich die Küchentür, und die Lisi rief: »Kommst jetzt endlich zum Kartoffelschälen?«
Theo stand auf.
Fanderl und Benedikt tranken ihren Kaffee aus.
»Also der trauert schwer, der Theo, und außerdem hat er ein handfestes Alibi. Aber diesen Alfred müssen wir uns unbedingt schnell vorknöpfen«, meinte Benedikt.
»Dass wir zwei uns immer mit so braunen Gesellen rumschlagen müssen«, sinnierte Fanderl vor sich hin.
»Sei vorsichtig mit dem, was du sagst, du bist Staatsdiener! Haben sie dich eigentlich noch nie gefragt, wann du in die Partei eintrittst?«, fragte Benedikt. »Ich steh da ganz schön unter Druck.«
Fanderl zuckte die Achseln. »Ich hab gesagt, dass ich ja schon Wachtmeister bin und außerdem noch Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr. Das wäre genug! Seitdem hab ich nix mehr ghört.«
»Na, wart’s mal ab«, meinte Benedikt pessimistisch.