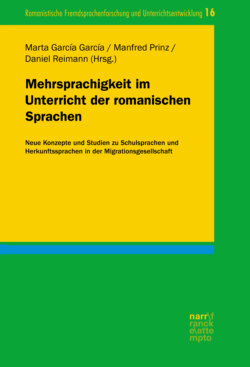Читать книгу Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen - Группа авторов - Страница 10
1.4 Vokale
ОглавлениеVokale sind Laute, bei denen die aus der Lunge ausströmende Luft die Stimmlippen im Kehlkopf in Schwingung versetzt und einen Ton erzeugt. Dieser Ton wird durch Veränderungen der Mundöffnung und der Zungenstellung so modifiziert, dass unterschiedliche Vokale entstehen.
Das Deutsche hat mehr Vokale als die meisten anderen Sprachen auf der Welt, nämlich 15 mit bedeutungsunterscheidender Funktion sowie einen zentralen Vokal /ə/, das Schwa, das nur in unbetonten Silben vorkommt, also insgesamt 16 Vokale. Hinzu kommen neben den drei bekannten Diphthongen /ai/, /au/ und /ɔi/ noch 15 öffnende, zentrierende Diphthonge, die am Silbenende durch die Vokalisierung des /r/ nach einem Vokal entstehen. So in Wörtern wie klar, wir, Ohr, Uhr, Tür, Kur, Stör, Heer oder Tier, die am Ende mit einem Vokal realisiert werden, der zwischen einem offenen [a] und dem Schwa liegt und als /ɐ/ transkribiert wird, dem sogenannten Tiefschwa. Im Standarddeutschen hört und spricht man hier kein /r/, sondern einen Diphthong.
Zu 15 Vokalphonemen kommt man, indem man Minimalpaare bildet:
| /a:/ – /a/ | Schal – Schall |
| /e:/ – /ɛ/ | beten – Betten |
| /e:/ – /ɛ:/ | Ehre – Ähre1 |
| /i:/ – /ɪ/ | Miete – Mitte |
| /o:/ – /ɔ/ | Polen – Pollen |
| /u:/ – /ʊ/ | spuken – spucken |
| /ø:/ – /œ/ | Höhle – Hölle |
| /y:/ – /ʏ/ | Hüte – Hütte |
Hinzu kommt noch das Schwa, das nur in unbetonten Silben zu finden ist.
| /ə/ – /a/ | Tube – Tuba |
Je nachdem, wo die Vokale im Mundraum mit der Zunge gebildet werden, kann man sie in einem Vokalviereck, das den Mundraum schematisch abbildet, verorten.
Abbildung 1.1:
Vokalviereck
Die Punkte markieren den Ort im Mundraum, wo der Zungenrücken die höchste Stelle beim Aussprechen eines Vokals erreicht. Beim /i:/ ist das vorne oben, beim /u:/ hinten oben und beim /a/ wie beim /a:/ unten an der tiefsten Stelle. Deshalb fordert ein Hals-Nasen-Ohrenarzt seine Patienten auch immer auf, ein /a:/ zu sagen, weil dann die Zunge flach unten im Mundraum liegt und er so gut in den Hals schauen kann. Alle übrigen Vokale sind in diesem Viereck an den entsprechenden durch die Zungenstellung markierten Stellen verortet. Das /ə/ befindet sich ziemlich genau in der Mitte des Vierecks.
Neben der Position der Zunge im Mundraum, die sich zwischen vorne und hinten sowie zwischen hoch und tief bewegt, ist auch die Form der Lippen für die Aussprache der Vokale wichtig. Mit gerundeten Lippen werden die Vokale /y:/, /ʏ/, /ø:/, /œ/, /o:/, /ɔ/, /u:/ und /ʊ/ gesprochen, mit ungerundeten Lippen /i:/, /ɪ/, /e:/, /e/, /ɛ:/, /a/, /a:/ und /ə/.
Systematisch ergibt sich folgende Liste:
| ungerundete Vokale | gerundete Vokale | ||||||
| i: | Liege | ɪ | Ritter | ø: | Söhne | œ | Böller |
| e: | lesen | ə | Lage | y: | fühlen | ʏ | füllen |
| ɛ: | Käse | ɛ | retten | u: | Tube | ʊ | Futter |
| a: | Tal | a | Ball | o: | loben | ɔ | Bock |
Tabelle 1.1:
ungerundete und gerundete Vokale
Damit auch Schulkinder diese 16 Vokale gut unterscheiden können, sowohl beim Hören als auch beim Sprechen, sind Ausspracheübungen notwendig, am besten mit Hilfe von Minimalpaaren wie Schal und Schall oder kennen und können. Diese Übungen sind besonders für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte wichtig, da es in nahezu allen Herkunftssprachen deutlich weniger Vokale gibt als im Deutschen und deshalb die feinen, aber für die Bedeutung und die Orthografie so wichtigen Unterschiede zwischen den einzelnen Vokalen nicht oder nicht deutlich genug gehört werden können. Und was man nicht deutlich hören kann, lässt sich auch schlecht schreiben, schon gar nicht mit einer Anlauttabelle.
Bislang haben wir, wie in den meisten Darstellungen üblich, von langen und kurzen Vokalen gesprochen. Langvokale werden aber nicht einfach länger und Kurzvokale kürzer artikuliert. Die Vokale, die wir in Paaren als Lang- und Kurzvokale einander zuordnen, unterscheiden sich – mit Ausnahme von /a:/ und /a/ – vor allem durch ihre Qualität. Sie werden nämlich unterschiedlich artikuliert.
Nehmen wir beispielsweise das <o> in Ofen und in offen. Wenn Sie das ‚lange‘ /o:/ in Ofen und das ‚kurze‘ /ɔ/ in offen hintereinander sprechen, werden Sie feststellen, dass beim /o:/ die Lippen eine kleinere runde Öffnung bilden, die Lippen stärker nach vorne gestülpt werden und dabei unter Spannung stehen. Beim /ɔ/ hingegen ist der Mund weiter geöffnet und die Lippen bleiben ungespannt. Auch wenn Sie das /o:/ in Ofen kurz und das /ɔ/ in offen lang sprechen würden, bliebe der Unterschied zwischen gespannter und ungespannter Artikulation bestehen. Bei den übrigen Vokalpaaren besteht ein analoger Unterschied, nur nicht zwischen /a:/ und /a/. Anstatt von Lang- und Kurzvokalen sollte man daher genauer von gespannten und ungespannten Vokalen sprechen.
Der Bezug der 16 Vokalphoneme zu den fünf Vokalgraphemen, bzw. acht, wenn man die Umlaute <ä>, <ö> und <ü> hinzunimmt, kann also nur durch die nachfolgenden Konsonantengrapheme und den Aufbau von Silben erfolgen, nicht am Vokalgraphem selbst. Diese nachträgliche Markierung ist allerdings bei langen, gespannten Vokalen problematisch, da sie leider keiner festen Regel folgt. Eine sogenannte ‚Dehnung‘ wird öfter durch ein nachfolgendes <h> markiert, dagegen nur selten durch die Verdoppelung des Vokalbuchstabens. Am häufigsten findet jedoch keine Markierung statt. Schreiber müssen sich also merken, in welchen Wörtern die Länge markiert wird und in welchen nicht. Dieses Problem ist aber überschaubar, da man relativ leicht ein Gefühl für die unterschiedlichen prozentualen Verteilungen entwickeln kann und sich die wenigen Wörter mit Vokaldopplung gut einprägen lassen. Die folgende Übersicht zeigt die prozentuale Häufigkeit der Graphem-Korrespondenzen von langen, gespannten Vokalen (folgende Tabellen 1.2, 1.3 und 1.4 nach Thomé 2019):
| Vokalphonem | Grapheme | Beispiele | prozentualer Anteil |
| /a:/ | <a> <ah> <aa> | Schal nah Haar | 90,9 7,6 1,5 |
| /e:/ | <e> <eh> <ee> | Weg Reh See | 85,7 12,7 1,6 |
| /i:/ | <ie> <ih> <i> <ieh> | sieben ihr mir Vieh | 72,4 17,8 8,4 1,4 |
| /o:/ | <o> <oh> <oo> | rot Stroh Zoo | 88,9 10,9 0,2 |
| /u:/ | <u> <uh> | gut Schuh | 96,0 4,0 |
| /ɛ:/ | <ä> <äh> | Bär gähnen | 69,0 31,0 |
| /ø:/ | <ö> <öh> | Öl fröhlich | 86,7 13,3 |
| /y:/ | <ü> <üh> | über fühlen | 78,1 21,9 |
Tabelle 1.2:
Vokalphoneme und -grapheme
In der folgenden Tabelle werden noch die Graphem-Korrespondenzen zu den Diphthongen aufgeführt, bei denen es, wie beim /au/, keine Variantenschreibung gibt, man beim /ai/ extrem seltene Ausnahmen findet und schließlich beim /ɔi/ die Variante <äu> vorkommt, die sich als Umlautschreibung ableiten lässt (Räuber mit <äu>, da Raub).
| /au/ | <au> | Bau | 100 |
| /ai/ | <ei> <eih> <ai> | drei Reihe Mai | 99,5 0,3 0,2 |
| /ɔi/ | <eu> <äu> | Leute Räuber | 81,8 18,2 |
Tabelle 1.3:
Diphthonge
Kurze, ungespannte Vokalphoneme sind gegenüber Langvokalen und Diphthongen regelhaft und nahezu vollkommen systematisch an zwei Merkmalen erkennbar: am Aufbau einer Silbe und an zwei nachfolgenden Konsonantengraphemen. Dazu später mehr.