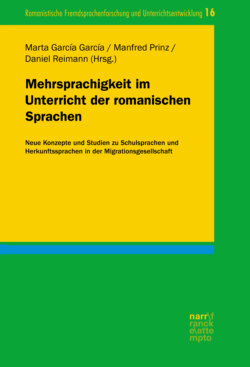Читать книгу Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen - Группа авторов - Страница 9
1.3 Die deutsche Schrift – eine Alphabetschrift
ОглавлениеDie Alphabetschrift, die erstmals von den Phöniziern zwischen dem 11. und 5. Jahrhundert v.Chr. entwickelt wurde, ist eine geniale Erfindung: Eigentlich muss ein Kind nur 26 Zeichen erlernen, um jedes erdenkliche Wort im Deutschen schreiben zu können; für die Großschreibung kommen, als Allographen der Kleinbuchstaben, noch 26 Buchstaben hinzu. Im Chinesischen benötigt man dagegen 3000-5000 Zeichen, nur um im schriftlichen Alltag bestehen zu können. Alphabetschriften sind phonographische Schriften, da ihre Buchstaben die Phoneme einer Sprache visuell repräsentieren. Wohlgemerkt: die Phoneme, nicht die Laute! Denn die Laute einer Sprache existieren in unterschiedlichen Varianten, den sogenannten Allophonen, die aber nicht bedeutungsunterscheidend sind.
Dazu ein Beispiel: Wenn Sie einmal die Wörter Kinn und Kuh nacheinander sprechen und anschließend nur den jeweils ersten Laut artikulieren, werden Sie feststellen, dass die beiden k-Laute unterschiedlich klingen: Der k-Laut in Kinn ist deutlich heller als der in Kuh, die Zunge liegt anders im Mund und die Lippen sind anders geformt. Es handelt sich also um zwei unterschiedliche Laute, die man als Phone bezeichnet. Dieser Unterschied hängt mit den nachfolgenden Vokalen zusammen, die die Aussprache beeinflussen.1 In der Schrift müssen diese phonetischen Varianten aber nicht unterschieden werden, da sie keine bedeutungsunterscheidende Funktion haben. Das /k/, das zwischen zwei Schrägstrichen notiert wird, ist ein Phonem, in welcher lautlichen Variante auch immer. Denn wenn man es mit anderen Phonemen wie /f/, /h/, /m/, /l/, /r/ oder /t/ in der gleichen lautlichen Umgebung kontrastiert, erhält man Minimalpaare wie Kasten, fasten, hasten, Masten, Lasten, rasten oder Tasten. Mit einer derartigen Minimalpaaranalyse lässt sich feststellen, ob Phone eine bedeutungsunterscheidende Funktion haben und deshalb als Phoneme bezeichnet werden. Meint man dagegen Phone – wie in unserem Beispiel die unterschiedlichen k-Laute in Kinn und Kuh –, setzt man sie in eckige Klammern: [k].
Grapheme hingegen, die in der Regel aus einem Buchstaben bestehen, setzt man in spitze Klammern: <k>. Grapheme können aber auch aus zwei oder drei Buchstaben bestehen wie beim <ch> oder <sch>. Für das Phonem /ʃ/ steht im Deutschen das Graphem <sch> (Schule), im Türkischen ein <ş> (şiş), im Englischen ein <sh> (ship), im Ungarischen ein <s> (sós) und im Kroatischen ein <š> (škola).
Das Phonem /r/ ist ein besonders interessanter Fall, da es im deutschsprachigen Raum höchst unterschiedlich artikuliert wird. Im Bairischen wird es durch rasche Bewegungen der Zungenspitze gebildet und in der Internationalen Lautschrift mit [r] notiert, im übrigen Deutschland meist als ein stimmhafter, am Gaumenzäpfchen gebildeter Reibelaut, der als [ʁ] transkribiert wird, oder als [R], das mit dem Zäpfchen ‚gerollt‘ wird. Diese Unterschiede haben aber keinen Einfluss auf die Bedeutung von Wörtern. Ein Rad bleibt immer ein Rad, ganz gleich, wie das Phonem /r/ ausgesprochen wird.
In Norddeutschland wird das /r/ postvokalisch nach /a/ meist gar nicht realisiert, beispielsweise in Garten, aber dennoch schreiben auch die Norddeutschen Garten mit <r>, da die Schreibung keine Rücksicht auf regionale Varianten nehmen kann, sondern sich an der Standardaussprache orientiert und jedem Phonem systematisch bestimmte Grapheme zuordnet. Anstatt von einer Laut-Buchstaben-Beziehung sollte man deshalb, fachlich korrekter, von einer Phonem-Graphem-Korrespondenz sprechen.
Man möchte annehmen, dass es für Schreiber wie für Leser einer Sprache das Beste wäre, wenn immer genau einem Phonem ein Graphem entsprechen würde, so wie das weitgehend im Spanischen, Finnischen oder im Türkischen geregelt ist. Die erst 1928 neu entwickelte türkische Schrift ist tatsächlich einfach zu erlernen und problemlos zu lesen. In alten Schriftsystemen wie dem Englischen oder dem Französischen ist die Phonem-Graphem-Korrespondenz hingegen kompliziert. Das englische Wort enough mit sechs Graphemen korrespondiert kaum mit den vier Phonemen /inaf/. Und das französische queue mit fünf Graphemen wird mit nur zwei Phonemen als /kö/ gesprochen. Der Grund für die schwer zu erlernende englische und französische Orthografie liegt in ihrem Alter. Schreibungen sind wesentlich konservativer als die gesprochene Sprache, die sich rascher wandelt. In der Schreibung werden ältere Lautungen konserviert. Englische Wörter wie knob, knot oder knee werden am Anfang immer noch mit einem <k> geschrieben, obwohl initial längst kein /k/ mehr gesprochen wird, während im Deutschen in Knopf, Knoten und Knie das /k/ im Mündlichen erhalten blieb.
Das deutsche Schriftsystem beruht nicht, wie das spanische, weitgehend auch das türkische, auf einer 1:1-Phonem-Graphem-Korrespondenz, aber es ist auch nicht so undurchsichtig wie das englische oder französische. Spanische und türkische Kinder können deshalb relativ problemlos mit einer Anlauttabelle das Schreiben erlernen, während englische oder französische Anlauttabellen nicht funktionieren würden. Für das Deutsche ist dieses häufig eingesetzte Hilfsmittel zum Lesen- und Schreibenlernen allenfalls für den Einstieg geeignet, um das Prinzip der Alphabetschrift zu veranschaulichen. Ein längerer Gebrauch wäre aber nicht zielführend, da Anlauttabellen eine 1:1-Phonem-Graphem-Korrespondenz suggerieren, die es im Deutschen in eindeutiger Form nur bei wenigen Wörtern gibt. Stattdessen müssen zwei Alternativen bedacht werden:
1 für ein Phonem können mehrere Grapheme stehen
2 ein Graphem kann mit mehreren Phonemen korrespondieren
Im ersten Fall liegt das Problem beim Schreiber, der seine Mündlichkeit in Schrift umsetzen und dazu das entsprechende Graphem aus einer Reihe von Möglichkeiten auswählen muss. Im zweiten Fall hat der Leser das Problem, von einem Graphem auf die zutreffende Aussprache von mehreren möglichen zu schließen.
Für einen Schreiber, der beispielsweise für das Phonem /k/ ein entsprechendes Graphem finden muss, ist eine Anlauttabelle von geringem Nutzen, da sie ihm nur das <k> als Klein- und Großbuchstaben anbietet. Für Wörter wie Sack oder Wachs muss aber eine Kombination von zwei Buchstaben, die Digraphen <ck> und <ch>, gewählt werden, für das Wort Hexe benötigt man das Graphem <x> für die Phoneme /k/ + /s/ und in Wörtern fremder Herkunft wie Club oder Clique stehen der Monograph <c> und der Digraph <qu> für das Phonem /k/. Für Schreiber, vor allem für Anfänger, ist diese Vielfalt sicherlich unangenehm, da sie mit einem erhöhten Lernaufwand verbunden ist, aber für Leser haben diese Schreibungen einen informativen Mehrwert, da sie sich mit ihrer anderen Schreibung vom Kernwortschatz abheben, dem Leser als ‚besondere Wörter‘ ins Auge fallen und ihm eine fremde Herkunft signalisieren können. Würde ein Schreiber von einer 1:1-Phonem-Graphem-Korrespondenz ausgehen und eine Anlauttabelle nutzen, würde er diese Wörter so schreiben: *Sak, *Waks, *Hekse, *Klup, *Klike. Für den Schreiber wäre das sicherlich leichter so, aber der Leser hätte Probleme mit der Sinnentnahme.
Ein anderes Problem hat der Leser damit, anhand eines Graphems zu erkennen, für welches Phonem es steht. So kann das Graphem <o> für ein kurzes, ungespanntes /ɔ/ wie in Topf stehen, aber auch für ein langes, gespanntes /o:/ wie in rot. Das Graphem <e> kann sogar vier mögliche Phoneme repräsentieren:
| (1) | /e:/ | Steg, Weg |
| /e/ | legal | |
| /ɛ/ | Geld, weg | |
| /ə/ | Tage |
Und schließlich kann das Graphem <e> auch mit gar keinem Phonem korrespondieren, nämlich beim <ie> wie in Sieb, wo es als Längezeichen dient, oder beim umgangssprachlichen Wegfall (vulgo: Verschlucken) des /ə/ in Wörtern wie Mittel oder wohnen.
Die Unterschiede in der Aussprache des Graphems <e> sind nur für Leseanfänger und Deutsch-Lerner problematisch. Kinder im Anfangsunterricht lesen ein Wort wie geben häufig als [ge:be:n], da sie nicht beachten, dass das Graphem <e> in unbetonten Silben immer nur als /ə/, also als Schwa (Murmelvokal), artikuliert werden kann. Kompetente Leser dagegen erkennen seine Aussprache normalerweise leicht durch seine Position im Wort oder der Silbe. Beim <e> in Weg kann es sich nur um das lange, gespannte /e:/ handeln, da Weg zur zweisilbigen Form Wege verlängert werden kann, während das bei weg nicht möglich ist. In Topf wird das <o> als kurzes, ungespanntes /ɔ/ realisiert, da zwei Konsonanten folgen, während in rot nur ein Konsonant folgt und das Wort zu rote oder rotes verlängert werden kann. Später werden wir diese Regularitäten noch genauer erläutern.
Auch Konsonantengrapheme können mit mehreren Phonemen korrespondieren. Das Graphem <s> wird am Silbenende stimmlos als /s/ (Haus) gesprochen, am Silbenbeginn dagegen stimmhaft als /z/ (Sahne), allerdings nur in der nördlichen Hälfte Deutschlands, und schließlich wird das <s> mit nachfolgendem <t> oder <p> als /ʃ/ (Stein, Spiel) realisiert.
Die Grapheme <b>, <d> und <g> werden am Ende einer Silbe als [p], [t] oder [k] realisiert, so in Wörtern wie Bub, Bad oder Weg. Auch hier gibt die Verlängerung dieser einsilbigen Wörter in eine zweisilbige Form dem Leser den Hinweis, dass Bub mit Buben, Bad mit Bädern und Weg mit Wegen semantisch eine Einheit bilden. Man bezeichnet das Prinzip, das dieser Regelung zugrunde liegt, als Stammprinzip oder morphematisches Prinzip. Es sorgt dafür, dass lexikalische Morpheme (Wortstämme) wie <kind>, <lob> oder <klang> in allen Wortformen erhalten bleiben, aber auch grammatische Morpheme (Flexionsendungen) wie <-er>, <-en> und Wortbildungsmorpheme (Vor- und Nachsilben) wie <ver->, <ent->, <-keit>, <-ig>, <-lich> oder <-ung> werden immer gleich geschrieben. Dieses Erhaltungsprinzip bietet dem Leser Sicherheit, in Bruchteilen von Sekunden zu erkennen, welche lexikalischen und welche grammatischen Informationen kodiert wurden.
Neben Morphemen werden in der Schrift auch unbetonte Silben erhalten, die in der gesprochenen Alltagssprache nicht mehr artikuliert (vulgo: verschluckt) werden. Da sich das Deutsche beim Übergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen von einer Silbensprache mit vollen Endsilben zu einer Wortsprache gewandelt hat (Szczepaniak 2007), haben sich die unbetonten Silben immer weiter abgeschwächt, teilweise sind sie gänzlich verschwunden. In Wörtern wie Fibel oder Hasen ist der Schwa-Laut in der Regel nicht mehr zu hören. Und in Wörtern, die auf <-er> enden, wird standardsprachlich nur ein dunklerer Schwa-Laut, das [ɐ], realisiert. Grundsätzlich kann man also sagen, dass sich die unbetonten Sprechsilben so stark abgeschwächt haben, dass sie kaum noch oder gar nicht mehr hörbar sind, während sie als Schreibsilben erhalten blieben, weil das für die rasche Sinnentnahme beim Lesen nützlich ist. Das Graphem <e> bleibt grundsätzlich immer in diesen unbetonten Endsilben beim Schreiben erhalten.
Zu einer weitgehenden Vereinheitlichung der regionalen Schreibkonventionen kam es seit dem 15. Jahrhundert mit Beginn des Buchdrucks. Die Schreibungen wurden im Hinblick auf die Leser optimiert und zwar vor allem von den Druckern, die ihre Schriften in gut lesbarer Form auf den Markt bringen wollten (Maas 2015: 21). Die heute gültigen orthografischen Regelungen wurden also nicht von Sprachwissenschaftlern in Elfenbeintürmen ausgeheckt, sondern von Druckereien, die die Regeln nach und nach an den Bedürfnissen ihrer Leserschaft ausgerichtet haben, um ihre Produkte besser verkaufen zu können.
Ein entscheidender Schritt zur Optimierung des Lesens war die Einführung von Leerstellen zwischen den Wörtern, den sogenannten Spatien, sowie der Großschreibung am Satzanfang und der Punkte am Satzende: alles Konventionen, die man in mündlicher Rede nicht hören kann, die aber dem Leser ungemein helfen, rasch und problemlos den Sinn eines Textes zu erfassen. Diese Konventionen nötigen den Schreiber aber zu entscheiden, wo sich eine Wortgrenze und wo sich eine Satzgrenze befindet. Mit Einführung von Kommaregelungen wurden Sätze für Leser nochmals leichter erfassbar; Schreiber bekamen im Gegenzug so die noch anspruchsvollere Aufgabe, innerhalb von Sätzen syntaktische Strukturen zu erkennen. Im Zuge der Vereinheitlichung und Optimierung der Rechtschreibung kam es dann auch zu dem oben erwähnten Erhaltungsprinzip.