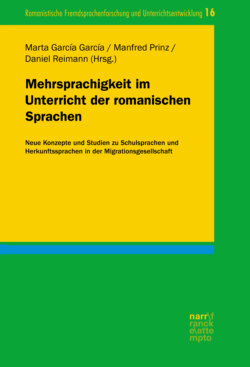Читать книгу Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen - Группа авторов - Страница 12
1.6 Silben
ОглавлениеEinzelne Laute können im Lautstrom nur schlecht erkannt werden, da sie nicht klar voneinander abgegrenzt sind, sondern ineinanderfließen und sich gegenseitig beeinflussen. Dieses lautliche Ineinanderfließen bezeichnet man als Koartikulation. Silben dagegen lassen sich besser als lautliche Einheiten erkennen, vor allem betonte Silben. Viele unbetonte Silben sind dagegen bei normalem Sprechtempo kaum hörbar; sie werden ‚verschluckt‘. Das Verb werden wird umgangssprachlich zu /vɛɐdn/ oder noch kürzer zu /vɛɐn/, was dann von Schreibanfängern gerne als *wean geschrieben wird. Hinzu kommt das Problem bei Wörtern mit Konsonantenverdoppelung wie Mutter, die zwar leicht als zweisilbig erkannt werden, aber bei denen es nicht klar ist, wo genau die Grenze zwischen der ersten und der zweiten Silbe liegt. Doch bevor wir näher auf zweisilbige Wörter eingehen, wollen wir uns zunächst den Aufbau von Einsilbern ansehen.
| Konsonanten im Anfangsrand (AR) Onset | ein Vokal im Silbenkern (KERN) Nukleus | Konsonanten im Endrand (ER) Koda | Wort | |
| t | u: | t | tut | |
| ʔ | ɪ | n | in | |
| ts | o: | Zoo | ||
| ʃtr | aɪ | t | Streit | |
| ʃ | ɪ | mpfst | schimpfst |
Tabelle 1.5:
Struktur von Einsilbern
Graphisch lässt sich die Silbenstruktur eines Wortes wie Streit folgendermaßen darstellen (σ = Silbe):
Abbildung 1.2:
Silbenstruktur (AR: Anfangsrand, ER: Endrand)
Der Kern einer Silbe wird immer von einem Vokal oder einem Diphthong ausgefüllt. Vokale tragen die größte Schallfülle, das Sonoritätsmaximum, was besonders beim Singen deutlich wird. Die Anfangs- und Endränder werden von Konsonanten besetzt. In einem Wort wie in scheint der Konsonant im Anfangsrand zu fehlen. Aber dort befindet sich, wie immer, wenn eine Silbe mit einem Vokal beginnt, der bereits erwähnte Knacklaut [ʔ], der in der Schrift nicht erscheint. In der Koda hingegen können Konsonanten gänzlich fehlen wie in Zoo.
Das Deutsche ist für viele, die Deutsch lernen, eine schwierige Sprache, da im Anfangsrand wie im Endrand mehrere Konsonanten gehäuft auftreten können: im Anfangsrand bis zu drei und im Endrand bis zu fünf Konsonanten, wie man an den Beispielen <Streit> und <schimpfst> sehen kann. Schreiber mit einer anderen Herkunftssprache, in der diese Konsonantenhäufungen nicht vorkommen, neigen deshalb manchmal dazu, Vokale zwischen den Konsonanten einzufügen, um diese für sie ungewohnten Konsonantencluster ihrem anders geprägten Sprachgebrauch anzupassen. Anstatt Blume kann man dann manchmal die Schreibung *Bulume oder anstatt brechen *berechen finden.
Die Abfolge der Konsonanten am Anfang und am Ende einer Silbe ist keineswegs beliebig, sondern richtet sich nach der Schallfülle (Sonorität), die die einzelnen Konsonanten enthalten. Vom Kern einer Silbe, dort wo ein Vokal mit der größten Schallfülle sitzt, nimmt sie zu den Rändern der Silbe hin ab. Das bedeutet, dass die Konsonanten mit einer höheren Sonorität näher am Kern liegen und diejenigen mit geringerer Sonorität sich eher an den Rändern befinden. Konsonanten lassen sich also hinsichtlich ihrer Sonorität hierarchisch anordnen.
| Plosive | Frikative | Nasale | Liquide | |
| p, t, k, b, d, g | s, ʃ, z, f, v, ç, x | m, n, ŋ | l, r | h, j |
gering hoch
Diese Hierarchie führt zu bestimmten Abfolgen der Konsonanten: Am Anfangsrand steigt die Sonorität an und im Endrand fällt sie wieder ab. Deshalb kommt es am Anfang und am Ende von betonten Silben zu umgekehrten Abfolgen, wie die folgenden Beispiele zeigen.
Am Anfangsrand sind diese Abfolgen möglich:
| (2) | /p – l/ | wie in Plage |
| /p – r/ | wie in Preis | |
| /ʃ – m/ | wie in schmecken | |
| /ʃ – n/ | wie in Schnecke |
Im Endrand kehren sich diese Abfolgen um:
| (3) | /l – p/ | wie in Kalb |
| /r – p/ | wie in Korb | |
| /m – ʃ/ | wie in Ramsch | |
| /n – ʃ/ | wie in Wunsch |