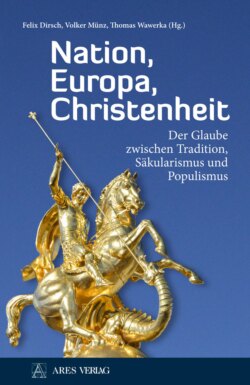Читать книгу Nation, Europa, Christenheit - Группа авторов - Страница 12
I.
ОглавлениеDas sog. Framing-Manual empfiehlt der ARD: „Wenn Sie Ihren Mitbürgern die Aufgaben und Ziele der ARD begreifbar machen und sie gegen die orchestrierten Angriffe von Gegnern verteidigen wollen, dann sollte Ihre Kommunikation nicht in Form reiner Faktenargumente daher kommen, sondern immer auf moralische Frames aufgebaut sein, die jenen Fakten, die Sie als wichtig erachten, Dringlichkeit verleihen und sie aus Ihrer Sicht – nicht jener der Gegner – interpretieren. […] Wer maximale Framing-Effekte hervorrufen will, der muss in seiner Kommunikation also auf moralische Kohärenz achten.“1
Moral, der Wille zum Gutsein, ist eine höchst ambivalente Angelegenheit. Auf der einen Seite ein innerer Kompass des Denkens, Redens, Handelns, die Stimme des sokratischen daimonion, die Stimme des Gewissens, Ausdruck der Freiheit, Ausweis des Menschseins, indem der Mensch sich übers „Reich der Notwendigkeit“ erhebt und der Welt, besonders der Welt seiner Mitmenschen, der sozialen Welt, kreativproduktiv gegenübertritt. Auf der anderen Seite vielleicht bloße Umweltresonanz, Konditionierung durch die Gesellschaft, ein passives Sich-formen-Lassen, Sich-Gleichmachen, Anpassen an Erwartungen, Nachsprechen und Nachmachen des Gegebenen. Im schlechtesten Falle – wie im Fall des ARD-Framing-Manuals – jedoch ein Mittel zu Zwecken im Werkzeugkasten von Sophisten, Faktor in einer Kosten-Nutzen-Rechnung, kalte Klinge des Sozialtechnikers, Brennholz für den Propagandisten. Und oft ist das eine vom anderen schwer oder kaum noch zu unterscheiden, allzu oft tritt das eine in der Maske des anderen auf oder sind die Aspekte unentwirrbar eng miteinander und ineinander verknäult. Und jeder einzelne Aspekt für sich genommen ist ambivalent.
Moral will sich äußern. Moral will gestalten. Moral will verändern, auf die eine oder andere Weise.
Dennoch, zur Verwunderung vieler Nichtchristen und mittlerweile wohl auch vieler Christen ist Moral nicht das Leitthema des christlichen Glaubens. Es bedeutet, den christlichen Glauben empfindlich zu beschneiden, ja ihn zu verstümmeln, wenn man ihn als Regularium zur Besserung des Menschseins auffasst. Der christliche Glaube kann und muss mitunter sogar amoralisch sein. Das betrifft nicht nur die Konfrontation mit einer aus christlicher Perspektive falschen oder unzureichenden Moralität, wie es beispielsweise in der Konfrontation Christi mit den Pharisäern deutlich wird, wie es auch in der Konfrontation des Paulus mit „denen, die sich selber rühmen“ deutlich wird, sondern die Aufhebung des sozialen Urteils anhand einer Gut-böse-Bruchlinie überhaupt.
Die Polarität von „gut und böse“, die sich in jedweder Moral ausdrückt, scheint zum Grundbestand des Menschseins zu gehören, näherhin zur Grundverfassung des Menschen als sozialem Wesen. Für Robinson hatte Moral jenseits erlernter Konventionen auf seiner Insel keinerlei Raum, bis Freitag kam. Moralität ist eine Folge der Sozialität. Durch die Begegnung mit dem Anderen kam es für Robinson zur moralischen Situation: Sollte er ihn vor den Kannibalen retten? Sollte er ihn den Kannibalen ausliefern? Sollte er ihn und die Kannibalen ignorieren? Und apropos Kannibalen: Wie sollte er sich denen gegenüber verhalten? Was ist in dieser Situation gutes, was ist böses Handeln? Die moralische Situation ist eine Entscheidungssituation.
Vor der Heraufkunft des christlichen Abendlandes war diese Entscheidungssituation bzw. die Bruchlinie durch die Sitten der Väter definiert. Die Bedingungen des Zusammenlebens sind in der kahlen, kühlen Bergwelt andere als im schönsten Wiesengrunde, sie sind im ewigen Eis andere als in der ewigen Wüste. Man müsste meinen, die Art und Weise des Zusammenlebens und folglich das, was „gut“ und „böse“ genannt wird, müsse sich den natürlichen Gegebenheiten ebenso optimal anpassen wie jeder einzelne Mensch durch die Art und Weise seiner Kleidung, Ernährung, Behausung, aber so ist es nicht. „Gut“ war durchaus nicht immer das, was das gute Leben förderte – und so ist es bis heute. Moral drückt sich oft gerade als Gegenteil des Wohllebens aus: als Einschränkung, als Verzicht, als Opfer bis hin zum Martyrium. Dahinter verbirgt sich auch keine „Do-ut-des“-Berechnung, nach der ein Opfer nützlich sein kann, wenn es mir beispielsweise jemanden zur Dankbarkeit verpflichtet, wenn ich bei jemandem etwas „guthabe“, jedenfalls nicht ausschließlich. Das Gute, dem man durch die Moral zu entsprechen versucht, ist originär metaphysischer Natur. Antigone muss ihren getöteten Bruder Polyneikes bestatten, auch wenn es nur symbolisch durch eine Handvoll Erde geschieht. Der innere Ruf, ja der Zwang zu dieser moralischen Handlung ist stärker als das Gesetz des Königs und als jedweder denkbare Nutzen. Antigone kann für ihre moralische Handlung nichts anderes erwarten als den eigenen Tod. Auch sonst hat niemand einen Nutzen davon.
Moral ist eine Macht, und wer die Macht über die Moral hat, hat größere Macht als der, der wie Kreon die Macht über Leben und Tod hat.
In der zweiten Epoche der europäischen Moralgeschichte war die Entscheidungssituation bzw. die Bruchlinie christlich definiert. Mehr als tausend Jahre lang bestimmte die Lehre der Kirche, was „gut“ und was „böse“ war. In der aktuellen dritten Epoche sind es die „Werte“, die sich aus dem Kondensat der philosophischen Diskussion ergeben, die mit der Aufklärung begonnen hat und deren letzte Aktualisierung die Frankfurter Schule darstellt: Ideen, die sich in Schlagworten wie „Menschenwürde“ oder „Menschenrechte“ äußern, „Demokratie“, „Gerechtigkeit“, „Solidarität“, „Gleichheit“. Dabei will man säkular sein, bedient sich aber reichhaltig und durchaus eklektisch aus dem spirituellen Schatz, der in der vorangegangenen Epoche angespart wurde, verleiht er doch dem Menschlich-Allzumenschlichen höhere Weihen. Besonders beliebt ist die Beschwörung der christlichen Begriffe – und hier sind sie nun endlich – „Nächstenliebe“ und „Barmherzigkeit“.
Ausgerüstet mit dem Erntestock klopft man die Krone des alten Baumes ab, ob vielleicht doch noch ein paar brauchbare Oliven herabfallen mögen.
Man entfremdet die Begriffe von ihrem christlichen Ursprung. Man verändert sie damit. Sind sie erst einmal im Sprachsalat des modernen Humanitarismus gelandet, gehen sie ihres Sinns und ihrer Würde verlustig. Ein letzter Schimmer ist schon noch vorhanden, ein Nachgeschmack des Eigentlichen (sonst wären sie ja nicht zu gebrauchen), doch wie wenig hat das, was man nun vollmundig verbreitet, mit dem zu tun, was eigentlich nur nachgebetet werden kann! – Aber so funktioniert es. Das ist Framing.
Framing ist nicht generell verwerflich. Es bedeutet einfach: etwas in einen Bezugsrahmen einordnen. Das tun wir alle. Es ist auch nicht unbedingt als politisches Instrument verwerflich. Die nachständische bürgerliche Gesellschaft ist Massengesellschaft, und die Masse muss irgendwie in irgendeiner Form gehalten werden. Natürlich geht man vom Idealbild des mündigen Bürgers und der demokratischen Verfassung aus, aber wie jedes Ideal ist auch dieses nur bedingt praktikabel oder alltagstauglich. Die bürgerlichen Institutionen, die bisher dem Einzelnen und damit der Gesellschaft insgesamt Form gaben, die Orientierung und Ordnung vermittelten – Schule, Kirche und Heer –, verlieren unter dem Diktat der Liberalisierung und der politischen Gleichschaltung zunehmend ihre Prägekraft. Auf die Liberalisierung folgt Banalisierung. Man kann die Masse auch durch Gewalt und Gulag lenken, wenn man das aber nicht will, ist man auf die Mittel der Psychologie angewiesen. Edward Bernays eröffnet sein 1928 erschienenes Buch „Propaganda“ mit den Worten:
„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichen funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren.“2
Entsprechend dem „Laplaceschen Dämon“ der Physik ließe sich ein „Bernaysscher Dämon“ vorstellen, der jede moralische Regung eines menschlichen Gewissens sowie die moralischen Regungen aller Gewissen kennt und ein perfektes psychologisches Instrumentarium zur Hand hat, mit dem er diese Regungen steuern kann. Die Steuerung einer Gesellschaft und jedes einzelnen ihrer Individuen wäre dann ohne jeglichen Zwang, sogar ohne jegliche Androhung von Zwang oder Gewalt möglich – die Menschen würden aus moralischen Gründen und damit aus (vermeintlich) eigenem Antrieb heraus tun, was sie im Sinne der „unsichtbaren Regierung“ tun sollen.
Der „Bernayssche Dämon“ ist keine Realität, und es ist fraglich, ob er es je werden kann. Aber genauso fraglich ist es, ob er nicht dennoch Wunsch- und Zielvorstellung in politischen Stiftungen und Instituten, Denkfabriken und NGOs ist. Die Instrumente sind da, sie werden eingesetzt, und das moralische Framing ist eines davon.
In kaum einem anderen Zusammenhang wird dies aktuell so deutlich wie in der Migrationsdebatte, und in kaum einem anderen wird – gerade von Protagonisten, die sich sonst aggressiv oder zumindest bewusst säkular geben – die christliche Begrifflichkeit derart inflationär verwendet, derart ausgeschüttelt und ausgewrungen, als gälte es, das letzte bisschen höhere Bestimmung herauszupressen, mit der man die eigenen Absichten gerade angesichts zunehmender Kritik bemäntelt und beschützt sehen will. Den Kritikern der Migrationspolitik werden hingegen unisono „Nächstenliebe und Barmherzigkeit“ abgesprochen bzw. wird von ihnen ein Bekenntnis zu „christlichen Werten“ gefordert, die wahlweise auch „europäische Werte“ seien und die man nicht aufgeben könne, ohne dass „Europa seine Seele verliere“.
Auch das ist Framing. Migrationspolitische Entscheidungen werden – lehrbuchmäßig, wie es u. a. das ARD-Manual empfiehlt – in einen moralischen Bezugsrahmen eingeordnet. Er dient einerseits dazu, den Kritiker unter moralischen Rechtfertigungsdruck zu bringen (DDR-Bürger kennen das: „Du bist wohl gegen Frieden?“), andererseits dazu, die politischen Entscheidungen in eine Sphäre höherer Weihen zu heben, wo sie nicht mehr kontrovers diskutiert werden können und nicht mehr rational begründet werden müssen, sondern nur noch hinzunehmen und zu tragen sind.
Es geht im Folgenden nicht um die Migrationspolitik, sondern um die moralische Haltung, die im Zusammenhang damit deutlich wird, und kontrastierend dazu um die eigentlich christliche Haltung. Ich werde mich auch mit der Dekonstruktion dieses Framings nicht lange aufhalten. Nur ein paar Punkte:
1.Nächstenliebe und Barmherzigkeit sind keine „christlichen Werte“. Der Ausdruck „christliche Werte“ ist überhaupt irreführend.3 „Werte“ sind ein soziales Konstrukt der liberalen Moderne. Solange man den christlichen Glauben hatte, brauchte man keine „Werte“. „Werte“ sind nur ein moderner Ersatz: Überzeugungen, die Zustimmung einfordern. Nächstenliebe und Barmherzigkeit hingegen sind Christi Gebote an seine Jünger. Sie verlangen keine Zustimmung, sondern persönliche und praktische Umsetzung. Sie sind kein Gegenstand der Diskussion, sie wirken in Form von Befehl und Gehorsam. Werte dagegen wirken in Form von Appell und Affirmation.
2.Dietrich Bonhoeffer schreibt zum Wesen der christlichen Ethik: „Das Wissen um Gut und Böse scheint das Ziel aller ethischen Besinnung zu sein. Die christliche Ethik hat ihre erste Aufgabe darin, dieses Wissen aufzuheben. Sie steht mit diesem Angriff auf die Voraussetzungen aller sonstigen Ethik so allein, dass es fraglich wird, ob es einen Sinn hat, überhaupt von christlicher Ethik zu sprechen.“4 Diese Sätze sind radikal zu verstehen. Der christliche Glaube beurteilt Menschen überhaupt nicht als „Gute“ oder „Böse“ in dem Sinne, dass die „Guten“ z. B. jene wären, die sich der Nächstenliebe befleißigen (oder, im modernen Sinn: die zustimmen, dass es sich dabei um „unsere Werte“ handelt, und anderen die Ausführung überlassen). „Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein“, sagt Christus in Mk 10,17. Und der Apostel Paulus in Röm 3,23: „Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.“ Es gibt keinen Menschen, der „gut“ wäre (das christologische Problem, das durch die Antwort Jesu aufgeworfen wird, sei hier ignoriert), deshalb besteht auch kein Grund, „sich selbst zu rühmen“ und über andere „zu richten“. Alle sind Sünder. Allen ist das Gebot der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit auferlegt. Keiner hat das Recht, über einen anderen zu richten. Jedes Richten über den anderen fällt unweigerlich auf den zurück, der richtet (Röm 2,1). Nach jeder Art herkömmlichen Verständnis’ von Moral kann das Christentum deshalb nur amoralisch genannt werden.
3.Armin Mohler fasst in seiner Polemik „Gegen die Liberalen“ das Wesen der „Werte“ zusammen: „Was ich den Liberalen nicht verzeihe, ist, daß sie eine Gesellschaft geschaffen haben, in der ein Mensch danach beurteilt wird, was er sagt (oder schreibt) – nicht nach dem, was er ist. Und da dies immer noch etwas metaphysisch klingt, sage ich es genauer: eine Gesellschaft, in der ein Mensch danach beurteilt wird, was er sagt – und nicht danach, was er tut.“5 Dass er mit dieser Aussage ins Schwarze trifft, kann man am Beispiel der Migrationsthematik exemplarisch beobachten. Kritiker der Migrationspolitik werden moralisch exkludiert. Ihre Ansichten gelten als „Hass und Hetze“, sie werden ihnen nicht als „Meinung“ zugestanden, sondern als (gedankliches) „Verbrechen“ vorgeworfen. („Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“, vgl. die „Gedankenverbrechen“ in Orwells „1984“!) Ihre Ansichten sind unmögliche Ansichten, über die man nicht diskutieren kann, und das macht sie zu unmöglichen Menschen – und zwar, das ist der entscheidende Punkt, völlig unabhängig davon, was sie tatsächlich tun: ob sie z. B. hilfsbereite Menschen sind, die Nächstenliebe und Barmherzigkeit in ihrem Alltag tatsächlich ernst nehmen und praktizieren. Das ist egal. Die Tat gilt nichts. Die öffentliche Bekundung gilt alles. Und umgekehrt ist das Gleiche der Fall: Befürworter der Migrationspolitik können sich im Schein des moralisch Guten sonnen, völlig unabhängig von dem, was sie wirklich tun. „Werte“ ersetzen Tugenden, genauer gesagt: die Affirmation der „Werte“ ersetzt die tugendhafte, sittliche Praxis. Das treffendste Beispiel für dieses Missverhältnis und der beste Beleg für Mohlers Aussage sind die Flüchtlingsbürgen, die dagegen klagten, dass aufgrund ihrer Bürgschaft Geld von ihnen verlangt wurde. Sie bekundeten öffentlich das moralisch vermeintlich Gute und Gebotene, aber mehr als eine Bekundung war es auch nicht. Man könnte Mohlers Aussage noch einmal herunterbrechen: Bei den viel beschworenen „Werten“ handelt es sich häufig um Facebook-Ethik: liken, fertig. Dass dies mit der christlichen Ethik nicht das Geringste gemein hat, muss klar sein.
4.Dass „christliche Werte“ wie „Nächstenliebe“ und „Barmherzigkeit“ die „europäischen Werte“ seien oder gar die „Seele Europas“, ist, mit Verlaub, das geistige Äquivalent zum Schlager. Es ist Moralschmalz. Die „Seele Europas“ kann überhaupt nur in der Emanzipation vom antiken asiatischen und afrikanischen Gedanken des Gottkaisertums bestehen. Das christliche Europa, das christliche Abendland formierte sich in der Trennung von weltlicher und geistlicher Macht. Es entstand eine säkulare Sphäre, in der Politik nicht lediglich als Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln betrieben, sondern als davon unterschiedener Zuständigkeitsbereich aufgefasst wurde. Die „Seele Europas“ besteht in der Gewaltenteilung von Thron und Altar. Freilich gelang diese Unterscheidung selten idealtypisch, immer wieder in der Geschichte versuchten beide Seiten, sich der jeweils anderen zu bemächtigen und sie sich zu unterwerfen. Und freilich gab es ein von der Religion weitgehend emanzipiertes Herrschertum auch in Griechenland und in Rom. Die Versuchung war allerdings eminent: Alexander der Große verscherzte sich in Baktrien die Sympathien seiner Gefolgsleute dadurch, dass er die Proskynese von ihnen verlangte. Auch die Geschichte der römischen Kaiser zeigt die verhängnisvolle Tendenz hin zur Selbstvergottung. Und wenn heute Kirchenfürsten mit „christlichen Werten“ Politik sanktionieren und Politiker sich wiederum durch „christliche Werte“ unangreifbar machen, entsteht eine Dynamik, die sich vom Prinzip des Gottkaisertums letztlich nur in Nuancen unterscheidet. Das abendländische Christentum ist der Garant der Unterscheidung von Thron und Altar, denn im Namen Christi ist allen Versuchen eines theokratischen Upgrades entschieden zu widersprechen: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ (Mt 22,21)
Das Framing ist die eine Seite, die Seite des Senders. Auf der anderen Seite stehen die Empfänger, und es stellt sich die Frage, warum das Framing so überaus erfolgreich wirkt. Die zwar schrumpfende, aber immer noch überwiegende Mehrheit der Bürger, die ja sonst durchaus zu vielerlei Kritik fähig ist, scheint im Zusammenhang mit der Migrationspolitik jede noch so absurde Aussage unreflektiert hinzunehmen, jede noch so bittere Pille bereitwillig zu schlucken.
Die Kritiker der Migrationspolitik schütteln konsterniert den Kopf, reden von „Verblendung“, „Blase“, „Schlafschafen“. Die geballte Macht der Medien mag einen Teil des Phänomens erklären, aber das ist noch nicht alles. Die Frage ist, warum das im ARD-Manual empfohlene Framing überhaupt funktioniert, warum die moralische Rahmung politischer Entscheidungen eine Entwicklung zur politischen Alternativlosigkeit ermöglichen konnte. Diese Frage ist nicht nur von Bedeutung für die Analyse der aktuellen politischen Großwetterlage, sondern für die Art und Weise der künftigen politischen Kommunikation überhaupt.
Fündig wird man bei Friedrich August von Hayek und seinem Theorem der „zwei Moralsysteme“6 (auch „Zwei-Welten-Theorem“ genannt). Hayek unterscheidet die persönliche Lebenswelt des sozialen Nahraums (die „Mikroordnung“) von der unpersönlichen Bezugswelt eines politischen und wirtschaftlichen Großraums (der „erweiterten Ordnung“). Das eine ist Familie, Verwandtschaft, Freundes- und Kollegenkreis, geprägt durch persönliche Beziehungen und Gemeinschaftsbildung, das andere Markt und Staat – und „zwischen Staaten gibt es keine Freundschaft, es gibt nur gemeinsame Interessen“, soll Charles de Gaulle so oder so ähnlich gesagt haben, und damit bringt er den Unterschied auf den Punkt.
Hayek drückt es so aus: „Der entscheidende Unterschied […] ist der, daß die kleine Gruppe in ihren Tätigkeiten sich von vereinbarten Zielen oder dem Willen der Angehörigen leiten lassen kann, während die erweiterte Ordnung […] zu einem in sich harmonierenden Gebilde dadurch wird, daß ihre Mitglieder bei der Verfolgung unterschiedlicher individueller Zwecke sich nach ähnlichen Verhaltensregeln richten.“7 („Ähnlich“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass die Verhaltensregeln der erweiterten Ordnung denen der kleinen Gruppe ähnlich sind, sondern dass in der erweiterten Ordnung einander ähnliche Verhaltensregeln für alle gelten, unabhängig davon, welche Interessen jeder Einzelne verfolgt.)
Den weit überwiegenden Teil der Menschheitsgeschichte haben sich Menschen im sozialen Nahraum bewegt. Der Großraum ist demgegenüber geschichtlich eine recht junge Entwicklung (Hayek verortet sein Entstehen mit der Entstehung des Handels8), aber auch individuell immer eine neue Erfahrung, da jeder Mensch vom sozialen Nahraum herkommt. Im sozialen Nahraum gelten andere Regeln als im Großraum. Der Nahraum wird als „warm“ und „persönlich“ empfunden, der Großraum als „kalt“ und „unpersönlich“. Im Nahraum kommt es auf die Tugenden persönlicher Beziehungen an: Vertrauen, Mitgefühl, Zuwendung, Verständnis etc. Im Großraum spielen diese Tugenden keine oder doch eine nur sehr untergeordnete Rolle, hier wird die Kommunikation rational, technisch, juristisch, abstrakt.
Hayeks Theorem lässt sich neurobiologisch durch die sogenannte Dunbar-Zahl belegen. Robin Dunbar wies eine Korrelation zwischen dem Aufbau des Gehirns von Säugetieren und der Zahl von Individuen nach, zu denen ein Individuum eine soziale Nahbeziehung eingehen kann. Bei Menschen liegt diese Zahl im Schnitt bei 150. „Diese Zahl erscheint regelmäßig in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft. Es ist die geschätzte Größe eines neolithischen Bauerndorfs, die Größe, ab der die Siedlungen der Hethiter aufgeteilt wurden, und die Größe militärischer Grundeinheiten seit den Tagen der alten Römer. Es ist die durchschnittliche Anzahl von Leuten, denen man Weihnachtskarten schickt, und oft die Größe von Abteilungen in modernen Konzernen.“9 Die Dunbar-Zahl bestätigt und quantifiziert die Mikroordnung in Hayeks „Zwei-Welten-Theorem“. Unser sozialer Nahraum erstreckt sich über etwa 150 Mitmenschen, mit denen wir emotional eng verbunden sind und entsprechend interagieren. Jenseits davon erstreckt sich der anonyme Großraum. Wir sind gezwungen, permanent zwischen beiden Räumen zu wechseln.
Hayek gelangt durch seine Beobachtungen zu einer eminent wichtigen Schlussfolgerung: Wer diese Räume nicht oder nur unzureichend voneinander zu unterscheiden vermag und versucht, die Regeln des einen im jeweils anderen anzuwenden, wird zerstörerisch in beiden wirken. Dabei besteht eine deutlich größere Neigung, die Regeln der Mikroordnung auf die erweiterte Ordnung zu übertragen, als umgekehrt – denn jeder Mensch wie auch die Menschheit insgesamt kommt von der Mikroordnung her. Darauf sind wir „geeicht“ und eingestellt, im Großraum finden wir uns dagegen viel schwerer zurecht. Hayek illustriert diese Neigung durch eine luzide Analyse der Begriffe „Gesellschaft“ und „sozial“.10 Ein Blick in die aktuellen politischen Diskussionen, wie sie in Tageszeitungen und im Internet geführt werden, offenbart die Größenordnung und die Wirkung der derzeitigen Vermischung von Nah- und Großraum. Permanent wird die große Welt aufs Format der kleinen Welt zurechtgestutzt.
Genau diese mangelnde Unterscheidung (oder auch bewusste Vermischung) ist aber der Grund für die Wirksamkeit des Framings. Moralische Begriffe sind Begriffe der Mikroordnung, der kleinen Gruppe. Neben der „Nächstenliebe“ und der „Barmherzigkeit“ werden „Empathie“, „(Mit-)Menschlichkeit“ und „Zuwendung“ aufgerufen (und das auch noch zu „Leidenden“, „Verfolgten“ oder „Flüchtenden“, wie Migranten fälschlicherweise pauschal bezeichnet werden), und wir springen unwillkürlich, automatisch darauf an: Es ist die Terminologie des sozialen Nahraums, der uns im Blut liegt, von dem wir nie wegkommen, der uns selbstverständlich ist.
Wir tragen sozusagen eine Brille, die selbst globale Phänomene auf den Nahraum herunterbricht. Wir können uns die Zahlen der Menschen nicht plastisch vorstellen, die schon unterwegs sind oder bereits auf gepackten Koffern sitzen. Wir können uns die Komplexität der Abläufe nicht ausmalen, und wir haben keine Ahnung vom Ausmaß der Geschäfte, die im Hintergrund getätigt werden. Der grundlegende menschliche Impuls angesichts solcher Phänomene ist die Einpassung in ein emotionales Narrativ, und dieser Impuls wird durch das Framing aufgenommen und verstärkt. Wir werden beispielsweise ermahnt, nicht „Menschenmassen“ zu sehen, sondern „Einzelschicksale“ – dabei sehen wir von vornherein die Einzelschicksale, weil wir nur diese emotional überhaupt einordnen können: Schicksale wie das von Alan Kurdi oder Reem Sahwil, wie sie uns in den Medien präsentiert werden, oder auch die Schicksale derjenigen, die wir persönlich kennenlernen. Diese Menschen werden für uns zu den „Gesichtern“ der Massenmigration; wir sehen sie und identifizieren sie mit dem Gesamtphänomen, weil wir das Gesamtphänomen gar nicht überblicken können. Und man müsste wirklich ein Unmensch sein, wenn diese Einzelschicksale einen nicht berühren würden. Aber um das Gesamtphänomen der gegenwärtigen Migrationsbewegung beurteilen und Schlussfolgerungen für politisches Handeln daraus ziehen zu können, muss man fähig sein, Distanz zum sozialen Nahraum und damit zu diesen Einzelschicksalen einzunehmen.
„Liebe“ und „Hass“ sind persönliche Gefühle, ihnen kommt bei einer politischen Bewertung keinerlei Bedeutung zu, und ebenso wenig spielen dabei „Nächstenliebe“ und „Barmherzigkeit“ eine Rolle. Man kann kollektivethische Fragen nicht individualethisch beantworten. Politiker müssen zwangsläufig die Perspektive des sozialen Nahraums verlassen und die erweiterte Ordnung in den Blick nehmen. Selbstverständlich leben auch sie in einem sozialen Nahraum, und selbstverständlich ist es ein lobenswertes und vorbildliches Verhalten, wenn sie in diesem Nahraum beispielsweise verfolgten Menschen Zuflucht gewähren. Aber das lässt sich eben nicht kongruent auf die erweiterte Ordnung des Staates übertragen. Hier ist anders zu verfahren als in der Mikroordnung, wenn man denn sein Fortbestehen und Funktionieren gewährleisten will.