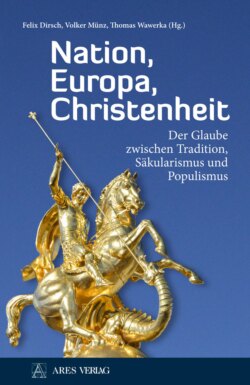Читать книгу Nation, Europa, Christenheit - Группа авторов - Страница 6
1.
ОглавлениеDas europäische Parteigefüge, das sich in den freiheitlichen Staaten der Nachkriegszeit herausgebildet hatte, erwies sich über Dekaden hinweg als stabil. Es bestand weithin aus Christdemokraten und Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen.
Vom großen gesellschaftlichen Umbruch der 1960er-Jahre, als die erste Nachkriegsgeneration in Europa mit Aplomb auf sich aufmerksam machte, blieb auch das politische System nicht unberührt. Dass Hunger und Elend längst verschwunden waren, führte zu einem starken Wandel anvisierter Zielsetzungen in Staat und Gesellschaft. Überall feierten Kräfte mit postindustriell-postdemokratischen Ansichten Erfolge auf politischen Feldern, die lange Zeit als Nischen galten. Die beiden ursprünglich stark konservativen Themenfelder Ökologie und Umwelt wurden zusammen mit anderen Bereichen (wie der Frauen- und der Friedensthematik) überwiegend von Personen der politischen Linken besetzt. Gerade in Deutschland überschritten die „Grünen“ über einen längeren Zeitraum hinweg die Zehnprozentmarge bei Wahlen nur selten. Diese Situation hatte sich bis zum Zerbrechen der rot-grünen Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahre 2005 nur wenig verändert, doch haben sich dann andere Parteien wie die CDU unter dem Vorsitz von Angela Merkel dem einstigen Konkurrenten mehr oder weniger angepasst. Koalitionen von CDU und „Bündnis 90/ Die Grünen“ dürfen als eine Folge dieses Trends gelten. Letztere bewegen sich seit Kurzem in schwindelerregenden demoskopischen Höhen. Der entscheidende Grund dürfte der mediale „Klima-Hype“ sein, der verschiedene Untergangsszenarien am Horizont aufscheinen lässt und zumeist verschweigt, dass die These vom primär menschengemachten Klimawandel in Forschung und Publizistik stark umstritten ist.1
Doch die politische Linke umfasst nicht nur die (in den letzten Jahren deutlich geschwächte) SPD und die Grünen. Vielmehr erstarkte die radikale Linke als PDS nach der Wiedervereinigung Deutschlands vor allem im Osten, konnte aber nach dem Zusammengehen mit der SPD-Abspaltung WASG (Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit e. V.) auch im Westen ein größeres Stimmenreservoir erschließen. Die Partei Die Linke, wie sie sich heute nennt, schrieb sich vornehmlich die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit aufs Panier. Eine solche Ausdifferenzierung des Parteiensystems auf der Linken ist als Institutionalisierung jener „Linksverschiebung“ des politischen Spektrums zu deuten, die der Philosoph Jürgen Habermas in ihren Ansätzen schon in den 1980er-Jahren (als Folge der Umbrüche von „1968“) konstatierte.
Diese Entwicklungen, wie sie hier nur in groben Strichen skizziert werden können, brachten mit sich, dass der in den verfassungsrechtlichen Lehrbüchern großgeschriebene Pluralismus in starkem Maße zu einem höchstens eingeschränkten mutierte. Er war praktisch nur auf der politischen Linken zu erkennen. Ein wesentlicher Grund für eine diesbezügliche Änderung bestand in der Neuausrichtung der CDU. Diese Umpositionierung geschah nicht zuerst aus einer politischen Laune heraus, sondern folgte der Logik eines umfassenden Wertewandels, der mit den Stichworten Individualisierung, Hedonismus, Konsumismus und Säkularisierung oberflächlich zu umschreiben ist. Kritiker fanden kein Gehör.2 Bereits seit den frühen 1960er-Jahren legen Demoskopen entsprechende Befunde vor. Ein solches „Vakuum in der Epoche des unvollendeten Nihilismus“ brachte für Teile der Bevölkerung ein tendenziell geschichtsloses, von Fernsehen und Computerspielen, mithin permissivem Hedonismus im Allgemeinen bestimmtes Alltagsleben3, wie ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens schon vor rund zwei Jahrzehnten diagnostizierte.
Diese grundlegende Richtung hat sich seither kaum geändert, es kam höchstens zu Akzentverschiebungen. Die starken Veränderungen in der Alltagswelt forderten Reaktionen auch in der Politik. Bereits unter führenden Politikern wie Heiner Geißler und Rita Süssmuth beabsichtigte in den 1980er- und 1990er-Jahren ein nicht unbedeutender Teil der CDU-Mitglieder, die Linkswende nachzuvollziehen, vor allem durch einen programmatischen und politisch-praktischen Wandel, den die Medien größtenteils goutierten. Um das Jahr 2000 konkretisierte ihn die neue Vorsitzende Angela Merkel. Machtstrategisch war eine solche Neupositionierung durchaus sinnvoll. Die Union könne – so eine verbreitete Perspektive – auf der Linken mehr gewinnen als auf der – anscheinend immer bedeutungsloser werdenden – Rechten verlieren. Felder, auf denen der Linksruck deutliche Ausmaße annahm, waren unter anderem die Familienpolitik und, lange vor den Entscheidungen von 2015/16, die Ausländerpolitik. Nach der Jahrhundertwende spielten die Themen Gender-Mainstreaming und Bundeswehr-Umbau eine größere Rolle.
Konservative innerhalb der CDU fanden sich immer stärker in einer marginalisierten Rolle oder wurden – wie der hessische Abgeordnete Martin Hohmann – sogar aus Partei und Fraktion gedrängt. Der damit verbundene schleichende Identitäts- und Profilverlust dauert bis heute an und erinnert an das Schicksal der italienischen Democrazia Cristiana. Zeitweise sah es so aus, als würde die Österreichische Volkspartei (ÖVP) den gleichen Weg gehen. Dem Wertewandel und der linken Meinungshegemonie in den Medien ist es zu verdanken, dass sich schon um die Jahrtausendwende immer klarer abzeichnete, was in Umrissen aber schon seit den 1980er-Jahren kaum zu übersehen war: National- und Christkonservative haben ihre Heimat in der CDU verloren. Sie bildeten folglich ein wichtiges Reservoir für eine neue Partei rechts von der CDU, die sich jedoch als Ergebnis bestimmter Ereignisse erst in den 2010er-Jahren konstituieren konnte.
Hing man nicht den verschiedenen Schattierungen der (politisch wie medial) omnipräsenten politischen Linken an, konnte man die Situation im frühen 21. Jahrhundert – im Grunde genommen schon weit früher – nur als unbefriedigend empfinden. Der Umverteilungsstaat, der den Einzelnen entmündigt, und die Nichtwahrnehmung deutscher Interessen, die weithin pauschal als identisch mit den Zielen der EU erklärt wurden, zählten und zählen zu den charakteristischen Auswirkungen linker Dominanz. Die Interessen eines nicht kleinen Teils der Wählerschaft – Experten nannten Zahlen zumeist zwischen zehn und 20 Prozent – fielen praktisch unter den Tisch. Viele dieser Wahlberechtigten gaben ihre Stimme entweder gar nicht ab oder votierten (in eher seltenen Fällen) für rechtsextremistische Splittergruppen. In den 2000er-Jahren wurde häufig über die Abhilfe dieses für einen nicht unbedeutenden Teil der Wählerschaft kaum akzeptablen Zustands nachgedacht. Man war sich im Klaren darüber, dass eine Ausweitung des Spektrums abseits der ausgetretenen Linkspfade, also nach rechts, auf den erbitterten Widerstand des eng verzahnten politisch-medialen Komplexes stoßen würde. Das Establishment und seine Helfer verfügen nämlich neben anderen Druckmitteln auch über die „Faschismuskeule“, die gegen unliebsame Meinungen Andersdenkender jederzeit zur Einschüchterung eingesetzt werden kann.4
Es lohnt sich, Diagnosen der geistig-kulturellen Situation zu lesen, die in der Millenniumsperiode erschienen sind. Schon damals finden sich Forderungen, die heute, unter veränderten politischen Bedingungen, immer noch (oder wieder neu) Gegenstand heftiger Kontroversen sind. Die existenzielle Dimension ist dabei mittlerweile etwas stärker ins Bewusstsein weiterer Bevölkerungskreise gedrungen. Der Philosoph Günter Rohrmoser postulierte damals eine „radikale Mitte“, die seiner Ansicht nach drei in die Zukunft weisende Aufgaben zu erfüllen habe:5 die geistige Rekonstruktion der Nation, die Auseinandersetzung mit dem Projekt der Moderne und eine der Geschichtslage der eigenen Nation angemessene Interpretation des Christentums, das man als „rechtes“ oder „patriotisches“ bezeichnen kann. Die Ignorierung dieser schicksalhaften Themen hängt nicht zuletzt mit dem Vakuum zusammen, das aus den Spätfolgen der Kulturrevolution, aber auch aus dem spezifischen Verlauf der deutschen Geschichte und deren Instrumentalisierung resultiert. Rohrmosers Forderungen, die dieses Vakuum füllen wollen, sind letztlich – wenngleich späte – Antworten auf „1968“.
Die 1968er-Folgen liegen nach wie vor wie Mehltau über unserem Land – und das schon seit rund fünf Jahrzehnten. Jedoch gibt es mittlerweile politische Kräfte, die zumindest die Finger in die Wunden legen. Heilung ist damit allerdings noch nicht zu erreichen. Immerhin sind heute keine flächendeckenden Strategien des Totschweigens mehr möglich. Die soziale Polarisierung hat deutlich zugenommen. Ein Grund liegt nicht nur in der spätestens seit 2017 auch auf Bundesebene veränderten Parteienlandschaft, sondern ebenso in der drastisch veränderten Medienwelt. Insbesondere die Entwicklung der sozialen Netzwerke ist an dieser Stelle anzuführen, die eine aktivere Beteiligung der Internetbenutzer ermöglicht.
Was war 2010 und in den Folgejahren geschehen? Die schon seit Längerem immer wieder geführte Debatte über die Legitimität einer konstitutionellen Rechten wurde weniger theoretisch als praktisch entschieden. Innerhalb weniger Jahre häuften sich Aversionen immer breiterer Schichten der Bevölkerung gegen die mächtigen politischen wie medialen Eliten und deren Entscheidungen. Die Anlässe sind offensichtlich: Die abrupte, bloßen Stimmungen folgende Energiewende nach „Fukushima“, deren immense Schädlichkeit in vielen Veröffentlichungen belegt ist6, die Rechtsbrüche im Rahmen der sogenannten Euro-Rettung7 und die faktische Außerkraftsetzung grundgesetzlicher wie europarechtlicher Regelungen im Kontext der Migrationskrise von 2015/168, die längst noch nicht beendet ist, brachten einen weitreichenden Meinungsumschwung. Es entstand mit der Alternative für Deutschland (AfD) nicht nur eine erfolgreiche politische Kraft rechts von CDU und CSU, sie konnte sich in den letzten Jahren sogar konsolidieren. Wichtigstes Motiv bei der Gründung der neuen Partei 2013 war das verbreitete Unbehagen an dem Bruch der No-Bailout-Klauseln, die in den Europäischen Verträgen eine lockere Geldpolitik verhindern sollten. Die Gefahren, dass eine Neuorientierung der europäischen Geldpolitik vor allem auf Kosten jener Staaten geht, die sich um solide Staatsfinanzen bemühen, waren und sind offenkundig. Wachstum sollte hauptsächlich über Verschuldung funktionieren, so propagierten es vor allem Teile der politischen Linken. Der AfD-Gründungsriege um den Volkswirtschaftsprofessor und zeitweiligen EU-Abgeordneten Bernd Lucke fehlte indessen das Gespür, Parteibasis und -programmatik thematisch zu erweitern. Als prinzipielle Liberale ignorierten diese Parteigründer soziale Themen größtenteils, auch erschien ihnen die Migrationsproblematik zu „rechts“. Folglich kam es in der erst kurzen Geschichte der „Alternative“ zu Neuausrichtungen, die kaum zu vermeiden waren, wollte die Partei nicht wieder in der Versenkung verschwinden. Richtig ist sicherlich, dass der liberale Flügel seit einigen Jahren an Bedeutung verliert. Manche Exponenten dieser Richtung haben die Partei, auch aufgrund des Drucks von außen, wieder verlassen. Ein Beispiel ist der Ökonom Jörn Kruse, der noch als fraktionsloses Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft angehört. In toto zustimmungsfähig ist auch die These, dass es zwischen der Grundausrichtung der AfD im Westen und der im Osten Nuancen an Unterschieden gebe, die jedoch auch nicht überbewertet werden dürfen.
Die Erfolge dieser neuen politischen Gruppierung sind bisher vor allem in den neuen Bundesländern beachtlich: Trotz heftiger Anfeindungen ist die neue Partei seit Herbst 2018 in allen Landesparlamenten vertreten.9 Mag man manches Auftreten von AfD-Politikern auch als unerfreulich empfinden, rein strukturell gesehen ist es ein Erfolg, dass das deutsche Parteiensystem nicht mehr hinkt. Dieses repräsentiert nun auch eine größtenteils demokratische Wählerschaft rechts von CDU und CSU. Es ist sicher nicht falsch, in den entsprechenden Neuformierungen eine Ergänzung des Pluralismus zu sehen, der vorher nicht vollständig entwickelt war. Dieses Urteil ist auch dann richtig, wenn man manchen internen Konflikt bedauert, etwa die am Anfang unvermeidlichen Flügelkämpfe. Die teils ungenügend deutliche Abgrenzung von Extremisten und untragbare Formulierungen Einzelner machen es politischen Gegnern i. Ü. leicht, die AfD ins falsche Licht zu rücken.