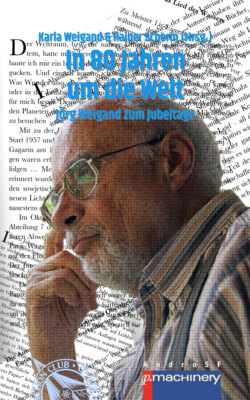Читать книгу IN 80 JAHREN UM DIE WELT - Группа авторов - Страница 19
Monika Niehaus: Die grüne Fee
Оглавление»Sie sprechen wirklich gut Französisch, Monsieur. Und Sie kennen und lieben Paris seit Ihrer Jugend, sagen Sie? Dann geben Sie acht auf ihn, Madame, dass er nicht seine Seele an diese Stadt verliert … Sie beide sind Schriftsteller? Dann werden Sie mich verstehen und auf ein Glas Absinth einladen, während ich Ihnen meine Geschichte erzähle.«
Wir saßen auf der Terrasse eines Cafés am Montmartre und waren mit dem Künstler, der gerade einen Scherenschnitt von meiner Freundin und mir angefertigt hatte, ins Gespräch gekommen.
Da wir nichts Besonderes vorhatten und solche Zufallsbegegnungen oft die interessantesten sind, nickte ich und gab dem Kellner einen Wink.
Unser Gegenüber hob dankend sein Glas – »À votre santé, Madame, Monsieur!« –, zündete sich eine neue Zigarette an und nahm einen tiefen Zug.
»Ich stamme aus einem kleinen Dorf im Elsass und stand kurz vor Abschluss meines Kunststudiums an der École des Beaux-Arts, als ich Môme Bijou zum ersten Mal begegnete…
Die kleine Bar de la Lune in der Rue Lepic, direkt am Fuß des Montmartre, war nur spärlich beleuchtet. Die meisten Tische waren um diese Zeit bereits leer, doch auf der Bank in der Ecke hockte eine beleibte Frau, die meinen Blick auf sich zog. Ihr Alter war schwer zu schätzen, denn ihr Gesicht verschwand unter einer Schicht kalkweißer Schminke, die an die Maske eines Clowns erinnerte. Sie trug einen grünen Samthut und ein Seidenkleid, das in allen Farben, von Grün über Violett bis Rosa, changierte. Und sie war über und über mit Schmuck bedeckt. Eine mehrreihige Perlenkette schlang sich um ihren Hals, zahllose Broschen schmückten ihren ausladenden Busen, und ihre Finger waren so dicht mit Ringen bestückt, dass es klirrte, als sie ihre Hand um ihr Glas schloss. Ihr schweres Moschusparfüm mischte sich mit dem Kneipengeruch von Wein und abgestandenem Bier.
»Wer ist das?«, flüsterte ich dem Wirt zu.
Der warf einen kurzen Blick in die Ecke, während er frisch gespülte Gläser auf der Theke aufreihte. »Môme Bijou nennen wir sie wegen der vielen Klunker, die sie trägt. Behauptet, aus einem russischen Grafengeschlecht zu stammen, aber das sagen sie alle. Ist hier auf dem Montmartre so etwas wie eine Institution.«
Da ich in jenen Sommermonaten auf der Place du Tertre im Akkord Touristenporträts anfertigte, gewöhnte ich mir an, abends regelmäßig in der kleinen Bar einzukehren. Jedes Mal saß Môme Bijou an ihrem Stammplatz, und jedes Mal grüßte ich sie, was sie mit einem würdevollen Nicken quittierte. Dieses besondere Exemplar der nächtlichen Faune montmartroise faszinierte mich, doch jeden Versuch, mit ihr ins Gespräch zu kommen, wies sie kühl zurück.
Bis zu jenem Abend. Gerade hatte ich der Rosenverkäuferin, die ihre nächtliche Runde durch die Bars und Bistros des Viertels machte, aus einer Laune heraus eine Rose abgekauft, als eine Gruppe bereits recht angeheiterter junger Mädchen mit ihren Galanen in unsere Bar einfiel. Kaum hatte der Wirt die Getränke serviert, als eines der Mädchen Môme Bijou entdeckte. Ihre Freundinnen drehten sich um und begannen zu kichern und laut zu tuscheln, und schließlich grölte die ganze Gruppe, und die Männer schlugen sich auf die Schenkel.
Ich warf Môme Bijou einen raschen Blick zu. Ihr Gesicht war völlig unbewegt. Es war unmöglich zu sagen, ob sie das unwürdige Spektakel wahrnahm oder was sie dachte.
Ehe ich recht wusste, was ich tat, stand ich auf und streckte ihr die Rose hin. »Für Sie, Madame!«
Sie machte keine Anstalten, die Rose entgegenzunehmen. »Warum, Monsieur?« Ihre Stimme klang rau, als sei ihre Zunge aus der Übung. »Haben Sie etwa Mitleid mit mir, weil diese bécasses da keine Manieren haben?« Sie machte eine abschätzig obszöne Handbewegung in Richtung der kichernden Mädchen. »Das können Sie sich sparen!«
»Nein, Madame.«
Während sie nach der Rose griff, suchte ich nach Worten. »Sondern weil ich glaube, dass es eine Zeit gab, wo Ihnen viele Männer Rosen geschenkt haben.«
Ihr Lachen kam stoßweise und grub tiefe Schluchten in ihre Schminke. »Sie haben recht, aber das war in einem anderen Leben.« Sie drehte die Rose einen Augenblick in ihren Händen und schien dann einen Entschluss zu fassen. »Kommen Sie, junger Mann. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.« Mühsam erhob sie sich. »Ich wohne in der Rue des Abbesses, gleich hier um die Ecke.« Wir traten auf die Straße.
»Fünfter Stock. Kein Aufzug.«
Ihre Geschmeide klirrten bei jeder Stufe, die sie nahm. Oben angekommen, blieb sie schwer atmend stehen. Ihr Atem ging pfeifend. Sie schloss die Tür auf und winkte mir, ihr zu folgen.
Drinnen roch es nach Moschus und Staub. Der hohe, kaum möblierte Raum wurde vom Widerschein der Stadt in unstetes Licht getaucht. Ich trat an das hohe Fenster, das auf einen schmalen, kaum stuhlbreiten Balkon führte, wie man ihn in vielen Stadthäusern aus der Zeit von Haussmann findet. Das nächtliche Paris lag mir zu Füßen, strahlend, funkelnd, ständig in Bewegung. Die Stadt der Lichter …
Ich drehte mich um. »Was für eine fantastische Aussicht!«
Sie ließ sich schwer auf einen Stuhl neben einem kleinen Tisch am Fenster fallen. »Genießen Sie sie! Ich bin so gut wie blind.« Ihr Gesicht war ein bleiches Oval in der Dunkelheit. »Aber das ist es nicht, was ich Ihnen zeigen wollte. Zünden Sie die Petroleumlampe an. Der Strom ist abgeschaltet.«
Die Lampe in der Hand trat ich näher. Die fast mannshohe Leinwand, auf die sie wies, war ungerahmt. Ein Ölbild, die Farbe aber so leicht und spielerisch aufgetragen, als sei es ein Aquarell. Die Strichführung war kühn, bisweilen fast grob, die ganze Komposition von täuschender Einfachheit. Sie zeigte eine burschikose junge Frau im Halbprofil, den Kopf ein wenig zurückgeworfen. Ihre dunklen Augen bildeten einen Kontrast zu ihrem fuchsroten, kurz geschnittenen Haar, das ihren Kopf wie ein Helm umschloss, und um ihren Mund spielte ein mokantes Lächeln. Sie trug einen smaragdgrünen Frack, der sich im Grün des Absinthglases widerspiegelte, mit dem sie dem Betrachter zuzuprosten schien.
Selbst im schalen Licht der Petroleumlampe schien das Bild geradezu unheimlich lebendig.
Ich beugte mich nieder. ›1914‹. Es war nicht signiert, aber über den Künstler bestand kein Zweifel.
Ich wandte mich um. »Sie, Madame?«
»Hab’ mich ziemlich verändert, nicht wahr?« Über ihr Gesicht huschte ein halb spöttisches, halb trauriges Lächeln. Ihre Augen waren das Einzige, dem die Verwüstung der Zeit nichts hatte anhaben können. »Sie werden es kaum glauben, Monsieur, aber damals bin ich in den Folies Bergère aufgetreten, habe ganz nett gesungen, hatte Scharen von Verehrern und habe vielen Künstlern Modell gestanden.«
Die Erinnerung ließ ihr Gesicht leuchten, und für einen Augenblick meinte ich in der alten, grotesk aufgetakelten Frau das Mädchen zu sehen, das der Maler damals porträtiert hatte.
»Er hat kaum eine Woche daran gearbeitet. Wir waren ein Paar damals, und Pablo war schrecklich eifersüchtig. Nach ein paar turbulenten Tagen und Nächten bekamen wir Streit, und er stürmte wutentbrannt aus der Wohnung. Das Bild hat er nie abgeholt …« Sie strich sich über die Augen. »Meine ›grüne Fee‹ nannte er mich damals. So sollte auch das Bild heißen …«
»Es ist fantastisch!«
»Ich schenke es Ihnen!« Sie machte eine gleichgültige Handbewegung. »Ich kann es sowieso nicht mehr sehen. Und die Menschen, die ich einmal geliebt habe – und ich habe viele geliebt, Monsieur –, sind längst tot. Nehmen Sie es mit!«
Einen Moment lang verschlug es mir die Sprache. »Das ist völlig unmöglich, Madame!«, protestierte ich schließlich. »Ein solches Geschenk kann ich unmöglich annehmen. Aber wenn Sie mir erlauben, würde ich gern wiederkommen, um das Bild zu fotografieren und mit Ihnen darüber zu reden …«
»Wie Sie wollen.« Ihre Stimme klang plötzlich flach und erschöpft. »Genug für heute. Gehen Sie jetzt, junger Mann, ich bin müde. Auf dem Balkon muss noch eine Flasche stehen. Schenken Sie mir ein Glas Wein ein und löschen Sie die Lampe. Ich brauche kein Licht.«
Ihre Silhouette mit dem ausladenden Hut hob sich wie ein Scherenschnitt gegen das Fenster ab, als ich die Tür hinter mir schloss. Während ich die Stufen hinunterstieg, hörte ich, wie eine schartige Schallplatte La Vie en Rose zu spielen begann …«
Unser Gegenüber sog an seiner Zigarette und schwieg. Es war, als höre er die Melodie in Gedanken noch immer. Als die Glut seine Finger erreichte, kam er mit einem unterdrückten »Zut!« in die Gegenwart zurück.
»Und dann passierte es. Direkt vor ihrer Haustür wurde ich von einem Wagen angefahren und lag drei Wochen im Hospital. Als ich schließlich entlassen wurde, führte mich mein erster Weg zu jenem Haus in der Rue des Abbesses. Aber die Wohnung war leer. Im Bistro erfuhr ich, dass Môme Bijou ein paar Tage nach jener Nacht gestorben war. Da sie keine Angehörigen besaß, hatte der Vermieter ihre Wohnung einfach geräumt und ihre wenigen Habseligkeiten auf die Straße gestellt.«
Er beugte sich vor und packte die Hand meiner Freundin. »Verstehen Sie, Madame? Vielleicht ist es mit all ihren anderen Sachen auf den Müll gewandert, vielleicht ist es aber auch von einem Passanten mitgenommen oder von einem Trödler aufgekauft worden. Solange noch die geringste Chance besteht, das Bild zu finden, darf ich nicht aufgeben!«
Sie entzog ihm vorsichtig ihre Hand. »Wie lange ….?«
»Ich war noch ein junger Mann damals, und heute sind meine Haare grau, aber die Zeit spielt in der Stadt der Lichter keine Rolle.« Er erhob sich. »Danke für den Aperitif. Vielleicht bringt mir die grüne Fee ja heute Glück … Madame, Monsieur!« Eine kleine, altmodische Verbeugung, und er verschwand in der Menge.
Wir haben unseren Gast nie wiedergesehen und auch nicht von einem berühmten wiedergefundenen Gemälde gehört. Aber sein Scherenschnitt schmückte unsere Hochzeitskarte, intimer und persönlicher als jedes Foto.