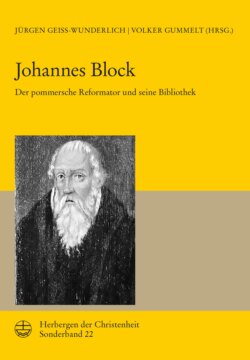Читать книгу Johannes Block - Группа авторов - Страница 10
Die Digitalisierung der Barther Bibliothek des Johannes Block in der Universitätsbibliothek Greifswald Von Bruno Blüggel
ОглавлениеDie Universitätsbibliothek Greifswald verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung in der Planung und Ausführung digitaler Projekte. Zunächst wurden nur eigene Bestände digitalisiert. Aber durch die Teilnahme am EU-Projekt »Ebooks on Demand« (EoD) wurden auch schon sehr schnell Kontakte zu internationalen Expertenteams geschaffen. Diese enge Vernetzung bedeutet nicht nur einen ständigen Erfahrungsaustausch, sie führt auch zu großen Synergieeffekten bei allen Folgeprojekten.
Mit dem Start der Deutschen »Digitalen Bibliothek« (DDB) und der »Europeana« wurde immer offensichtlicher, dass die Datenlieferung zu diesen großen Erschließungs- und Digitalisierungsportalen am sinnvollsten durch erfahrene Aggregatoren erfolgen sollte. Aus diesem Grund unterstützte das Land Mecklenburg-Vorpommern zwei Pilotprojekte zur Integration digitaler Objekte aus verschiedenen Einrichtungen im Land (Archive, Bibliotheken, Museen, wissenschaftliche Sammlungen).
I Pilotprojekte
In den Jahren 2010 und 2011 förderte das Land Mecklenburg-Vorpommern Digitalisierungsprojekte mit jeweils 90.000 Euro. Davon wurde 2010 ein Pilotprojekt zur Integration von Archivmetadaten mit 48.642 Euro und 2011 die Integration von musealen Metadaten mit 38.647 Euro unterstützt.
Mit diesen Pilotprojekten wurden mehrere Ziele verfolgt:
• Es sollten Objekte verschiedener Einrichtungen im Land auf einer gemeinsamen Internetplattform präsentiert werden.
• Es sollten möglichst keine neuen Daten erhoben werden, sondern schon vorhandene Beschreibungen aus den lokalen Systemen über normierte Schnittstellen importiert werden.
• Vor allem kleine Einrichtungen, die über keine eigene Digitalisierungsausstattung verfügen, sollten einbezogen werden.
• Durch die Digitalisierung sollten einerseits die wertvollen Originale geschont werden, andererseits der Bekanntheitsgrad einmaliger Sammlungen durch die Einbindung in ein gemeinsames Portal erhöht werden.
• Da die beteiligten Einrichtungen über die beste Kenntnis über ihre Sammlungen verfügten, lag die Auswahl geeigneter Objekte und die Bearbeitung der Metadaten in ihrer Verantwortung.
Die Bibliothek der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Barth erfüllte mehrere dieser Kriterien, die Teilnahme am Pilotprojekt führt aber auch in die jüngere Vergangenheit zurück. Zwischen der Gemeinde St. Marien und der Universitätsbibliothek Greifswald besteht schon ein längerer Kontakt. Die damalige Sorge um die wertvolle Bibliothek, die unzureichende Unterbringung in den feuchten und unzureichend gesicherten Räumen war groß. Selbst für einfachste konservatorische Aufgaben fehlten die Mittel, eine Renovierung der Räume oder gar eine Restaurierung der Bücher schien utopisch. Die Erschließung der Bestände war (und ist noch immer) mangelhaft und behinderte den Zugang zu dieser wertvollen Bibliothek – gleichzeitig scheute man sich aber auch vor zu großer Publizität, um die ungesicherte Bibliothek vor Diebstahl zu schützen.
Mit der Renovierung der Bibliotheksräume 2010-20131 änderte sich die Situation schlagartig. Für die Bestände steht nun ein sicherer und allen konservatorischen Anforderungen genügender Raum zur Verfügung. Während der Bauarbeiten waren die Bestände ausgelagert, daher konnte ein Großteil der 123 Bände der Bibliothek des Johannes Block über einen längeren Zeitraum zum Scannen in das Digitalisierungszentrum an der Universitätsbibliothek Greifswald gebracht werden. Daneben wurde selbstverständlich auch das prominenteste Buch der Bibliothek, die sog. »Barther Bibel«, digitalisiert, da dieses Werk eine hohe identifikationsstiftende Bedeutung hat. Trotzdem war die Bibliothek Block aus vielerlei Gründen für die Teilnahme an dem Pilotprojekt fast noch bedeutender:
Zunächst sprach der hohe wissenschaftliche Wert dieser einzigen fast vollständigen Bibliothek eines Reformators im Ostseeraum für sich. Anhand der Zusammensetzung dieser Sammlung, den Glossen und Besitzvermerken kann der Werdegang eines katholischen Predigers zum frühen Verbreiter der Reformation rekonstruiert werden.2 Durch die Digitalisierung konnte diese wichtige historische Quelle erstmals einem größeren Forscherkreis bekannt und nutzbar gemacht werden.
Aus technischer und organisatorischer Sicht stellten die von Jürgen Geiß gut dokumentierten Bücher3 ein überschaubares Paket für die Aufnahme in ein Pilotprojekt dar. Die Möglichkeit zur Kooperation einer Kirchenbibliothek ohne technische Ressourcen mit einem technisch gut ausgestatteten Digitalisierungszentrum sollte modellhaft getestet und geeignete Workflows sollten aufgebaut werden. Aus den Mitteln des Pilotprojekts 2 stellte das Land 3.000 Euro für das Scannen der Bücher zur Verfügung, die Eingabe der Metadaten erfolgte in Eigenleistung.
II Erfahrungen aus dem Pilotprojekt
Die nicht restaurierten Bände waren teilweise in einem schlechten Zustand und konnten daher nur sehr langsam und unter großer Sorgfalt gescannt werden. Bei einigen Exemplaren musste aus konservatorischen Gründen ganz darauf verzichtet werden. Zudem sind die Bestände der Bibliothek St. Marien in Barth noch nicht maschinenlesbar katalogisiert. Es existieren zwar einzelne Bestandslisten, eine Recherche über die Bestände ist für externe Nutzer jedoch nicht möglich. Daher war die Katalogisierung der unerschlossenen Werke äußerst schwierig und zeitaufwendiger als das Scannen selbst. Das Verhältnis des Zeitaufwandes Scannen/ Metadateneingabe betrug 1:4.
Trotzdem hatte die Aufnahme der Digitalisate in den OPAC der Universitätsbibliothek Greifswald und den Verbundkatalog des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) Vorteile für die Bibliothek in Barth selbst, verweist doch der Katalogeintrag des digitalisierten Werkes auch auf den Standort des Originals. Die Digitalisate der Bibliothek Block sind somit die ersten Werke der Bibliothek St. Marien, die in einem überregionalen Katalog verzeichnet sind.
Nach der Katalogisierung wurden die Bände auf speziellen Buchscannern durch geschultes Fachpersonal im Digitalisierungszentrum der Universitätsbibliothek Greifswald gescannt; die hierbei entstandenen Originaldateien im TIFF-Format eignen sich für die Langzeitarchivierung. Aus den Originalscans wurden komprimierte, für die Internetpräsentation geeignete Dateien erzeugt und mit Metadaten versehen. Nach einer Synchronisierung der Imagebezeichnungen mit den Seitenzahlen des Originals erfolgte eine Einteilung und Erfassung der Strukturdaten des Werkes (z. B. Titelblatt, Inhaltsverzeichnisse, Abbildungen, Kapitel).
Wegen der großen Bedeutung der Sammlung wurde eine besonders tiefe strukturelle Erschließung vorgenommen. Durch die Eingabe von Metadaten werden eine gezielte Suche nach den einzelnen Kapiteln und eine Navigierung im Buch ermöglicht. Sowohl die jeweiligen Strukturtypen (z. B. Kapitel) als auch das gesamte Werk können als PDF-Dateien von den Nutzern der Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern heruntergeladen werden (Abb. 1).
Personennamen und besondere Schlagwörter wurden im Projekt mit der »Gemeinsamen Normdatei« (GND) der Deutschen Nationalbibliothek verknüpft. Auf diese Weise werden die verschiedenen Namensformen disambiguiert, auch wenn diese bei der Katalogisierung nicht mit eingegeben wurden. Außerdem können Beziehungen zu anderen Personen (z. B. Angehörige, Korrespondenzpartner) abgebildet und eine weitere Suche nach der erwähnten Person in der »Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern« gestartet werden (Abb. 2).
Durch diese sehr aufwändige Erschließung ergeben sich insgesamt drei Sucheinstiege für die im Digitalisierungsprojekt erschlossene Bibliothek des Barther Reformators Johannes Block:
1. Der OPAC des Gemeinsamen Verbundkatalogs (GVK).4
2. Der OPAC der Universitätsbibliothek Greifswald.5
3. Die Digitale Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern, Sammlung »Bibliothek des Reformators Johannes Block«.6
Durch die Implementierung einer neuen Viewer-Version haben sich seit dem Herbst 2016 die Darstellungsmöglichkeiten für die Sammlungen der einzelnen Einrichtungen verbessert. Die Partner können sich nun über individualisierte Seiten vorstellen und eigene Einstiege zu besonderen Sammlungen, z. B. der Bibliothek Block, erstellen und auf diese direkt von ihren eigenen Internetauftritten verlinken.
Die Teilnahme der Kirchenbibliothek St. Marien in Barth am Greifswalder Digitalisierungsprojekt war in vielerlei Hinsicht erfolgreich: Zunächst wurde die Möglichkeit einer Kooperation einer Universitätsbibliothek mit einer kirchlichen Einrichtung zur Digitalisierung und Erschließung einer wichtigen landesgeschichtlichen Sammlung erfolgreich getestet. Vor allem wurden aber die technischen und organisatorischen Wege evaluiert, um mit der Sicherung und Erschließung der Bibliothek der Gemeinde St. Marien auch in anderen Bereichen als der Block-Bibliothek fortzufahren. Neben einer schrittweisen Restaurierung der wichtigen Originale muss eine Erschließung der Titel in einem überregionalen Katalog (in unserem Falle im GBV) erfolgen. Diese Erschließung würde nicht nur eine wichtige Bibliothek einem größeren Forscherkreis bekannt machen, sondern würde auch die Grundlage für weitere Digitalisierungsprojekte schaffen.
III Ausblick
Mit den Pilotprojekten wurde an vielen Stellen Neuland betreten und auch nach Abschluss der Projekte ist die technische und organisatorische Entwicklung zwischenzeitlich weiter fortgeschritten. Die mit der »Gemeinsamen Normdatei« (GND) begonnene Verknüpfung mit externen Daten im WWW verbreitet sich rasch und kann für die Recherche und Darstellung im Internet genutzt werden. Die Verlinkung von Personen mit geographischen Daten führt zu völlig neuen visuellen Darstellungsmöglichkeiten; der Lebensweg einer Person und ihrer vielfältigen Kontakte kann durch interaktive Graphiken nachvollzogen werden. Die dazu notwendigen Informationen werden sich durch neue Forschungserkenntnisse ständig erweitern. Die Universitätsbibliothek Greifswald und ihre Kooperationspartner in der Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern tragen diesen Entwicklungen bereits heute Rechnung.
Durch die Implementierung einer neuen Viewer-Version haben sich bereits die Darstellungsmöglichkeiten für die Sammlungen der verschiedenen Einrichtungen verbessert:
• Die Anpassung an internationale Standards der Bildanzeige (International Image Interoperability Framework – IIIF) führte zu einer deutlich verbesserten Anzeige der Images, dies wird die Arbeit an der Glossierung in den Texten bedeutend erleichtern.
• Eine individualisierte Anmeldung für Nutzer bietet eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten für wissenschaftliche Nutzer.
• Es können eigene »Bibliotheken« sowohl für die individuelle Nutzung als auch für eine gemeinschaftliche Arbeit in Seminaren zusammengestellt werden.
• Mit Hilfe eines Crowdsourcing-Tools können Kommentare oder Transkribierungen zu einzelnen Glossen auf den Seiten oder Links zu anderen Texten (Sekundärliteratur oder anderen Primärquellen) positioniert werden.
• Die Partner können sich nun über individualisierte Seiten präsentieren und eigene Einstiege zu besonderen Sammlungen, z. B. der Bibliothek Block, erstellen und auf diese direkt von ihren eigenen Internetauftritten verlinken.
Diese technischen Möglichkeiten werden die Eigenschaft der Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern grundlegend verändern. Sie wandelt sich von einer reinen Präsentationsoberfläche zu einem Instrument für aktive wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Bruno Blüggel
Abb. 1: Präsentation von Strukturdaten für den Download von PDF-Dateien
Die Digitalisierung der Barther Bibliothek des Johannes Block in der Universität Greifswald
Abb. 2: Vernetzte Personensuche über GND-Normsätze
1 Christine JOHANNSEN: Sanierung und Umgestaltung der Bibliothek der St. Marien Kirche in Barth. In: Bibliotheken bauen: die Barther Kirchenbibliothek im Kontext/ hrsg. von Jochen Bepler; Ulrike Volkhardt (Barther Bibliotheksgespräche; 1), 67-74.
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Block.
3 Jürgen GEISS: Die Bücher des Johann Block von Stolp (um 1470/80-1545): Untersuchungen zu einer frühreformatorischen Predigerbibliothek im Ostseeraum. Hausarbeit FH Köln 2001.
5 https://lhgrw.gbv.de/DB=1/LNG=DU/.
6 http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/browse/DC:bibliotheken.400kbbarth.100block/-/1/-/-/.