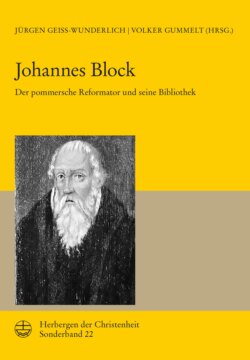Читать книгу Johannes Block - Группа авторов - Страница 11
Baustellen der Forschung Erschließung von Kirchenbibliotheken in Vorpommern, Mecklenburg und Nordthüringen Von Thomas Wilhelmi
ОглавлениеI Vorpommern und Mecklenburg
Die Bibliothek der St. Marienkirche in Barth (in Pommern) gehört zu den größten und bedeutendsten Kirchenbibliotheken in Norddeutschland und gehört auch im gesamtdeutschen Vergleich zu den wichtigen Bibliotheken dieser Art. Sie stand an der Tagung im Herbst 2015 in Barth natürlich im Zentrum des Interesses. Der beachtliche Grundstock dieser Bibliothek wurde von Johannes Block zu Beginn des 16. Jahrhunderts aufgebaut. Block war zu dieser Zeit Kleriker im Bistum Kammin. 1533 gelangte Block als evangelischer Prediger an die St. Marienkirche in Barth. Die Barther Kirchenbibliothek umfasst 118 Inkunabeln (allesamt in lateinischer Sprache) und einige Fragmente, 444 Drucke aus dem 16. Jahrhundert (davon 310 in lateinischer, 114 in hochdeutscher und 15 in niederdeutscher Sprache), 228 aus dem 17. Jahrhundert, 746 aus dem 18. Jahrhundert und 833 aus dem 19. Jahrhundert. Hinzu kommen neun Bände mit spätmittelalterlichen Handschriften. Nähere Angaben zu dieser Kirchenbibliothek, die in den letzten Jahren verdienstvollerweise sicher gelagert, restauriert und auch näher erschlossen worden ist (die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen) finden sich in den Beiträgen von Jürgen Geiß,1 Falk Eisermann,2 Gerd Albrecht,3 Christian Heitzmann4 und Christine Johannsen.5 Eine vorläufige, teilweise überholte Beschreibung der Bibliothek, 1995 von Konrad von Rabenau angefertigt, ist im Handbuch der historischen Buchbestände zu finden.6
Die handschriftlichen Kataloge aus den Jahren 1666 und 1795 sind 1882 durch einen gedruckten Katalog ersetzt worden.7 Zudem gibt es einen ungenauen Katalog der Inkunabeln8, die im übrigen bereits um 1910 dem »Gesamtkatalog der Wiegendrucke« gemeldet worden waren. Die Buchbestände der Barther Kirchenbibliothek sind für den Kirchlichen Zentralkatalog9 nicht erfasst worden.
In Mecklenburg und Vorpommern gibt es außer der Kirchenbibliothek in Barth als weitere große Kirchenbibliothek mit bedeutenden Altbeständen die Bibliothek des Geistlichen Ministeriums in Greifswald mit 335 Inkunabeln (und elf Fragmenten),10 etwa 1212 Drucken aus dem 16. Jahrhundert, 1414 aus dem 17. Jahrhundert und 205 aus dem 18. und 19. Jahrhundert11 sowie einem exquisiten Bestand spätmittelalterlicher Handschriften.12 Die Bibliotheken der drei Stadtkirchen in Stralsund, die als Deposita im Stadtarchiv Stralsund aufbewahrt werden,13 enthalten Drucke aus dem 15. bis 19. Jahrhundert, darunter etwa 80 Inkunabeln. Zudem gibt es etliche weitere, zumeist kleine Kirchenbibliotheken mit Altbeständen (ab dem 16. Jahrhundert). Vier davon werden als Deposita in der St. Marien-Bibliothek in Barth aufbewahrt:14 die Kirchenbibliothek von Flemendorf mit sieben Drucken aus dem 16. Jahrhundert, 211 aus dem 17. Jahrhundert, 693 aus dem 18. Jahrhundert und 26 aus dem 19. Jahrhundert, die Kirchenbibliothek von Kenz mit neun Drucken aus dem 16. Jahrhundert, elf aus dem 17. Jahrhundert, 59 aus dem 18. Jahrhundert und 44 aus dem 19. Jahrhundert und die Kirchenbibliothek von Saal mit 6 Drucken aus dem 16. Jahrhundert, 84 aus dem 17. Jahrhundert, 107 aus dem 18. Jahrhundert und 113 aus dem 19. Jahrhundert sowie die Kirchenbibliothek von Bodstedt mit 62 Drucken, die alle aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen.15
In dem 2003 erschienenen Inkunabelkatalog von Nilüfer Krüger16 sind neben den 688 Inkunabeln im Bestand der Universitätsbibliothek Rostock und den 47 im Bestand der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin auch die 36 Inkunabeln der Kirchenbibliothek in Friedland (Land Stargard)17 erfasst worden. Die Forschungen zur Landesgeschichte Mecklenburgs und die buchgeschichtlichen Forschungen sind mit diesem Verzeichnis wesentlich vorangetrieben und weitergebracht worden. Die Bestände waren zuvor nur unzulänglich katalogisiert. Die zumeist erhaltenen originalen Einbände sind genau beschrieben, die Buchbinder identifiziert. Zum Teil hätte allerdings die Benutzung des reichen Materials (Stempelabreibungen, auch aus Greifswald) von Konrad von Rabenau und der damals neu eingerichteten Einbanddatenbank noch zu weiteren Erkenntnissen führen können. Die Beschreibungen der einzelnen Inkunabeln orientieren sich in ihrer Art am Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB-Ink), weichen also von denjenigen des Greifswalder Katalogs (und anderer derartiger Kataloge) etwas ab. In den im Katalog von Krüger beschriebenen Beständen finden sich etliche seltene Drucke; hervorzuheben sind Lübecker Drucke in niederdeutscher Sprache.
Die verschiedenen Streubestände – insgesamt um die 210 Inkunabeln – sind in diesem Katalog nicht erfasst worden, davon die erwähnten 98 Bände (mit etwa 120 Titeln) in Barth und die 80 in Stralsund, die etwa 15 zumeist sehr seltenen im Landeshauptarchiv in Schwerin,18 drei oder vier in der Ratsbibliothek in Wismar (Depositum im Stadtarchiv),19 eine Inkunabel im Städtischen Museum in Güstrow20 und eine im Staatlichen Museum in Schwerin.21 Ebenfalls nicht erfasst sind die sehr kleinen Inkunabelbestände mancher Kirchenbibliotheken: sechs Inkunabeln in der Kirchenbibliothek in Altentreptow,22 eine Inkunabel in der Diözesanbibliothek in Parchim (Depositum in der Landessuperintendentur, eingelagert im Nikolaikirchturm in Rostock), eine in der Kirchenbibliothek in Gingst und eine in der Kirchenbibliothek Velgast.23 Diese kleinen und zum Teil hochinteressanten Streubestände in Mecklenburg und Vorpommern sollten unbedingt genauer erfasst werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass da und dort weitere Inkunabeln zum Vorschein kommen könnten. Im Übrigen befinden sich in all den genannten Bibliotheken selbstverständlich auch Drucke aus den darauffolgenden Jahrhunderten, die ebenfalls alle noch erfasst werden müssten.
Nicht über Inkunabeln, wohl aber über Drucke aus dem 16. Jahrhundert (und den darauffolgenden Jahrhunderten) verfügen drei Kirchenbibliotheken auf Rügen, die 1955/56 von Gottfried Holtz24 recht genau beschrieben worden sind: die Kirchenbibliothek in Lancken,25 die Kirchenbibliothek in Wiek und die Kirchenbibliothek in Sagard. Auch die folgenden Bibliotheken verfügen über Altbestände (ab dem 16. Jahrhundert): die landeskirchliche Bibliothek in Greifswald,26 die Kirchenbibliothek in Loitz,27 die Diözesanbibliothek in Ludwigslust,28 die Diözesanbibliothek in Malchin,29 die Bibliothek des Oberkirchenrates in Schwerin (mit der Bibliothek von St. Marien in Neubrandenburg und neun weiteren Kirchenbibliotheken als Deposita),30 die Diözesanbibliothek in Wismar31 und die Bibliothek von St. Petri in Wolgast.32 Kirchenbibliotheken mit Altbeständen gibt es auch in Bergen (mit Deposita aus Bobbin und Neuenkirchen), Demmin, Grimmen, Gützkow, Kröslin, Züssow,33 aber auch in Blücher, Bad Doberan, Dargun, Hagenow, Jördensdorf, Kirch Mulsow, Polchow, Recknitz, Teschendorf und vermutlich an vielen weiteren Orten.34
Etliche Übersichtsinformationen über die Kirchenbibliotheken in Vorpommern und Mecklenburg finden sich in der von Konrad von Rabenau verfassten Einleitung zum 16. Band des Handbuches der historischen Buchbestände35 und zu den Kirchenbibliotheken in Mecklenburg in der um 1975 erstellten Übersicht von Kirchenarchivrat Erhard Piersig.36 Weitere Auskunft geben die verschiedenen Akten der Kirchengemeinden und Superintendenturen.37 Im Übrigen gibt es ein vor nicht langem in Gang gekommenes Projekt »Historische Kirchenbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern«.38 Im nichtkirchlichen Bereich sind es das Stadtarchiv Greifswald,39 das Landesarchiv in Greifswald (mit Teilen der Stadtbibliothek Anklam als Depositum),40 die Regionalbibliothek in Neubrandenburg,41 das Archiv der Hansestadt Rostock,42 die Bibliothek des Müritz-Museums (Maltzaneum) in Waren43 und die Bibliothek des Gymnasiums in Waren,44 die auch alte Buchbestände in ihren Regalen haben.
So gut wie alle der zahlreichen hier aufgeführten Bibliotheken sind noch nicht näher erschlossen. Die Erfassung zumindest der älteren Bestände im Gemeinsamen Verbundkatalog GVK/GBV (und im VD 16, VD 17) wäre wünschenswert, dann aber auch die Untersuchung der Einbände (Einbanddatenbank) und der Provenienzen sowie die Erfassung (und nötigenfalls auch Sicherung) der ohne Zweifel vorhandenen weiteren Streubestände. Große Desiderate!
II Kirchenbibliotheken in Nordthüringen
1 Pfarrbibliothek St. Blasii-/Himmelgarten Nordhausen
Die historische Pfarrbibliothek St. Blasii-/Himmelgarten der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-Altendorf in Nordhausen umfasst etwa 850 Drucke in 374 Bänden, gut vier Fünftel davon in lateinischer Sprache. Fast 470 Drucke gehören dem Bereich der Theologie an. 245 Bände sind nachgewiesene Inkunabeln45, über 400 stammen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, knapp vierzig aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 39 aus dem 17. Jahrhundert und nur 17 aus dem 18. Jahrhundert. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der weitere Bucherwerb für diesen Bestand eingestellt und eine zweite Pfarrbibliothek aufgebaut. Hinzu kommen vier Bände mit Abschriften publizierter Werke aus den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. Zur Geschichte der Bibliothek gibt zuerst Johann Heinrich Kindervater46 Auskunft, 1883 Richard Rackwitz47 und 1972 und 1992 ausführlich Hannelore Götting48 und schließlich das »Handbuch der historischen Buchbestände«.49 Der weitaus größte Teil der St. Blasii-/Himmelgarten-Bibliothek entstammt dem neben Nordhausen gelegenen, 1295 gegründeten Servitenkloster Himmelgarten. Aufgebaut wurde sie dort maßgeblich durch den Prior Johannes Pilearius (Huter). 1525 wurde das Kloster im Zuge der Einführung der Reformation und des Bauernkrieges aufgelöst bzw. weitgehend zerstört. Die Bibliothek wurde aber zuvor in ein dem Orden gehörendes Haus in Nordhausen gebracht. 1552 gelangte die Bibliothek in den Besitz der St. Blasii-Kirchengemeinde und wurde seither als Pfarrbibliothek ausgebaut. 1879 fand sie der Realschullehrer Richard Rackwitz unter schlechten Bedingungen in der Sakristei der St. Blasii-Kirche vor; etliche Bände wurden daraufhin auf seine Veranlassung hin restauriert, wobei allerdings die alten Einbände (mit Provenienzvermerken und Pergamentmakulaturen) verlorengingen. Von 1941/1942 bis 1945 war die Bibliothek in einem Bergwerkstollen im Umland ausgelagert; 1945 wurde sie wieder nach Nordhausen verbracht. 1974 wurde der Großteil der Bibliothek aus konservatorischen Gründen in die Bibliothek des Katechetischen Oberseminars in Naumburg verbracht, von dort 1987/1989 in die Bibliothek des Evangelischen Predigerseminars in Wittenberg. Ab 2011 wurde die Rückführung des Wittenberger Bestandsteils an einen optimalen Standort in Nordhausen angestrebt. 2012/2013 fand eine Schadensanalyse statt, 2014/2015 eine konservatorische Grundreinigung des Gesamtbestandes und 2015 die Rückführung des Wittenberger Teilbestandes mit 356 Bänden nach Nordhausen. Die gesamte Bibliothek befindet sich jetzt als Depositum der Eigentümerin in einem aktiv klimatisierten Sonderausstellungsraum im Stadtmuseum Flohburg. Die Bibliothek wird als Best. 12.8. vom Stadtarchiv Nordhausen betreut und ist komplett benutzbar.
Immer noch unentbehrlich ist der 1883 von Richard Rackwitz veröffentlichte Katalog,50 mit dem der unvollständige Katalog von Johann Heinrich Kindervater aus dem Jahre 171751 ersetzt werden konnte. Eine umfassende Katalogisierung in Karteikartenform und namentlich die Identifizierung der Inkunabeln nahm Hannelore Götting Anfang der 1970er Jahre vor, deren Titelaufnahmen auch in den Kirchlichen Zentralkatalog52 eingingen. Im OPAC der Evangelischen Predigerseminarbibliothek Wittenberg sind derzeit die weitaus meisten Titel erfasst, eine Titelliste auf auch der Webseite der Eigentümerin. Nahezu alle Titel wurden 2009 bis 2014 in einer ehrenamtlich von Hans Losche erstellten lokalen MS-Access-Datenbank verifiziert bzw. neu erfasst, zum größeren Teil auch mit bibliographischen Nachweisen (GW, VD16 u. a.). Diese Datenbank wurde 2015 umstrukturiert und soll weitergeführt werden. Ihr Datenbestand wird auch mit dem OPAC in Wittenberg abgeglichen. In Form eines Drittmittelprojektes sollen 2017 noch exakte Exemplarbeschreibungen (Einbände, Einbandmakulaturen, handschriftliche Anmerkungen, Eigentümervermerke, Provenienzen etc.) hinzukommen. Zudem sollen die Titel ab 1501 auch im Gemeinsamen Verbundkatalog GVK/GBV nachgewiesen werden. Ein bebilderter Katalog mit Bestandsgeschichte ist geplant.53
2 Kirchenbibliotheken im Bereich der Superintendentur Bad Frankenhausen-Sondershausen
Im Rahmen eines kleinen, von der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung geförderten Forschungsprojekts werden 2017 die Bestände der Kirchenbibliotheken im Bereich der Superintendentur Bad Frankenhausen-Sondershausen erfasst und erschlossen. Damit wird auch ein Beitrag zu deren Sicherung geleistet.
Im Bereich dieser Superintendentur gab oder gibt es etwa sechzig Kirchenbibliotheken. Die größte dieser Bibliotheken ist diejenige in der St. Trinitatis-Kirche in Sondershausen.54 Weil diese Bibliothek – sie enthält die Bestände der Kirchenbibliothek und der Ephoralbibliothek – bereits gut erschlossen55 und gesichert ist, wird diese im Erschließungsprojekt nicht weiter berücksichtigt. Die nächstgrößeren Bibliotheken sind die Ephoralbibliothek in Allstedt mit rund 1050 Bänden und die Bibliothek der Unterkirche in Bad Frankenhausen56 mit gut 900 Bänden, davon elf Inkunabeln. Bibliotheken mit einem etwas größeren Bestand befinden sich in Holzthaleben und Westerengel. Die übrigen Bibliotheken verfügen vermutlich nur über kleine, zum Teil sehr kleine Altbestände. Aufschluss geben bis zu einem bestimmten Maße die Akten des Kirchenarchivwarts und die einzelnen Ortsakten, die sich im Landeskirchlichen Archiv in Eisenach befinden. Die Angaben in den Akten aus der Zeit des späten 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 2009 sind keineswegs vollständig und oft auch nicht genau, zudem oft widersprüchlich. In einigen Fällen ist der Verbleib der einst konkret gemeldeten, zum Teil wertvollen Bestände noch ganz und gar unklar. Die im Sommer 2017 erfassten Kirchenbibliotheken von Großenehrich und Freibessingen und weitere (z. B. von Menteroda) befinden sich als Deposita im Landeskirchlichen Archiv Eisenach. Es ist denkbar, 2017 im Zuge der Erschließung weitere Bibliotheken als Deposita nach Eisenach zu überführen, falls dies im Hinblick auf die Aufbewahrung, Sicherung und Benutzung sinnvoll erscheint und die Gemeinden mit dieser Lösung einverstanden sind.
Im Rahmen der erwähnten Erschließung sollen die wenigen Handschriften (keine Akten, keine Kirchenbücher) und die Inkunabeln genau beschrieben werden (mit Meldung der Inkunabeln an den »Gesamtkatalog der Wiegendrucke« in Berlin und Nachweis der Exemplare in INKA57) und die Drucke aus der Zeit von 1501 bis 1850 bibliographisch nachgewiesen und bezüglich Einbände, Einbandmakulatur, Ausstattung, handschriftliche Anmerkungen, Vorbesitzern etc. beschrieben werden. Diese Beschreibungen werden mittels Archiv- und Bibliothekssystem »Augias« erfasst und zugänglich gemacht.58 Zudem sollen die Bestände auch im Gemeinsamen Verbundkatalog GVK/GBV nachgewiesen werden. Die Bücher aus der Zeit nach 1851 werden nur ganz summarisch erfasst. Dasselbe gilt für Musikalien aller Art. Sie sollen zudem dem Thüringischen Landesmusikarchiv in Weimar zur Kenntnis gebracht werden.
Im Bereich der evangelisch-lutherischen Kirche Thüringens (Teilkirche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland) gab oder gibt es den Akten zufolge mindestens 800 Kirchenbibliotheken. Einige wenige dieser Bibliotheken sind bereits gut erschlossen und werden auch gut aufbewahrt. Aber es gibt sehr viele, auch größere und solche mit wertvollen Altbeständen, die kaum oder gar nicht erschlossen und zum Teil unsachgemäß verwahrt sind. Es wäre sehr wünschenswert, im Laufe der Zeit möglichst viele dieser Bibliotheken zu erfassen59 und auch für eine angemessene Konservierung dieser wichtigen Kulturgüter zu sorgen.
1 Jürgen GEISS: Die Kirchenbibliothek zu St. Marien in Barth. In: Stadt Barth: Beiträge zur Stadtgeschichte. Schwerin 2005, 3-11.
2 Falk EISERMANN: Barth, Greifswald, Wolgast: die Wiederauferstehung der vorpommerschen Kirchenbibliotheken. Jahrbuch kirchliches Buch- und Bibliothekswesen N. F. 2 (2014), 13-26.
3 Gerd ALBRECHT: Die Kirchenbibliothek im Barther Kulturverbund. Ebd, 33-40.
4 Christian HEITZMANN: Die mittelalterlichen Handschriften der Barther Kirchenbibliothek. Ebd, 43-60.
5 Christine JOHANNSEN: Sanierung und Umgestaltung der Bibliothek der St. Marien-Kirche in Barth. Ebd, 67-76.
6 Konrad VON RABENAU: Barth, Kirchenbibliothek St. Marien. In: Handbuch der historischen Buchbestände/ hrsg. von Bernhard Fabian u. a., Bd. 16: Mecklenburg-Vorpommern; Brandenburg. Hildesheim 1996, 46-52. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?St._Marien_%28Barth%29.
7 Wilhelm BÜLOW: Katalog der Kirchenbibliothek zu Barth. Barth 1882; Nachtrag 1900.
8 Andrea SAID: Inkunabeln der Kirchenbibliothek zu Barth. Berlin 1983 (Typoskript).
9 KIRCHLICHER ZENTRALKATALOG beim Evangelischen Zentralarchiv in Berlin (KZK). Mikrofiche-Edition. München 1997, mit Begleitband im Auftrag des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin/ hrsg. von Uwe Czubatynski. München 1997.
10 Thomas WILHELMI: Inkunabeln in Greifswalder Bibliotheken: Verzeichnis der Bestände der Universitätsbibliothek Greifswald, der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums und des Landesarchivs Greifswald. Wiesbaden 1997. In der Universitätsbibliothek Greifswald befinden sich 347 Inkunabeln (inkl. Fragmente), im Landesarchiv elf Inkunabeln (inkl. Fragmente).
11 Robert LÜHDER: Die Druckschriften der Bibliothek des geistlichen Ministeriums zu Greifswald in alphabetischem Verzeichnis mit einer Geschichte der Bibliothek. Greifswald 1908; Konrad VON RABENAU: Greifswald, Bibliothek des Geistlichen Ministeriums. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 96-98; http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Geistliches_Ministerium; Eisermann: Barth, Greifswald, Wolgast … (wie Anm. 2).
12 Robert LÜHDER: Die Handschriften der Bibliothek des geistlichen Ministeriums zu Greifswald in Fortsetzung von Dr. Th. Pyls »Rubenow-Bibliothek«. Pommersche Jahrbücher 7 (1906), 263-336; Jürgen GEISS: Mittelalterliche Handschriften in Greifswalder Bibliotheken: Verzeichnis der Bestände der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek St. Nikolai), der Universitätsbibliothek und des Universitätsarchivs. Wiesbaden 2009; Jürgen GEISS: Buchhandel, Bettelorden, Büchersammlungen. Erkundungen zur Bibliothekslandschaft im spätmittelalterlichen Greifswald. Quaerendo 41 (2011), 214-224.
13 Gisela KLOSTERMANN: Stralsund, Archivbibliothek beim Stadtarchiv. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 231-260. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Archivbibliothek_Stralsund.
14 Von Rabenau: Barth … (wie Anm. 6), 49-51.
15 Die Buchbestände aus dem 20. Jahrhundert werden hier und im Folgenden nicht genannt.
16 Nilüfer KRÜGER: Die Inkunabeln der Universitätsbibliothek Rostock: mit den Inkunabeln der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin und der Kirchenbibliothek in Friedland (Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock; 2). Wiesbaden 2003.
17 Konrad VON RABENAU: Friedland (Mecklenburg), Kirchenbibliothek an St. Marien. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 52-54. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?St._Marien_%28Friedland%29. Die Buchbestände sind im Kirchlichen Zentralkatalog … (wie Anm. 9) erfasst.
18 Christa SIEVERKROPP; Friedel KROHN: Schwerin, Bibliothek des Mecklenburgischen Landeshauptarchivs. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 217-219. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Mecklenburgisches_Landeshauptstadtarchiv (!).
19 Martina PYL: Wismar, Ratsbibliothek. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 263-265. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Ratsbibliothek_%28Wismar%29.
20 Ira KOCH: Güstrow, Bibliothek des Museums der Stadt Güstrow. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 104-106. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Museum_Der_Stadt_Guestrow.
21 Hela BAUDIS; Karin PEVESTORF: Schwerin, Bibliothek des Staatlichen Museums Schwerin – Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 227229. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Staatliches_Museum_Schwerin.
22 Konrad VON RABENAU: Altentreptow, Kirchenbibliothek St. Petri. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 43f. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?St._Petri_%28Altentreptow%29.
23 Alle nicht im Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), verzeichnet.
24 Gottfried HOLTZ: Ländliche Kirchenbibliotheken auf Rügen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock 5 (1955/56), 69-107.
25 Diese Bibliothek befindet sich in Zirkow, vgl. Erika KEHNSCHERPER: Zirkow, Bibliothek der Evangelischen Kirchengemeinde. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 106-108. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Evangelischen_Kirchengemeinde_%28Lancken%29 (!).
26 Konrad VON RABENAU: Greifswald, Landeskirchliche Bibliothek. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 99f. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Landeskirchliche_Bibliothek_%28Greifswald%29.
27 Konrad VON RABENAU: Loitz, Kirchenbibliothek: In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 108-110. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Kirchenbibliothek_%28Loitz%29.
28 Deren Bestände sind im Kirchlichen Zentralkatalog … (wie Anm. 9) erfasst.
29 Deren Bestände sind im Kirchlichen Zentralkatalog … (wie Anm. 9) erfasst.
30 Konrad VON RABENAU: Schwerin, Oberkirchenrats-Bibliothek. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 221-227. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Oberkirchenrats-Bibliothek_%28Schwerin%29; Konrad VON RABENAU: Schwerin, Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs – Bibliothek der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde St. Marien Neubrandenburg. In: Ebd, 225. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?St._Marien_Neubrandenburg.
31 Deren Bestände sind im Kirchlichen Zentralkatalog … (wie Anm. 9) erfasst.
32 Erika KEHNSCHERPER: Wolgast, Bibliothek der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 265-267. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Kirchengemeinde_St._Petri; Eisermann: Barth, Greifswald, Wolgast … (wie Anm. 2).
33 Die Bestände dieser sieben Bibliotheken sind im Kirchlichen Zentralkatalog … (wie Anm. 9) erfasst.
34 Darüber Aufschluss geben dürften die Ortsakten der Kirchengemeinden in den Landeskirchlichen Archiven. Die Erfassung (und nötigenfalls auch Sicherung) der weiteren Streubestände ist ein großes Desiderat.
35 Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 31-36. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliotheken_In_Mecklenburg-Vorpommern.
36 Erhard PIERSIG: Kirchenbibliotheken im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburg, Manuskript (o. J.).
37 Die Übersicht ist online abrufbar: http://www.ariadne.uni-greifswald.de.
38 http://nkb.nordkirche.de/projekte-koopertationen/historische-kirchenbibliotheken-in-m-v.html.
39 Gerhard HEITZ: Greifswald, Bibliothek des Stadtarchivs. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 100-102. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Stadtarchiv_%28Greifswald%29.
40 Kirchlicher Gesamtkatalog … (wie Anm. 9); Roswitha HANSKE: Greifwald, Bibliothek des Vorpommerschen Landesarchivs. In: Handbuch der historischen Buchbestände, Bd. 16, 102f. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Vorpommersches_Landesarchiv.
41 Gudrun MOHR; Heike BIRKENKAMPF: Neubrandenburg, Regionalbibliothek. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 111-114. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Regionalbibliothek_%28Neubrandenburg%29.
42 Carmen STROBEL: Rostock, Bibliothek des Stadtarchivs. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 186-188. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Archiv_Der_Hansestadt_Rostock.
43 Heidi HECHT: Waren (Müritz), Bibliothek des Müritz-Museums (Maltzaneum). In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 262 f. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Mueritz-Museum.
44 Monika VIBRANS; Susan LAMBRECHT: Waren (Müritz), Bibliothek des Gymnasiums Waren. In: Handbuch (Bd. 16) … (wie Anm. 6), 260-262. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Gymnasium_Waren.
45 In den letzten Jahren kamen drei weitere seltene Inkunabeln zum Vorschein.
46 Johann Heinrich KINDERVATER: Gloria Templi Blasiani, oder: Ehren-Gedächtniß der Kirche St. Blasii in der Reichs-Stadt Nordhausen. Nordhausen 1724.
47 Richard RACKWITZ: Nachrichten über die St. Blasii-Bibliothek in Nordhausen und das Kloster Himmelgarten bei Nordhausen, dem die Bibliothek entstammt. Nordhausen 1883.
48 Hannelore GÖTTING: Geschichte und Bedeutung der Kirchenbibliothek St. Blasii in Nordhausen, mit Inkunabel-Katalog. Naumburg 1972 (Typoskript). In überarbeiteter Form in: Kirchenbibliotheken als Forschungsaufgabe/ hrsg. von Uwe Czubatynski; Adolf Laminski; Konrad von Rabenau. Neustadt an der Aisch 1992, 21-34.
49 Stephan LANGE: Lutherstadt Wittenberg, Evangelisches Predigerseminar – Kirchenbibliothek St. Blasii Nordhausen. In: Handbuch der historischen Buchbestände/ hrsg. von Bernhard Fabian u. a., Bd. 22: Sachsen-Anhalt. Hildesheim 2000, 186 f (damals als Depositum in der Bibliothek des Predigerseminars Wittenberg). http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?St._Blasii_Nordhausen. Die dort angegebenen Bestandszahlen sind nicht ganz exakt.
50 Rackwitz: Nachrichten … (wie Anm. 47).
51 Johann Heinrich KINDERVATER: Arcana bibliothecae Blasianae, oder Eigentliche Nachricht von der alten raren Bibliothec der Kirchen S. Blasii in der Kays. Freyen Reichs-Stadt Nordhausen. Nordhausen 1717.
52 Kirchlicher Zentralkatalog … (wie Anm. 9).
53 Herrn Stadtarchivar Wolfram Theilemann danke ich für freundlich gewährte zusätzliche Informationen.
54 Felicitas MARWINSKI: Sonderhausen, Bibliothek in der Stadtkirche St. Trinitatis. In: Handbuch der historischen Buchbestände/ hrsg. von Bernhard Fabian u. a., Bd. 21: Thüringen S-Z. Hildesheim 1999, 67-70. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Stadtkirche_St._Trinitatis.
55 Felicitas MARWINSKI; Konrad MARWINSKI; Klaus STOLLBERG: Katalog 450 Jahre Kirchenbibliothek Sondershausen: Geschichte der Sammlungen und Katalog »Vierhundertfünfzig Jahre Kirchenbibliothek Sondershausen« (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Schwarzburg, Gleichen und Hohenlohe in Thüringen e.V.; 69). Jena 2008.
56 Felicitas MARWINSKI: Bad Frankenhausen, Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in der Unterkirche. In: Handbuch der historischen Buchbestände/ hrsg. von Bernhard Fabian u. a., Bd. 19: Thüringen A-G. Hildesheim 1998, 108-113. http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian? Evangelisch-Lutherische_Kirchgemeinde_%28Bad_Frankenhausen%29.
57 http://www.inka.uni-tuebingen.de.
58 Datenbank des Landeskirchlichen Archiv in Eisenach.
59 Vgl. dazu den kenntnisreichen Aufsatz von Enno BÜNZ: Bücher, Drucker, Bibliotheken in Mitteldeutschland um 1500: Zur Einführung. In: Bücher, Drucker, Bibliotheken in Mitteldeutschland: Neue Forschungen zur Kommunikations- und Mediengeschichte um 1500/ hrsg. von Enno Bünz. Leipzig 2006, 13-47.