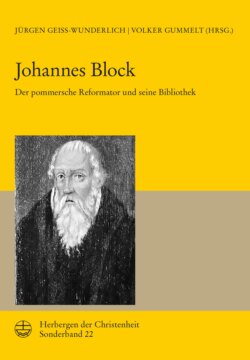Читать книгу Johannes Block - Группа авторов - Страница 12
Die frühe Reformationszeit in Dorpat Mit besonderer Berücksichtigung der Quellenlage und der Forschungstraditionen Von Tiina Kala
ОглавлениеI Religiosität und Geistesleben im mittelalterlichen Livland
Während des Mittelalters war Livland – das Territorium der heutigen Republiken Estland und Lettland – ein Konglomerat mehrerer geistlicher Herrschaften, verteilt zwischen dem Deutschen Orden und dem Erzbischof von Riga und seiner Suffragane, den Bischöfen von Kurland, Dorpat und Ösel-Wiek.1 Vom Anfang der Eroberung und Christianisierung des Landes am Ende des 12. Jahrhunderts bis in das 16. Jahrhundert beschreiben die Quellen Livland als einen weit vorgeschobenen Vorposten des westlichen Christentums an der Grenze zu den russisch-orthodoxen »Schismatikern«.2 Später wurde diese Rhetorik von den Autoren des humanistischen Zeitalters übernommen, so z. B. in der Chronik Tilman Bredenbachs (1564), welcher Livland seinen Lesern mit den Worten vorstellte: »Livonia ultimus pene Christiani nominis terminus, ad Orientem Rutenis iungitur: ad Septentrionem Suedis: ab occidente mari Baltheo …«.3
Als relativ spät christianisiertes und von großen Religions- und Geisteszentren entferntes Land entwickelte Livland keine eigenen religiösen Strömungen. Dementsprechend hatte diese Region aber auch keine Erfahrungen mit Ketzerei. So gehörte der in der Forschung gelegentlich als »Schwarmgeist« bezeichnete Franziskanerbruder Johannes von Hilten, der in den 1460er und 1470er Jahren in Riga, Reval und Dorpat tätig war, weder zu den Ketzern im direkten Sinne des Wortes noch zu den Vorläufern der Reformation; eher ist er als Kritiker der kirchlichen Verhältnisse seiner Zeit anzusehen.4
Man kennt aus Livland keine bedeutenden geistlichen Autoren. Einige Versuche der hohen Geistlichen, sich schriftstellerisch zu betätigen,5 blieben Ausnahmen ohne bemerkenswerten Einfluss. Die Bildungsanstalten – Dom-, Kloster- und städtische Schulen – haben im livländischen kulturellen Gedächtnis keine bedeutenden Spuren hinterlassen.6 Wenn ein Livländer bessere Bildung wünschte, musste er mindestens bis zur Gründung der Universität Dorpat (1632) weite Reisen ins Ausland unternehmen.7 Unter den mittelalterlichen Bildungsanstalten Livlands sind in erster Linie die Dominikanerkonvente hervorzuheben.8 So wird etwa 1481 im Revaler Konvent ein Studium für Logik erwähnt.9 Vor 1520 gab es ein »studium artium«; in diesem Jahr (1520) wurden vier Revaler Mitbrüder nach Paris ins »studium generale« gesandt. Mindestens drei von ihnen kehrten während der Wirren der Reformationsereignisse nach Reval zurück10 und brachten ihre intellektuelle Kompetenz, wozu damals sicherlich auch die Kenntnis der lutherischen Lehre gehörte, in ihre livländische Heimat mit. Die Mendikanten gehörten in den Städten Livlands offensichtlich zu den wichtigsten theologischen Opponenten der Reformation. Davon zeugen auch die Reste ihrer mittelalterlichen Büchersammlungen, soweit sie noch erhalten sind. Diese kommen meistens aus den ehemaligen Mendikantenkonventen, in erster Linie aus Riga und Reval.11
Auch die Angaben zu privaten Büchersammlungen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Livland sind sehr spärlich: Zu nennen sind hier die Bücher des Rigaer Bürgers Reinhold Soltrump aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts,12 die in einem Inventar bezeugten Bücher des Revaler Ratssekretärs Reinold Korner13 sowie die Bücher des Revaler Klerikers Reinold Grist.14 Andere, vereinzelt in den Quellen erwähnte Sammlungen hoher livländischer Geistlicher sind verloren gegangen oder befinden sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort.15 Soweit bekannt, enthielten diese Sammlungen (institutionelle wie private) damals weit verbreitete lateinische Werke der Theologie, Homiletik und der beiden Rechte, daneben auch Schulschriften oder Werke antiker Autoren. Zumindest zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist auch die Interesse an zeitgenössischer polemischer Literatur belegt. So versuchten z. B. der Revaler Ratssekretär Marcus Tirbach, der Alt-Pernauer Pfarrer Petrus Usenus und der bischöfliche Notar von Ösel-Wiek, Jakob Kruse, etwa zeitgleich (um 1510), sich Werke der humanistischen Erfolgsautoren Jacques Lefèvre d’Etaples und Erasmus von Rotterdam aus Deutschland zu beschaffen.16
Als eine wichtige livländische Besonderheit ist die ethnische Zusammensetzung hervorzuheben, welche in groben Zügen aus der deutschen Oberschicht und der sogenannten »undeutschen«17 – estnischen, lettischen und livischen – Unterschicht bestand. Die sprachlichen Grenzen fielen meistens mit den sozialen und kulturellen Unterschieden zusammen.18 Seit den Beschreibungen Livlands in den Werken der humanistisch gebildeten Chronisten des 16. Jahrhunderts sind die Besonderheiten dieser besonderen Sprachsituation in Livland für die verschiedenen Autoren immer eine Hervorhebung wert gewesen.19
Im kirchengeschichtlichen Zusammenhang spielten die sprachliche Verhältnisse eine wichtige Rolle: Seien es katholische oder evangelische Missionstätigkeit und Seelsorge – man musste immer davon ausgehen, dass Predigten, Religionsunterricht und die religiösen Grundtexte in der niederdeutschen Sprache der Oberschicht nicht ausreichend waren. Die Kleriker mussten stattdessen in den meisten Fällen auch die Sprachen der ursprünglich in Livland ansässigen Völker – zumindest einigermaßen – beherrschen. Im 15. und frühen 16. Jahrhundert wurde die Notwendigkeit des muttersprachlichen Religionsunterrichts für die autochthone Bevölkerung von der kirchlichen Obrigkeit besonders in den Synodalstatuten immer wieder hervorgehoben.20 Es gab die sogenannten »undeutschen« Predigtstühle in den Kirchen der großen Städte und auch bei den Mendikanten sind Prediger für die »undeutschen« Bevölkerungsgruppen regelmäßig erwähnt.21 Predigten in niederdeutscher Sprache werden dagegen in den Quellen fast nie genannt, obwohl es sie ohne Zweifel gab. In den autochthonen Sprachen Livlands gibt es aus dem vorreformatorischen Zeitalter nur ein paar spätmittelalterliche Abschriften der wichtigsten Gebete.22 Andererseits sind auch von den niederdeutschen religiösen Texten des Mittelalters nur sehr wenige in Est- und Lettland erhalten geblieben.23 So scheinen die Bedingungen für die Überlieferung mittelalterlicher geistlicher Texte für alle Volkssprachen generell sehr schlecht gewesen sein. Vielleicht ist aber die Zahl dieser Texte auch nie wirklich groß gewesen.
Die ersten evangelischen Prediger Livlands kamen aus Norddeutschland. Im Bereich der Sprachen lag ihr Interesse in erster Linie darin, den deutschsprachigen Gottesdienst zu versehen. Die einheimischen Sprachen waren ihnen mindestens während der ersten Jahre fremd. Wenn in der Quellen des Reformationszeitalters auch Predigten auf Lettisch oder Estnisch erwähnt wurden, so galten den deutschstämmigen Predigern diese Sprachen keineswegs als Muttersprachen.24 In diesem kirchengeschichtlichen Umfeld traten die Reformationsereignisse in Livland zu Beginn der 1520er Jahre relativ rasch ein. Im Folgenden wird versucht darzustellen, welche Möglichkeiten die Historiographie und die Quellen bieten, um diese Ereignisse am Beispiel Dorpats näher zu erörtern.
II Das deutschbaltische Erbe in der Forschung zur livländischen Reformation
Die Erforschung der livländischen Reformation ist bis zum heutigen Tag sehr stark von der deutschbaltischen Geschichtsschreibung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts beeinflusst worden. Es gilt gleichermaßen für die estnische wie auch für die deutsche Historiographie. Nach dem deutschbaltischen Vorbild ist die spätmittelalterliche Kirchengeschichte Livlands als Vorgeschichte oder Vorbereitung der Reformation verstanden worden. Die Ereignisse und Prozesse des spätmittelalterlichen katholischen Kirchenlebens sollten unabwendbar zur Reformation führen. Erst nach Einführung der Reformation habe die eigentliche Kirchengeschichte und Geschichte des »wahren« religiösen Denkens begonnen.25
Die Rolle des lutherischen Glaubens und die davon abgeleiteten Standesvorrechte sind in der deutschen Geschichtsschreibung immer als wesentliche Grundsteine des baltischen Deutschtums hervorgehoben worden.26 Andererseits war das Luthertum seit dem Zeitalter des nationalen Wiederauflebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch eine wichtige Stütze für die kulturelle Identitätsbildung der Esten und Letten, vor allem als wichtiges Gegengewicht gegen die Russifizierung der baltischen Provinzen im späten 19. Jahrhundert.27 Alles das trug wesentlich dazu bei, dass die Reformation besonderes für die Deutschen im Baltikum als Synonym für freies Denken, politische Autonomie und kulturelle Entwicklung verstanden wurde.
Eine der Grundsteine der livländischen Reformationsforschung ist »Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland« von Leonid Arbusow (Junior).28 Dieses Buch enthält eine ungeheuere Menge Informationen zum Thema. Es berücksichtigt fast alle wichtigen Ereignisse der livländischen Kirchengeschichte und nennt die meisten bedeutenden Quellen. Gerade für faktische Informationen haben mehrere Generationen deutscher, estnischer und lettischer Forscher immer wieder aus diesem Werk geschöpft,29 besonderes wenn die Originalquellen nicht erreichbar waren oder wenn den deutschen Forschern Sprachbarrieren entgegenstanden. Allerdings hatte auch Arbusow nicht die Möglichkeit, alle Quellen selbst einzusehen; manchmal benutzte er Abschriften oder Referate (auch mündliche). Er hatte sein Werk ja während des ersten Weltkrieges geschrieben, weswegen er auf mehrere, ursprünglich geplante Archivreisen und manche andere Vorbereitungen verzichten musste.30 Seiner Ausbildung nach war Arbusow nicht nur Historiker, sondern hatte nach dem Abitur am Rigaer Klassischen Stadtgymnasium in den Jahren 1902-1906 Theologie in Dorpat studiert.31 Auch vor diesem Hintergrund beschreibt Arbusow die Geschichte der mittelalterlichen Kirche Livlands vorwiegend als Untergangsgeschichte. Oft schreibt er sogar ganz neutralen Erscheinungen im Nachhinein eine negative Schattierung zu. Einige Beurteilungen und Schlussfolgerungen sind nicht in erster Linie von den Quellen abgeleitet (obwohl er ein ausgezeichneter Kenner dieser war), sondern sie basieren auf seinen persönlichen Überzeugungen und der Atmosphäre, welche den deutschbaltischen Kulturkreis seiner Zeit charakterisierte. Damit bringt das Buch sehr lebendig die Vorstellung von der Reformation, wie sie in den baltischen Ländern des frühen 20. Jahrhunderts vorherrschend war, zum Ausdruck.
Parallel mit seiner »Einführung der Reformation« beschäftigte sich Arbusow mit der Edition der Akten und Rezesse der livländischen Ständetage. Wie auch in der »Einführung« konzentriert er sich hier auf die Stände des mittelalterlichen Livlands – auf die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Deutschen Orden, den Prälaten, den Ritterschaften und den Städten. In solcher Weise bleiben die kirchengeschichtlichen Ereignisse manchmal sogar im Hintergrund oder es werden auch politische Aspekte, welche nicht unbedingt dazu gehören, mit dem Kirchenleben in einen direkten Zusammenhang gebracht. Dessen ungeachtet hat Arbusows Buch zur Reformation in Livland einen großen Wert und es ist das gründlichste, was es bis heute zu diesem Thema gibt.
In der Historiographie Livlands ist die allgemeine spätmittelalterliche Geschichte, vor allem der Aspekt der Kirchengeschichte, von der Geschichtsschreibung zur wichtigsten politischen Kraft des Landes – dem Deutschen Orden – überschattet. Dies führt sogar so weit, dass der estnische Forscher Otto Freymuth und der deutsche Historiker Georg von Rauch diese Zeit in ihren Forschungen als »Ordenszeit« bezeichnet haben,32 obwohl es in der Bischofsstadt Dorpat tatsächlich keine »Ordenszeit« gegeben hat, was den beiden Autoren natürlich bekannt war.
Die traditionelle Forschung zur livländischen Reformation konzentriert sich in erster Linie auf die Ereignisse der frühen Reformationsphase und ihre politischen Hintergründe sowie auf die kirchenorganisatorischen und die finanziellen Aspekte. Über das religiöse oder intellektuelle Klima des Zeitalters wissen wir relativ wenig. Einige spärliche Briefe Luthers oder anderer Denker dieser Zeit zu Livland oder zu den mit Livland verbundenen Personen33 sind für eine umfassende Charakterisierung des religiösen Denkens im Land unzureichend. Erst dann, wenn man von der Konzeption der sogenannten »langen Reformation« ausgeht, erlaubt es die Quellenlage, das Interessensgewicht mehr auf die theologischen Aspekte zu verlagern.34
III Das spätmittelalterliche Dorpat
Dorpat – die drittgrößte Stadt des mittelalterlichen Livland nach Riga und Reval – bleibt den Mediävisten im Allgemeinen und den Forschern der Geistesgeschichte im Besonderen sehr schwer zugänglich. Obwohl für eine Erforschung des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Livland die Quellenlage relativ gut ist, bleibt die Stadt Dorpat in dieser Hinsicht doch in der Rolle eines Waisenkindes. In den Sammelwerken über die Geschichte Dorpats (1927, 1980, 2005) macht die Zeitabschnitt vom 10./11. Jahrhundert bis 1558, d. h. bis zum russisch-livländischen Krieg, nur etwa ein Zehntel aus.35
In der Folge der in der Mitte des 16. Jahrhunderts entstandenen inneren Konflikte und der durch die russisch-livländischen Auseinandersetzungen eingeleiteten Kriegsepoche36 sind das mittelalterliche Stadtarchiv und das Bischofsarchiv fast völlig verloren gegangen. Die Chroniken berichten über das Dorpater Mittelalter nicht viel und sind auch nicht immer vertrauenswürdig. Auch das mittelalterliche Stadtbild ist fast völlig zerstört. Obwohl das traurige Schicksal des frühneuzeitlichen Dorpat im Vergleich mit mehreren anderen europäischen Städten dieser Epoche nicht außergewöhnlich ist, sollte es doch klar machen, warum die Kenntnisse über die ältere Geschichte Dorpats so gering sind.
Einzelne Bereiche der mittelalterlichen Geschichte Dorpats, wie zum Beispiel der Handel oder die Beziehungen zu den anderen Städten Livlands, sind in den Quellen relativ gut repräsentiert. In anderen Bereichen, darunter der Kirchengeschichte, muss man sich meistens auf sehr wenige, zerstreute und oft unrepräsentative Quellen stützen. Archive der mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen religiösen Institutionen gibt es – wie oben bereits angedeutet – gar nicht, und auch die ältesten erhaltenen Quellen des Dorpater Ratsarchivs sind erst aus der Mitte des 16. Jahrhunderts überliefert.
Nach einzelnen spätmittelalterlichen Reisebeschreibungen37 scheint Dorpat eine reiche und schöne Stadt gewesen zu sein, deren Bevölkerungszahl im Mittelalter man auf 4.000-6.000 schätzt.38 In den romantischen Vorstellungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts schätzte man die Einwohnerzahl Dorpats in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sogar auf 40.000 Einwohner,39 was natürlich absolut unmöglich ist. Dorpat war eine Art Doppelstadt, wo der Domberg, die Residenz des Stadtherrn, sich von der vom Rat bestimmten Unterstadt nicht nur rechtlich, sondern auch topographisch abtrennte. In der Unterstadt befanden sich im Spätmittelalter die zwei Pfarrkirchen St. Johannis und St. Marien, dazu das Zisterzienserinnenkloster St. Katharinen (gegründet in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts; Ersterwähnung 1345), das Dominikanerkloster Maria Magdalena (gegründet kurz vor 1300), das Franziskanerkloster (gegründet in den 1460er Jahren, vermutlich an der ehemaligen Jakobikirche) sowie der Franzikaner-Terziarinnenkonvent St. Klara (gegründet zu Beginn des 16. Jahrhunderts). Der Dorpater Domberg mit der Bischofskirche (teilweise in Ruinen) sowie die Pfarrkirche St. Johannis, obwohl stark beschädigt und umgebaut, sind bis heute erhalten; die Lage der ehemaligen Marienkirche ist ebenfalls bekannt, während man die genaue Lage der Klöster nicht mehr kennt und diese Frage seit Jahrzehnten diskutiert.40 Man hat vermutet, dass das Dorpater Domkapitel des 15. Jahrhunderts mindestens aus 20 Domherren zusammengestellt war, obwohl nicht alle Prälaten hier ständig residierten.41 Die Dorpater Domkirche war die zweitgrößte livländische Kathedralkirche nach Riga. Das dreischiffige Langhaus, der Chor und der Chorumgang boten viele Möglichkeiten für die Errichtung von Nebenaltären, welche meistens von den mächtigen Familien der Stiftsvasallen, wie den Levenwoldes, Tiesenhausens, Üxkülls, Taubes (Tuves) u. a. gestiftet und patroniert wurden.42
Um die religiöse Landschaft Dorpats vollständig zu beschreiben, muss man noch die russisch-orthodoxen Kirchen von St. Nikolai und St. Georg erwähnen. Die Russen waren (neben den Deutschen und Esten) als Kaufleute, aber auch als Kleinhändler oder als Handwerker relativ zahlreich in Dorpat vertreten.43 Die Stadt pflegte enge Handelskontakte mit den russischen Handelszentren Pleskau und Novgorod. Von dorther kam der Großteil ihres Reichtums, obwohl sich diese Beziehungen nicht immer ohne Konflikte, manchmal sogar blutige, gestalteten.44 Während der letzten drei Jahrzehnte ist zusätzlich einiges zur Macht und Pracht des mittelalterlichen Dorpat durch archäologische Ausgrabungen zu Tage gekommen, wie z. B. Fragmente sogenannter »venezianischer« Glasgefäße, die für weit reichende Handelsverbindungen Dorpats in den Mittelmeerraum sprechen.45
IV Die Städte, Vasallen und Prälaten Livlands in der frühen Reformationszeit
Im politischen Leben des 15. Jahrhunderts entwickelte sich in Livland eine ständige Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Mächten und Ständen, was besonders in der Ständevertretung des Landtages zum Ausdruck kam.46 Im Livland der 1520er Jahre sprach man viel über die Einheit des Landes, die Effektivität der Regierungsformen und die Rechte der Stände, v. a. der Ritterschaften in Bezug auf die geistlichen Landesherren. In den livländischen Bischofsstaaten, darunter im Stift Dorpat, wurden die Auseinandersetzungen, welche in diesem Bereich enstanden, u. a. durch die Herrschaftsverträge einigermaßen reguliert; die Rechte der Stände wurden erweitert, die Bischöfe gaben nach.47 In einem bestimmten Sinne wurden diese Auseinandersetzungen auch wegen der russischen Gefahr vorangetrieben, welche in Livland immer fühlbar gewesen ist, sich aber seit dem Machtzuwachs Moskaus unter Großfürst Ivan III. am Ende des 15. Jahrhunderts noch einmal verstärkte.48 Im Zusammenhang mit dem Russlandhandel sollten aber auch die Konkurrenz zwischen den livländischen Städten und die damit verbundenen Sonderinteressen betont werden,49 welche natürlich nicht unbedingt zu einer intensiven politischen Kooperation im Inneren Livlands beitrugen.
In der deutschbaltischen Geschichtsschreibung ist als wichtiger Bestandteil der direkten Vorgeschichte der Dorpater Reformation oder sogar der Beginn der Reformation selbst der Vertrag aus dem Jahre 1522 zwischen der Stadt und den stiftischen Vasallen hervorgehoben worden. Dieser Vertrag wurde in dem Haus der Großen oder Kaufmannsgilde am 9. April diesen Jahres abgeschlossen. Tatsächlich war es eine Wiederholung eines älteren Vertrags, welcher bereits 1478 eine Ordnung für die Beilegung von Streitigkeiten festgelegt und eine gegenseitige Unterstützung vorgesehen hatte.50 Obwohl eine solche Einigung zwischen den beiden Ständen deren Position gegenüber dem Bischof stärken musste, gab es hierfür keine religiöse, sondern nur politische und administrative Hintergründe. Glaubenssachen finden in dem Vertrag keine Erwähnung. Der verdienstvolle Forscher aus der ersten Generation zur livländischen Reformation, Friedrich Bienemann, schrieb dazu: »Von der dörptischen Ritterschaft war das Bedürfnis des Schutzes gegen ihren ehrgeizigen Herrn, den berliner (!) Bürgermeisterssohn, am tiefsten empfunden«.51 Dieser »Berliner Bürgermeistersohn« war Johannes Blankenfeld, seit 1514 Bischof von Reval, zusätzlich seit 1518 Bischof von Dorpat und seit 1524 Erzbischof von Riga – eine in der livländische Geschichte umstrittene Figur. Er pflegte enge Kontakte zur päpstlichen Kurie und war eifriger Vorkämpfer der katholischen Partei in Livland während der ersten Reformationsphase. Formell bekleidete er der Amt des Bischofs von Dorpat und Erzbischofs von Riga bis seinem Tod im Jahre 1527, obwohl er schon 1525 vieles von seinem früheren Einfluss an den livländischen Ordensmeister Wolter von Plettenberg verlor und seit 1526 vornehmlich als Gesandter des Deutschen Ordens im Reich und in den Niederlanden tätig war.52 Die Stimmung gegen Bischof Blankenfeld in Dorpat verschlechterte sich erheblich wegen der Anschuldigungen, er unterhalte verdächtige Beziehungen mit Russland.53 Es ging um Verhandlungen zwischen Moskau und Rom zum Übergang der russisch-orthodoxen Kirche unter den römischen Primat. Blankenfeld stand mit dem Moskauer Staat in Verbindung und führte mit seinen Repräsentanten Gespräche;54 die Bedeutung der ganzen Sache kann aber auch unter dem Einfluss der späteren Kenntnisse über den russisch-livländischen Krieg übertrieben worden sein.
Obwohl Blankenfeld im Vergleich mit seinen Vorgängern einen ziemlich autoritären Führungsstil an den Tag legte, wäre der Umfang der Unzufriedenheit der Vasallen und der Stadt mit ihrem Herren allein damit nicht zu erklären. Man darf auch nicht vergessen, dass die Quellenlage für das 16. Jahrhundert im Allgemeinen etwas besser ist als in den vorigen Jahrhunderten und erlaubt, zu Blankenfelds Führungsstil Aussagen zu treffen, welche im Fall der früheren Bischöfe nicht in einem solchen Umfang möglich waren. Auf der anderen Seite war nicht nur der scheinbare Dünkel des Bischofs gestiegen, sondern auch das Selbstbewusstsein der Städte und Vasallen. Solches kam auch in anderen Städten Livlands vor, wo – wie oben angedeutet – die gegenseitige Beziehungen der Stände ebenfalls mit Herrschaftsverträgen reguliert wurden. Wenn die Städte und Ritterschaften auf dem Landtag zu Wolmar im Juni 1522 gegen den Prälaten auftraten, geschah es nicht wegen ihrer Sympathie für Luther oder die evangelische Bewegung im weiteren Sinne, sondern eher des wegen, weil sie generell nach größerer politischer und rechtlicher Unabhängigkeit strebten. So wollten die Dorpater Stiftsvasallen von einer Verpflichtung zur Rückgabe belehnter Güter an den Bischof bei Verkauf oder Verpfändung nichts hören; es sollte nur bei der Mannlehne beim Alten bleiben.55
Der Dorpater Vertrag von 1522 wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert in die Reformationsgeschichte einverleibt, als ihn der Historiker Carl Schirren im Jahre 1863 in dem von ihm selbst herausgegebenen »Dorpater Tagesblatt« publizierte. Die Konfrontation zwischen den Ständen und einer Übermacht passte gut in den Kontext von Schirrens Zeitalter – damals ging es um die Konfrontation zwischen der russischen Übermacht und den baltischen Provinzen mit ihren alten Privilegien. 1897 malte der Dorpater Künstler Rudolf Julius von zur Mühlen für die Versammlungsstube der Großen Gilde ein Gemälde, welches den Abschluss des Dorpater Vertrags darstellt. Hier ist die Gildestube mit zwei Porträts dekoriert, u. a. mit demjenigen Martin Luthers, was im April 1522 keineswegs der Fall sein konnte. Erst im Juni dieses Jahres trug Andreas Knopken dem Rat zu Riga seine reformatorischen Punkte vor, was in Riga die Reformationsereignisse entzündete; in Dorpat und Reval kommen erste Nachrichten über evangelischen Prediger erst im Frühjahr 1524 auf. Das andere Porträt auf dem Gemälde stellt den livländischen Ordensmeister Wolter von Plettenberg dar, was auch nicht der Fall sein konnte, weil 1522 der Herr in Dorpat Bischof Blankenfeld, nicht der Ordensmeister war.56
V Die frühen Reformationsereignisse in Dorpat im Spiegel der Quellen
Zu Beginn der 1520er Jahre waren die wichtigsten Fragen im religiösen Leben Livlands die Verbesserung des Glaubensinhalte sowie der religiösen Moral der einheimischen Bevölkerung und die Erhöhung der Bildungsniveaus der Geistlichen.57 Diese Bemühungen wurden jedoch mit der Verbreitung der evangelischen Bewegung unterbrochen. Die neue Lehre wurde zuerst aber nicht unmittelbar mit Luther verbunden. Als der erste evangelische Geistliche Rigas, Andreas Knopken, im Jahre 1521 begann, seine Predigten zu verbreiten, kannte man die Werke Luthers in Livland noch kaum. 1522 entstand in Riga eine Art evangelischer Gemeinde; in Dorpat und Reval gab es damals von der evangelischen Bewegung noch keine Spur. Obwohl die neue Lehre Livland sehr schnell erreichte, ging ihre weitere Verbreitung hier vor Ort nicht automatisch vor sich. Die Fortschritte der evangelischen Partei hingen teilweise davon ab, wie schnell die aus dem Deutschen Reich kommenden Prediger die eine oder andere Stadt oder Ortschaft erreichten.
In welchem Umfang in Livland der 1520er Jahre aber überhaupt eine reformationstheologische Diskussion stattfand, darüber bleiben die Quellen fast völlig stumm. Obwohl aus der frühen Phase der Reformation nicht wenig von evangelischen Predigern und ihrer äußeren Tätigkeit bekannt ist, kann man (mit wenigen Ausnahmen) über ihre Lehre, ihre Vorbilder und über die Inhalte ihrer Predigten kaum etwas sagen.58 In Riga fand bekanntlich 1522 eine erste Disputation statt,59 während die Dominikaner in Reval einige Jahre später den Vorschlag des Rates und der evangelischen Prediger für eine Disputation zurückwiesen.60 Ob in Dorpat zwischen den Anhängern der alten und neuen Lehre disputiert wurde, darüber gibt es keine direkten Informationen. Die Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Predigern wie Melchior Hofmann oder Herrman Marsow mit dem Dorpater Stadtrat sprechen eher für eine Störung der Ordnung und des Friedens in der Stadt sowie für eine gewisse soziale Unzufriedenheit.61 In den Konflikten zwischen der Stadt und dem Domberg ging es in erster Linie um verletzte städtische Freiheiten,62 nicht um Glaubenssachen.
Einer der gründlichsten Texte, die man mit Bezug auf den Einfluss der evangelischen Lehre in Dorpat nennen kann, ist der Sendbrief Melchior Hofmanns aus Wittenberg an den Dorpater Rat und die Bürgerschaft vom 22. Juni 1525. Hier sagt der Wanderprediger im Rückblick auf die ersten Bilderstürme in der Stadt:
»So ist nun meyn fleyssige ermanung, das yhr ja nach fride und eyntracht ringet, auff das keyn auffrhur under euch werde, als leyder ytst vorhanden ist, duldet und leydet viel lieber unrecht, dan das Christus von ewren hertzen solt ausgeleschet werden …«,63
was sich direkt auf die gewaltsamen Ereignisse in Dorpat beziehen sollte. Was aber zu diesem »auffrhur« geführt hatte und in welcher Maße Hofmann selbst daran Schuld hatte, darüber schweigt der Brief.
Am 13. März 1522 ließ Johannes Blankenfeld in Dorpat und Reval die gegen Luther erlassene päpstliche Bulle und die kaiserliche Edikte verbreiten. Die befürchtete Erregung innerhalb der Bürgerschaft blieb danach zumindest in Reval aus, weil die von Papst und Kaiser verdammte neue Lehre in der Stadt bis dato noch unbekannt war.64 In Dorpat war die Situation komplizierter, weil sowohl die Stadt als auch die Ritterschaft mit dem Bischof schon mehrere Jahre wegen der Zurückschneidung ihrer Rechte im Konflikt standen. Zur Bedeutung der Bannbulle gegen Luther für Livland sagt Leonid Arbusow, dass »die Verdammung Luthers in einem Lande, das zwar von seiner Lehre noch kaum etwas wusste, in dem aber die Wellen des Widerstandes gegen die geistlichen Fürsten immer mehr anschwollen, einen neuen Zankapfel zwischen Geistliche und Weltliche werfen« musste.65 Wer daran mehr Schuld hatte – die Geistlichen oder die Weltlichen – ist eine andere Frage. Man darf ja nicht vergessen, dass es in Livland überhaupt keine weltlichen Fürsten gab, was bedeutet, dass die weltlichen Stände praktisch gegen die geistliche Obrigkeit im Allgemeinen agierten. Am 19. Oktober 1524 verordnete Blankenfeld: »Das Wort Gottes und das heilige Evangelium soll dem Volke von denen, welchen es gebühre, lauter und unverfälscht nach dem Alten und Neuen Testament gepredigt werden; es sollten bei den Gebräuchen der Kirche keine Neuerungen oder Veränderungen geschehen«.66 Damit wurde der uralte Konflikt zwischen der geistlichen und weltlichen Macht in Kirchensachen wieder neu entzündet.
Die Dorpater Reformationsereignisse sind in erster Linie durch die Chroniken und Akten der livländischen Ständeversammlungen bekannt. Die Chroniken stammen allerdings nicht aus den frühen Zeiten der livländischen Reformation, sondern erst aus dem Zeitalter des russisch-livländischen Krieges. Dieser Krieg rief eine ganze Welle chronistischer Werke hervor, welche teilweise bis in den Beginn des 17. Jahrhunderts reichte.67 Die früheren Ereignisse der livländischen Geschichte, darunter die Stadtgeschichte Dorpats, sind in diesen Werken unter den von dem Krieg bestimmten Eindrücken beschrieben, manchmal sogar als Vorgeschichte dieses Krieges behandelt, manchmal einfach entweder sehr kurz oder fehlerhaft beschrieben. Der zwischen 1555-1571 in Dorpat lebende Kaufmann Franz Nyenstede, der spätere Bürgermeister Rigas, berichtet in seiner Chronik: »Anno 1523 da hat sich in Liefflandt die Luttersche Lehre auffgethan, und seind die Lutterschen Prediger als Tegetmeyer, Sterbell, Andreas Knöpken vnd andere mehr in den Städten vnd auff dem Lande auffgetreten, die mit grossem Eyffer dem Papste widersprochen und seine Lehren nach Lutheri Meynunge aus der Bibel verdammt haben, dadurch denn in der Gemeine allerley Zwiespalt und Verbitterunge entstanden, bis die Lutterschen die Kirche eingenommen, und die Päpstlichen daraus vertrieben haben«.68 Diese Beschreibung dürfte den allgemeinen Charakter der Reformation relativ vertrauenswürdig darstellen, bleibt aber leider sehr kurz. Dionysius Fabricius, der 1602 im damals polnischen Fellin (Viljandi) zum Probst ernannt wurde, hebt in seiner Chronik als die wichtigste Figur der Reformation in Dorpat Melchior Hofmann hervor und behauptet, Dorpat sei die erste livländische Stadt gewesen, in der die Reformation begonnen habe. Allerdings datiert Fabricius die Tätigkeit Hofmanns in Dorpat (1524-1525) fälschlicherweise in das Jahr 1538.69
Es ist nicht beabsichtigt, hier alle wichtigen Chroniken der livländischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts auf unsere Frage hin durchzugehen.70 Zur Erforschung des Reformationszeitalters in Dorpat tragen sie wenig bei. Ausgenommen davon ist das Werk von Tilman Bredenbach, das zu den wenigen narrativen Quellen dieser Zeit gehört, die Näheres über die Reformationsereignisse in Dorpat berichten.71 Das Werk beruht im Wesentlichen auf den Angaben, die von dem 1551-1558 in Dorpat tätigen Domherren Philippus Olmen stammen.72 Soweit bekannt, war Bredenbach selbst nie in Livland gewesen.73 Fast bis zur Hälfte des Textes (bis 26r) ist Bredenbachs Werk weniger eine Chronik im klassischen Sinne als ein pro-katholisches Morallehr- und Rhetorikstück, in dem der Autor seine humanistische Bildung zu demonstrieren versucht. Allein die einleitende »Epistola« und das »Prooemium« – eine sehr allgemein gehaltene Abhandlung über Tugend und Sünden – nimmt bei dem 55 Blatt umfassenden Buch zehn Blätter ein. Auch im folgenden Text sind die eingeflochtenen historischen Ereignisse eher als pädagogische und moralisierende Exempla als als Geschichtsnarrativ zu verstehen. Auch der Sprachgebrauch des Chronisten ist völlig von seinen Vorbildern des italienischen Renaissancehumanismus geprägt, z. B. verwendet er manchmal »templum« statt »ecclesia« oder »praefectus« für die Klostervorstände.
Bredenbach beschreibt die Bilderstürme in den Dorpater Kirchen, die in der Marienkirche begannen und sich von dort zur Johanniskirche, zu den Dominikanerund Franziskanerklöstern und dann zu dem Kloster der Terziarinnen ausbreiteten. Nur das Zisterzienserinnenkloster blieb verschont (17v).74 Nach Vertreibung der meisten katholischen Geistlichen (»paucis exceptis«) übernahmen nach Bredenbachs Darstellung Rat und Bürgerschaft die kirchlichen Besitztümer und Einkünfte (14v). Diese Ereignisse datiert Bredenbach in das Jahr 1527, obwohl sie tatsächlich bereits in den ersten Monaten des Jahres 1525 stattfanden. Man kann also bezweifeln, ob die anderen Details seiner Beschreibung glaubwürdig sind. Oft scheint sich sein Text eher auf literarische Klischees zu stützen. Zum Beispiel wird die Vertreibung der Dominikaner und Franziskaner aus ihren Klöstern bis in die Einzelheiten identisch beschrieben. Darüber hinaus konnte der Chronist nicht wissen, was der Prior oder Guardian ihren Mitbrüdern zur Ermutigung sagten (13v-14r). Besser scheint Bredenbach über die Erstürmung des Domberges, die Plünderung der Domkirche und der Häuser der Domherren informiert gewesen zu sein (15v-17r), offensichtlich deswegen, weil sein Informant Olmen in der Rückschau darüber bessere Kenntnis hatte.
Laut Bredenbach plünderten die Bilderstürmer auch die orthodoxe Kirche der russischen Kaufleute in Dorpat (wie auch in Riga und Reval), was der Grund für den folgenden Krieg zwischen Russland und Livland gewesen sei (15r-15v). Der Autor führt einzelne Anekdoten oder Exempla auf, die die religiöse und moralische Inferiorität der Lutheraner zeigen sollten. Er interpretiert die Kriege zwischen den livländischen Mächten in den 1550er Jahren und dann den kurz danach einsetzenden russisch-livländischen Krieg als direkte Folge der Reformation, ja als eine Art Strafe für den – seiner Ansicht nach schändlichen – Glaubenswechsel. Die Verbreitung der »Irrlehre« sei die Folge der Bedrückung der einfachen Leute und der schlechten Lebensbedingungen des Volkes gewesen (21v-23r), was dann seinerseits ebenfalls mit dem Krieg bestraft worden sei.
Weil der Krieg der Reformation zeitlich folgte, sind die ursächlichen Zusammenhänge nachträglich stark von diesem beeinflusst worden. Ob der Glaubeswechsel für sich als wichtige Ursache des Krieges betrachtet werden kann, soll hier offen gelassen werden; dass die Glaubenssachen aber von Seiten Moskaus in das politische Kalkül einbezogen wurden, gilt als sicher.75 Unbestreitbar ist auch, dass die aus der Reformation hervorgegangene Konfrontation zwischen den verschiedenen Mächten – den Bischöfen, dem in verschiedene Parteien zersplitterten livländischen Zweig des Deutschen Ordens und den evangelisch gesinnten Städten – für Livland im Allgemeinen und für Dorpat als Bischofssitz und als Nachbar der Russen im Besonderen schlechte Perspektiven schuf.
Über Bredenbach kann man zusammenfassend sagen, dass er ein guter Erzähler war, sein Talent entfaltet sich aber erst im Zusammenhang mit seinen Beschreibungen der Kriegsereignisse. Obwohl seine Chronik zu einer der wichtigsten Quellen zur Reformation und ihrer Vorgeschichte in Dorpat gehört, spielt die Reformation selbst in seinem Werk nur eine Rolle der Einleitung für die Geschichte des livländischen Krieges. Zeitgenössisch, wenn auch nicht direkt von einem Augenzeugen stammend, ist die Beschreibung des Dorpater Bildersturms und anderer Ereignisse vom Januar 1525 von Sylvester Tegetmeyer (†1552), der seit Herbst 1522 in Riga predigte. Am 1. Februar 1525 kam er in Dorpat an, predigte hier bis zum 28. Februar und legte öffentlich den biblischen Propheten Maleachi in lateinischer Sprache aus (»lass Malachiam latine«).76 Wenn es in Dorpat Publikum für eine lateinische Vorlesung gab, müssen unter Tegetmeyers Zuhörern vor allem Geistliche gewesen sein.
Der im Stadtarchiv Tallinn aufbewahrte spätmittelalterliche Briefwechsel der Stadt Reval mit dem Dorpater Rat77 konzentriert sich zumeist auf Handelssachen und Rechtsangelegenheiten sowie auf die politische Zusammenarbeit zwischen den beiden livländischen Städten. Über Religionsfragen im Allgemeinen oder Reformationsereignisse im Besonderen erfährt man daraus äußerst wenig. Mehr erfährt man aus Briefen der Dorpater Bischöfe an den Rat und die Bürgerschaft Revals, wobei in erster Linie Konflikte berührt werden.78 Was die gewaltigen Ereignisse der Reformation anbetrifft, ist ein Brief der Stadt Dorpat an Reval von 4. Februar 1525 zu nennen. Hier wird über einen Konflikt zwischen der evangelisch gesinnten Stadt und dem bischöflichen Stiftsvogt Peter Stackelberg während der in Dorpat Anfang Januar 1525 stattgefundenen Gewalttaten berichtet. Gleichzeitig spricht der Rat Dorpats der Stadt Reval seinen Dank für von dort ausgesandte Kriegsknechte aus.79 Der Brief gibt lebendig wieder, wie aufgeheizt die Emotionen damals in Dorpat gewesen sein müssen und wie eng der Dorpater Rat zur Befriedung der Konflikte damals mit den Revalern zusammenarbeitete. Während des Sturms des Domberges wurden die Bischofskirche und die Häuser der Domherren geplündert. Der Stiftsvogt musste das Bischofsschloss räumen, welches dann von der Ritterschaft, dem Domkapitel und dem Rat gemeinsam in Verwaltung genommen wurde.80 Laut den erhaltenen Quellen entsteht der Eindruck, dass es sich damals um einen regelrechten »Bürgerkrieg« gehandelt hat, zu welchem es in anderen Städten Livlands keine Parallele gibt. Die Stadt Dorpat und der Bischof blieben Feinde bis zum Tode Blankenfelds im Jahre 1527.81
In seinem Schreiben an den Revaler Rat vom 30. Oktober 1525 stellte der Rat in Dorpat 14 Punkte vor, welche der Neuorganisation des Kirchenlebens und der Stabilisierung der Beziehungen zwischen Stadt und Bischof dienen sollten.82 Schon auf dem Anfang Juli 1525 in Wolmar abgehaltenen Landtag trugen die Sendboten Dorpats ihre im Landtagsrezess nicht näher beschriebenen Klagepunkte gegen Blankenfeld vor; damals blieb die Sache aber ohne Lösung.83 Im Herbst 1525 traf der Dorpater Rat sich mit den Stiftsvasallen und dem Domkapitel und legte diesen einige Artikel vor, welche die Ritterschaft und die Domherren aber nicht annehmen wollten.84 Ob es um diejenigen 14 Punkte ging, die – wie oben beschrieben – dem Revaler Rat vorgelegt worden waren, ist nicht sicher, weil sich die genannte Dorpater Versammlung mit Ritterschaft und Domkapitel nicht genau datieren lässt. Möglich ist auch, dass der Dorpater Rat nach Ablehnung der Artikel diese neu bearbeitet und dann unmittelbar nach der Versammlung nach Reval geschickt hatte.
Obwohl die 14 Dorpater Punkte im Vergleich mit den Vorgängen in anderen livländischen Städten nichts besonderes Erstaunliches enthalten, ist der Brief doch eine der wenigen Quellen, welche direkt auf die Neuordnung des Dorpater Kirchenlebens unmittelbar nach den Bilderstürmen eingeht. Genannt sind hier v. a. die Einführung des evangelischen Gottesdienstes, die Aufhebung der Klöster sowie die Übernahme ihrer Einkünfte und Besitzungen für die Armenfürsorge und schließlich die Meinung, der Bischof solle zukünftig keine weltliche Macht mehr ausüben. Was die Armenfürsorge angeht, wurden die Armen u. a. im ehemaligen Konvent der Franziskanerinnen versorgt, wobei dafür die Rente des Konvents verwendet wurde.85 Über kirchliche Angelegenheiten in Dorpat in den Jahren 1530-1531 berichten dann noch weitere Briefe Revals an Dorpat, in welchen es dann zumeist über die Besetzung der Prädikanten- bzw. Pastorenstellen geht.86 Hier kommen nicht nur die engen Kontakte der Städte im Bereich des Kirchenlebens zum Ausdruck, sondern diese zumeist nicht edierten Quellen könnten einiges zur Aufhellung der frühen Reformationsgeschichte Dorpats beitragen. Auch die ältesten, aus den Jahren 1547-1555 stammende Dorpater Ratsprotokolle erhalten einige Angaben und Ordnungen bezüglich des Kirchenwesens;87 es handelt sich hier aber bereits um eine Zeit, in der die erste Reformationswelle in der Stadt bereits fast 20 Jahre vorüber war.
VI Fazit
In der Forschung zur Reformation in Livland steht die politische Geschichte im Zentrum, was im Wesentlichen mit der Eigenart der Quellen zu erklären ist, aus welchen sich inhaltliche Glaubensfragen nur in begrenztem Umfang ausfiltern lassen. Daneben haben aber auch das nationale Selbstbewusstsein der baltischen Deutschen und der große Einfluss der deutschbaltischen Historiographie die spätere Forschung bestimmt. Einen besonderes großen Einfluss haben hier die Arbeiten und die Persönlichkeit von Leonid Arbusow ausgeübt, v. a. sein Interesse an den Akten der livländischen Ständetage, welche die Hauptquellen für die historische Beschreibung der Landespolitik darstellen. Das Gesagte gilt exemplarisch auch für die Geschichte Dorpats. Die Quellen erwecken zwar den Eindruck, dass die für die livländische Reformation charakteristische Konfrontation der Vasallen und Städte mit den Prälaten auch für die Bischofsstadt Dorpat wichtige Voraussetzungen für die Reformationsereignisse schaffen konnte; als befriedigende Erklärung für den Glaubenswechsel in der Stadt genügt diese Tatsache jedoch nicht.
Wenn man von den Besonderheiten der mittelalterlichen Religiosität und des Geisteslebens in Livland ausgeht (kaum Zeugnisse von Ketzerei, bescheidener Anteil der volkssprachlichen Frömmigkeitsliteratur, komplizierte Sprachsituation, welche u. a. den Großteil der Bevölkerung weitgehend unberührt von seelsorgerischer Betreuung ließ), darf man annehmen, dass die Reformationsideen in Livland während der 1520er Jahre inhaltlich nur in relativ begrenzten Kreisen wahrgenommen wurden. Soweit bekannt, stehen die Dorpater Reformationsereignisse in erster Linie für die politische Machtergreifung durch eine selbstbewusste Stadt und erst in zweiter Linie für eine Erneuerung des Glaubens. Diese durch die Quellenlage bestimmte Sichtweise auf die politische Dimension der Dorpater Reformation muss freilich nicht so einseitig bleiben. Die Quellen, auch wenn sie spärlich sind und in ihrer äußeren Gestalt oft unattraktiv, sind – zumindest was die reine Kirchengeschichte betrifft – noch nicht ganz ausgeschöpft. Vielleicht ist in der Forschungstradition in erster Linie nicht die Darstellung des gesamten Weges der Durchsetzung der Reformation in Livland wichtig gewesen, sondern es erschien bedeutsamer, ihren relativ schnellen Durchbruch aufzuzeigen und damit alles, was ihre Interpretation als Erfolgsgeschichte unterstützte. Ähnlich wie der russisch-livländische Krieg und der damit verbundenen Untergang des frühneuzeitlichen Livlands die Darstellung der politischen Ereignisse in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beeinflusst haben, so blieb die Reformationsforschung Livlands lange unter dem Einfluss der Reformationsgeschichte als »Siegesgeschichte«.
1 Nordestland wurde im Jahr 1219 von dem dänischen König Waldemar II. erobert, von Waldemar IV. 1346 aber weiter an den Deutschen Orden verkauft. Der Bischof von Reval blieb jedoch, wie zuvor, formell Suffraganbischof von Lund, vgl. Niels SKYUM-NIELSEN: Estonia under Danish Rule. In: Danish Medieval History: New Currents/ hrsg. von Niels Skyum-Nielsen. Lund u. a. 1981, 112-135, hier 117; Richard HASSELBLATT: Die Metropolitanverbindung Revals mit Lund. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands 14 (1890), 461-466.
2 Zum mittelalterlichen Livland als Geschichtsregion vgl. Matthias THUMSER: Das Baltikum im Mittelalter: Strukturen einer europäischen Geschichtsregion. Jahrbuch des baltischen Deutschtums 2011. Lüneburg 2010, 17-30; Marek TAMM: Inventing Livonia: The Name and Fame of a New Christian Colony on the Medieval Baltic Frontier. Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 60 (2011), 186-209.
3 Tilman BREDENBACH: Historia belli Livonici, quod magnus Moscovitarum dux contra Livones gessit. Antwerpiae 1564, 8r.
4 Zu Hilten vgl. Leonid ARBUSOW: Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland. Leipzig u. a. 1919-1921, 160-162; Paul JOHANSEN: Johann von Hilten in Livland: ein franziskanischer Schwarmgeist am Vorabend der Reformation. Archiv für Reformations-Geschichte 1/2 (1939), 24-50. Vgl. auch Michael STOLLEIS: Margarethe und der Mönch: Rechtsgeschichte in Geschichten. München 2015, 15-29.
5 Albert Suerbeer, der Erzbischof von Riga, verfasste eine Heiligenlegende über den heiligen Edmundus, Erzbischof Friedrich von Pernstein, ein Franziskaner, eine Franziskus-Legende, Erzbischof Silvester Stodewescher, ehemaliger Professor der Universität Leipzig, mehrere Kommentare zu Aristoteles, vgl. dazu Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 75. Siehe auch: Leonid ARBUSOW: Das metrische Bibelsummarium des Dominikaners Otto de Riga vom Jahre 1316. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1911. Riga 1913, 403-409.
6 Die mittelalterliche Schulgeschichte Livlands ist eher durch die Konflikte bekannt. Zum sog. »Schulstreit« in Reval vgl. Bernd-Ulrich HERGEMÖLLER: Der Revaler Kirchenstreit (1424-1428). Hansische Geschichtsblätter 109 (1991), 13-41; Tiina KALA: Jutlustajad ja hingede päästjad: Dominiiklaste ordu ja Tallinna Püha Katariina konvent. Tallinn 2013, 243-282. Zum Rigaer Schulstreit vgl. LIV-, EST- UND KURLÄNDISCHES URKUNDENBUCH/ hrsg. von Friedrich Georg von Bunge u. a., 1. Abt., Bd. 3. Reval 1857, Nr. 1299-1301; Carl Eduard NAPIERSKY: Einiges aus der älteren Geschichte der öffentlichen Bildungs-Anstalten Riga’s. Mittheilungen (!) aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- (!) und Kurlands 5 (1850), 275-308, hier 276.
7 Vor 1400 sind etwa 50 an den Universitäten immatrikulierte Livländer nachweisbar, meistens Geistliche. Die Laien überwogen in der Zahl der Studierenden erst im 16. Jahrhundert. Zwischen 1268-1565 hat Leonid Arbusow etwa 1000 livländische Studenten an Universitäten gezählt, besonders am Anfang des 16. Jahrhunderts, vgl. Leonid ARBUSOW: Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Dritter Nachtrag: Vom Ende des 12. bis in das letzte Drittel des 16. Jahrhunderts. Mitau 1913, 357-366 (Separatabdruck aus dem Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik [1911/12]). Unmittelbar nach der Reformation ist der Zahl der Studierenden ein wenig gesunken; während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts studierte etwa die Hälfte der livländischen Studenten – die meisten aus Riga – in Rostock, vgl. Arvo TERING: Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798. Tartu 2008, 297.
8 Siehe eine allgemeine Übersicht über die livländischen Dominikanerkonvente bei Gertrud VON WALTHER-WITTENHEIM: Die Dominikaner in Livland im Mittelalter: die Natio Livoniae. Romae 1938.
9 La Congrégation de Hollande ou la réforme dominicaine en territoire bourguignon 14651515/ hrsg. von Albert de Meyer. Liège 1943, 122.
10 Kala: Jutlustajad ja hingede päästjad … (wie Anm. 6), 123; 203; 205; 368.
11 Vgl. dazu Nicolaus BUSCH: Die Geschichte der Rigaer Stadtbibliothek und deren Bücher: nachgelassene Schriften, redigiert von Leonid Arbusow. Riga 1937; Tiina KALA: Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides: Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat. Tallinn 2001, 106-118.
12 Aija TAIMIŅA: 15. gādsimta metāla griezuma jeb »skrošu« gravīras un Rīgas patricieša Reinholda Soltrumpa grāmatu likteņi. Mākslas vēsture un Toerija 2 (2004), 5-19.
13 Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch … (wie Anm. 6), 2. Abt., Bd. 3, Riga u. a. 1914, Nr. 178.
14 Über Reinold Grist und seine Bücher vgl. Juhan KREEM: Reinold Grist ja tema raamatukogu: Pilk 16. sajandi esimese poole Tallinna vaimsetele võimalustele. In: Lugemise kunst/ hrsg. von Piret Lotman. Tallinn 2011, 151-165.
15 Die berühmteste dieser Sammlungen ist die Bücherkollektion (von etwa 70-100 Titeln) des Rigaer Erzbischofs Friedrich von Pernstein, der in Avignon starb und seine Bücher überwiegend der päpstlichen Kurie hinterließ, vgl. Nele RAND: Millest kõneleb Riia peapiiskopi Friedrich von Pernsteini (1304-1341) raamatukogu? Tuna 8,2 (2005), 14-22; Volker HONEMANN: Facetten der Literatur- und Geistesgeschichte Rigas im Mittelalter. In: Ders: Literaturlandschaften: Schriften zur deutschsprachigen Literatur im Osten des Reiches. Frankfurt am Main 2008, 383-398, hier 387-391.
16 Siehe den Brief von Petrus Usenus an Marcus Tirbach (1. Juli 1510) in: Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch … (wie Anm. 6), 2. Abt., Bd. 3, Nr. 842.
17 Zum Begriff »undeutsch« vgl. Dzintra LELE-ROZENTĀLE: Deutsch und undeutsch in livländischen Quellen als soziales und linguistisches Phänomen. In: Von Kotzebue bis Fleming: Sprach-, Literatur- und Kulturkontakte im Baltikum/ hrsg. von Mari Tarvas. Würzburg 2012, 199-212; Wilhelm LENZ: Undeutsch: Bemerkungen zu einem besonderen Begriff der baltischen Geschichte. In: Aus der Geschichte Alt-Livlands: Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag/ hrsg. von Bernhart Jähnig; Klaus Militzer. Münster 2004, 169184; Tiina KALA: Gab es eine »nationale Frage« im mittelalterlichen Reval? Forschungen zur baltischen Geschichte 7 (2012), 11-34.
18 Anders als z. B. in Polen oder in den wendisch-slawischen Territorien kam es in Livland bis in die Neuzeit hinein zu keiner gegenseitigen Assimilierung der verschiedenen Ethnien.
19 Zu den Beschreibungen Livlands in der »Cosmographia« von Sebastian Münster und in der »Wandalia« von Albertus Krantz vgl. Juhan KREEM: Sebastian Münster and »Livonia illustrata«: Information, Sources and Editing. In: Festschrift für Vello Helk zum 75. Geburtstag: Beiträge zur Verwaltungs-, Kirchen- und Bildungsgeschichte des Ostseeraumes/ hrsg. von Enn Küng; Helina Tamman. Tartu 1998, 149-168. Als der letzte Beschreiber der Sprachsituation Livlands im 18. Jahrhundert kann August Wilhelm Hupel, Pastor zu Oberpahlen (Põltsamaa), genannt werden, vgl. August Wilhelm HUPEL: Topographische Nachrichten von Lief- (!) und Ehstland (!), Bd. 1. Riga 1774, 64; 140-141; 146-148.
20 Vgl. Tiina KALA: Rural Society and Religious Innovation: Acceptance and Rejection of Catholicism among the Native Inhabitants of Medieval Livonia. In: The Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier/ hrsg. von Alan V. Murray. Farnham 2009, 169-190, hier 184-189; Kala: Gab es eine »nationale Frage« … (wie Anm. 17), 26-27.
21 Vgl. Siiri REBANE: Geschichte des Dominikanerklosters in Tartu (Dorpat). In: Estnische Kirchengeschichte im vorigen Jahrtausend = Estonian Church History in the Past Millennium/ hrsg. von Riho Altnurme. Kiel 2001, 55-60, hier 59; Gabriel M. LÖHR: Die Gewohnheiten eines mitteldeutschen Dominikanerklosters aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Archivum Fratrum Praedicatorum 1 (1930/31), 87-105, hier 155; Kala: Jutlustajad ja hingede päästjad … (wie Anm. 6), 208.
22 Vgl. die Liste älterer estnisch- und lettischsprachiger Texte: Kristiina ROSS; Pēteris VANAGS: Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages – Preface. In: Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages/ hrsg. von Kristiina Ross; Pēteris Vanags. Frankfurt am Main 2008, 7-13, hier 11-13. Siehe auch Pēteris VANAGS: Latvian Texts in the 16th and 17th Centuries: Beginnings and Development. In: Ebd, 173-197, hier 173; Toomas PÕLD: Kullamaa katekismuse lugu: Eestikeelse katekismuse kujunemisest 1532-1632. Tartu 1999.
23 Tiina KALA: Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Estland. In: Manuscripta Germanica: deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas/ hrsg. von Astrid Breith u. a. Stuttgart 2012, 13-27.
24 Esten und Letten kommen unter den Geistlichen in den Ostseegouvernements erst im 19. Jahrhundert vor. Der erste belegte Este als Pastor war Johann Ignatius (1719-1774), Pastor zu Marienma (Märjamaa) und Probst zu Wiek; er gilt aber als große Ausnahme, und der Preis für seinen sozialen Aufstieg war Assimilation durch »Verdeutschung«, vgl. Ilje PIIR: Edulugu XVIII sajandist: Talupoja perest pastoriks. Tuna 19,1 (2016), 83-87.
25 Zu dieser Haltung und der entsprechenden Literatur vgl. Tiina KALA: Kirikuelu ümberkorraldamine Tallinnas 1520. aastatel ning selle majanduslikud ja sotsiaalsed tagamaad. Tuna 10,3 (2007), 10-26, hier 10 f.
26 Vgl. Juhan KREEM: Der deutsche Orden und die Reformation in Livland. In: The Military Orders and the Reformation: Choices, State Building and the Weight of Tradition/ hrsg. von Johannes A. Mol; Klaus Militzer; Helen J. Nicholson. Utrecht 2006, 43-57, hier 43.
27 Vgl. Juhan KREEM: Die livländische Reformation im Spiegel der estnischen Geschichtswissenschaft. In: Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen; Stadt, Land und Konfession 1500-1721, Teil 4/ hrsg. von Matthias Asche; Werner Buchholz; Anton Schindling. Münster/ Westfalen 2012, 99-121, hier 100-103. Zur politischen Agenda des baltischen Deutschtums aus der Sicht des deutschbaltischen Historikers Carl Schirren vgl. Juhan KREEM: 19. sajandi pilk reformatsioonile: Rudolf von zur Mühleni maal »Tartu linn ja stifti rüütelkond uuendavad liidulepingut 1522. aastal« / Ein Blick aus dem 19. Jahrhundert auf die Reformation: Rudolf von zur Mühlens Gemälde »Die Stadt Dorpat und die Stiftsritterschaft erneuern das Schutz- und Trutzbündnis im Jahre 1522«. Eesti Kunstimuuseumi Toimetised / Schriften des Estnischen Kunstmuseums 10 (2015), 381-411, hier 403-405.
28 Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4).
29 In der deutscher Historiographie z. B. Alfred RITSCHER: Reval an der Schwelle zur Neuzeit. Teil I: Vom Vorabend der Reformation bis zum Tode Wolters von Plettenberg; Teil II: Vom Tode Wolters von Plettenberg bis zum Untergang des Deutschen Ordens in Livland (1535-1561). Bonn 1998-2001; Joachim KUHLES: Die Reformation in Livland: Religiöse, politische und ökonomische Wirkungen. Hamburg 2007.
30 Vgl. Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), V-VII. Zur historiographischen Einschätzung vgl. Bernhart JÄHNIG: Konzeption und Standort von Leonid Arbusows »Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland«. In: Leonid Arbusow (1882-1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland/ hrsg. von Ilgvars Misāns; Klaus Neitmann. Köln u. a. 2014, 123-133, v. a. 123-125.
31 Klaus NEITMANN: Das wissenschaftliche Lebenswerk Leonid Arbusows. In: Leonid Arbusow (1882-1951) und die Erforschung … (wie Anm. 30), 19-77, hier 22.
32 Otto FREYMUTH: Tartu linn orduajal. In: Tartu: Tartu linna-uurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud. Tartu 1927, 12-43; Georg VON RAUCH: Stadt und Bistum Dorpat zum Ende der Ordenszeit. Zeitschrift für Ostforschung 24,4 (1975), 577-626.
33 Vgl. z. B. Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 325. Über die Briefe des Erasmus von Rotterdam an Andreas Knopken vgl. ebd, 177 f. Zu den bibliographischen Angaben über Lutherbriefe an Riga, Reval und Dorpat vgl. Martin KLÖKER: Literarisches Leben in Reval in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (1600-1657): Institutionen der Gelehrsamkeit und Dichten bei Gelegenheit. Teil 2: Bibliographie der Revaler Literatur. Tübingen 2005, 49f. (Nr. 004A-004C). Martin Luther an Reval: TLA (Tallinna Linnaarhiiv = Stadtarchiv Tallinn), Best. 230, Verz. 1-I, Nr. 1012a (3. Mai 1531) und Nr. 1020a (9. Juli 1533); Philipp Melanchthon an Reval: TLA, Best. 230, Verz. 1-I, Nr. 1016b (8. Aug. 1532).
34 Vgl. z. B. Matthias ASCHE; Werner BUCHHOLZ; Anton SCHINDLING: Prolegomena zu einer Reformations- und Konfessionsgeschichte der Baltischen Lande. In: Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen; Stadt, Land und Konfession 1500-1721, Teil 1/ hrsg. von Matthias Asche; Werner Buchholz; Anton Schindling. Münster/Westfalen 2009, 29-43.
35 TARTU: TARTU LINNA-UURIMISE toimkonna korraldatud ja toimetatud. Tartu 1927; TARTU AJALUGU/ hrsg. von Raimo Pullat. Tallinn 1980; TARTU: AJALUGU JA KULTUURILUGU/ hrsg. von Heivi Pullerits. Tartu 2005.
36 Von dem estnischen Historiker Margus Laidre ist diese Periode sogar als der »Hundertjährige Krieg der nordischen Länder in Livland« bezeichnet worden, vgl. Margus LAIDRE: Domus belli: Põhjamaade Saja-aastane sõda Liivimaal 1554-1661. Tallinn 2015.
37 Zu Gilbert von Lannoy’s Reise durch Livland im Herbst und Winter 1413 auf 1414 vgl. ARCHIV FÜR DIE GESCHICHTE LIV-, ESTH- (!) UND CURLANDS/ hrsg. von Friedrich Georg von Bunge, Bd. 5. Dorpat 1847, 167-172; Hain REBAS: Die Reise des Ghillebert de Lannoy in den Ostseeraum 1413/14: Motive und Begleitumstände. Hansische Geschichtsblätter 101 (1983), 29-41; Sulev VAHTRE: Tartu 15. sajandi reisikirjeldustes. In: Tartu ja ülikool/ hrsg. von Jaan Eilart. Tallinn 1983, 14-27, v. a. 19.
38 Vgl. Veiko BERENDSEN; Margus MAISTE: Rahvastik. In: Tartu: Ajalugu ja kultuurilugu … (wie Anm. 35), 109-133, hier 110 f.
39 [Theodor BEISE]: Dorpat am Schlusse des Mittelalters. Das Inland: Eine Wochenschrift für Liv-, Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur 25,1 (1860), 5.
40 Kaur ALTTOA: Kloostritest keskaegses Tartus. Ajalooline ajakiri 126,4 (2008), 295-316. Vgl. auch die Kurzangaben über die kirchlichen Institutionen Dorpats von Martin KLÖKER; Krista KODRES; Raimo RAAG: Legende zur Karte »Dorpat/Tartu im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung«. In: Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen; Stadt, Land und Konfession 1500-1721, Teil 3/ hrsg. von Matthias Asche; Werner Buchholz; Anton Schindling. Münster/Westfalen 2011, 100-102.
41 Tõnis LUKAS: Tartu toomhärrad 1224-1558. Tartu 1998, 132 f.
42 Anu MÄND: Haapsalu, Tartu ja Tallinna toomkirikute altarid keskajal. Kunstiteaduslikke Uurimusi 25,1-2 (2016), 103-138.
43 Tartu: Ajalugu ja kultuurilugu … (wie Anm. 35), 51 f.
44 Von Rauch: Stadt und Bistum Dorpat … (wie Anm. 32), 583-587; Ain MÄESALU; Rünno VISSAK: Muinas- ja keskaeg. In: Tartu: Ajalugu ja kultuurilugu … (wie Anm. 35), 13-28, hier 24-26; EESTI AJALUGU. Teil 2: Eesti keskaeg/ hrsg. von Anti Selart. Tartu 2012, 160 f.
45 Ain MÄESALU: Emailbemalte Glasbecher aus Tartu. In: The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology/ hrsg. von Rünno Vissak; Ain Mäesalu. Tartu 1999, 75-84.
46 Vgl. Priit RAUDKIVI: Vana-Liivimaa maapäev. Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu. Tallinn 2007.
47 Pärtel PIIRIMÄE: Riik, maaisandad ja seisused: Varauusaegsete võimustruktuuride kujunemisest Vana-Liivimaa piiskopkondades. Kleio/Ajaloo ajakiri 13,3 (1995), 16-25, hier 19-23.
48 Gleichzeitig knüpfte Moskau Kontakte zu den westeuropäischen Ländern, während der Kaiser zu Beginn des 16. Jahrhunderts versuchte, im Großfürsten einen Bundesgenossen gegen den König von Polen zu finden, vgl. Anti SELART: Johann Blankenfeld und Russland. In: Die baltischen Länder und Europa in der Frühen Neuzeit/ hrsg. von Norbert Angermann; Karsten Brüggemann; Inna Põltsam-Jürjo. Wien 2015, 105-129, v. a. 107-109.
49 Jüri KIVIMÄE: Die Rolle von Dorpat (Tartu) im hansischen-russischen Handel im Spätmittelalter. Steinbrücke: Estnische Historische Zeitschrift 1 (1998), 9-17, hier 12.
50 Kreem: 19. sajandi pilk reformatsioonile … (wie Anm. 27), 395.
51 Friedrich BIENEMANN: Die Anfänge unserer Reformation im Lichte des revaler (!) Rathsarchivs (!). Baltische Monatsschrift 29 (1882), 431-460, hier 424.
52 Selart: Johann Blankenfeld … (wie Anm. 48), 121.
53 Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 507 f.
54 Näheres bei Selart: Johann Blankenfeld … (wie Anm. 48).
55 Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 215-219.
56 Kreem: 19. sajandi pilk reformatsioonile … (wie Anm. 27), 400-406.
57 Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 188-189; Kala: Rural Society and Religious Innovation … (wie Anm. 20), 184-189.
58 Zu Grundmaterialien für Knopkens Predigten in Riga vgl. Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 195.
59 Ebd, 209-211.
60 Schreiben des Revaler Rates an den livländischen Ordensmeister Wolter von Plettenberg, 20. Juni 1527, vgl. Abdruck bei Gotthard VON HANSEN: Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals. Reval 1873, 130-138, hier 134: »Szyn auer gedachte Moncke tho nener disputacion gesynnet geweszen, szick mith erem houede, dem Paweste, und szinen geistlicken rechten entschuldingende, wo eth en dardurch vorbaden van gelouen mith ymandes vth godtlicker schrifft tho disputeren …«.
61 Auch Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 325 f, lässt die Einzelheiten im Dunkeln.
62 TLA, Best. 230, Verz. 1, BD 1 V, 105r (Dorpat an Reval): »Dusse gewalt und unrecht uns und den unsen so weldichlicken und werevelicken in vryer Stadt geschen …«.
63 Wilhelm BRACHMANN: Die Reformation in Livland ein Beitrag zur Geschichte Livlands sowohl als der Reformation. Mittheilungen (!) aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- (!) und Kurlands 5 (1850), 1-265, v. a. die Beilage: Melchior Hofman’s Brief an die Dorpater (258-265, hier 261, § 6). Vgl. dazu Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 434. Zu Hofmanns Brief an Livland aus dem Jahre 1526 vgl. Klöker: Literarisches Leben … (wie Anm. 33), 50 (Nr. 005).
64 Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 203 f. Das Schreiben Blankenfelds an Reval: TLA, Best. 230, Verz. 1, BB 60 VII, 32r-33r.
65 Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 206.
66 Leonid ARBUSOW: Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, Bd. 3 (1494-1535). Riga 1910, Nr. 166 (Art. 10); Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 364.
67 Zur Wirkung des Krieges auf die livländische Geschichtsschreibung, besonderes in der Chronistik, vgl. Janet LAIDLA: Sõja mõjust ajalookirjutusele varauusaegsel Eesti-, Liivi- ja Kuramaal. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 39 (2011), 7-39.
68 FRANZ NYENSTÄDT’S LIVLÄNDISCHE CHRONIK/ hrsg. von Gotthard Tobias Tielemann. Riga u. a. 1839, 1-166, hier 40 f. Zu Nyenstede und zur livländischen Chronistik seiner Zeit vgl. Katri RAIK: Eesti- ja Liivimaa kroonikakirjutuse kõrgaeg 16. sajandi teisel poolel ja 17. sajandi alul. Tartu 2004.
69 DIONYSIUS FABRICIUSE LIIVIMAA AJALOO LÜHIÜLEVAADE / Dionysii Fabricii Livonicae historiae compendiosa series/ hrsg. von Kai Tafenau; Enn Tarvel. [Tartu 2010], 162: »Ac quod mirandum magis, Derpati nimirum primo, anno 1538, non Rigae Revaliaeve aut aliis in maritimis Livoniae civitatibus, hujus infelicissimae haeresis semina sparsa, praesente Antistite ibidem Hermanno Bey: idque non a viro literato, verum Pellione quodam, homine inepto ac rudi, Michael nomine, qui Noriberga huc in Livoniam, nescio a Deo ne? an ab alio Prodromus Diaboli missus venerat …«. Zu Fabricius vgl. auch Enn TARVEL: Väike õiendus Dionysius Fabriciuse teemal. Tuna 13,4 (2010), 150.
70 Zur Livland betreffenden Chronistik vgl. Arved VON TAUBE: Der Untergang der livländischen Selbständigkeit: Die livländische Chronistik des 16. Jahrhunderts. In: Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung/ hrsg. von Georg von Rauch. Köln u. a. 1986, 21-41; Gottfried ETZOLD: Die Geschichtsschreibung der polnisch-schwedischen Zeit. In: Ebd, 43-62.
71 Bredenbach: Historia belli Livonici … (wie Anm. 3). Vgl. die zusammenfassende Übersicht über die Quellen der frühen Reformationsereignisse in Dorpat, darunter auch über die Chronik von Tilman Bredenbach, von Richard HAUSMANN: Die Monstranz des Hans Ryssenberg in der K. Ermitage zu St. Petersburg. Mittheilungen (!) aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands 17 (1900), 165-212, hier 187-192, darunter einen Auszug aus den Prozessakten des Dorpater Domherren Niederhof im Jahre 1530 beim Reichskammergericht gegen die Stadt Dorpat (ebd, 192).
72 Bredenbach: Historia belli Livonici … (wie Anm. 3), 14v: »… quales venerandus vir D. Philippus Olmen, qui horum fere omnium spectator, & ut historice ea conscriberem michi auctor fuit, plerosque novit«.
73 Sulev VAHTRE: Tilman Bredenbachi Liivimaa sõdade ajalugu. Ajalooline Ajakiri 112/113 (2001), 15-24, hier 15.
74 In ganz Livland blieben Mönchs- wie Nonnenklöster der Zisterzienser während der Reformation verschont und gingen meistens erst im russisch-livländischen Krieg oder sogar später, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, zugrunde, vgl. Wolfgang SCHMIDT: Die Zisterzienser im Baltikum und in Finnland. Helsingfors 1941, 117-120; 150-151; 173-175; 187-188; 192; 234-238.
75 Vgl. Anti SELART: Der Dorpater Priestermärtyrer Isidor und die Geschichte Alt-Livlands im 15. Jahrhundert. Ostkirchliche Studien 48 (1999), 144-162; Anti SELART: Die Reformation in Livland und konfessionelle Aspekte des livländischen Krieges. In: Leonid Arbusow (1882-1951) und die Erforschung … (wie Anm. 30), 339-358.
76 Friedrich BIENEMANN: Sylvester Tegetmeier’s Tagebuch. Mittheilungen (!) aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands 12 (1880), 502-505, hier 503 f.
77 Die Briefe des Dorpater Rats an Reval: TLA, Best. 230, Verz. 1, BD 1.
78 Die Briefe von Bischof Johannes Blankenfeld an Reval: TLA, Best. 230, Verz. 1, BB 60 VII.
79 TLA, Best. 230, Verz. 1, BD 1 V, 105r-105v. Der Revaler Rat berichtet dem Rat von Riga über die Dorpater Ereignisse bereits am 15. Januar 1525: TLA, Best. 230, Verz. 1, Aa 12, 89r.
80 Vgl. Hausmann: Die Monstranz des Hans Ryssenberg … (wie Anm. 71), 192.
81 Freymuth: Tartu linn orduajal … (wie Anm. 32), 38.
82 TLA, Best. 230, Verz. 1, BD 1 V, 109r. Die unterstützende Antwort des Revaler Rates: TLA, Best. 230, Verz. 1, Aa 12, 95v-96r (6. November 1525). Zur Stimmung gegenüber dem Bischof in Dorpat im Jahre 1525 vgl. Arbusow: Die Einführung der Reformation … (wie Anm. 4), 436 f.
83 Arbusow: Akten und Rezesse … (wie Anm. 66), Nr. 207 (Art. 3-4; 19-22).
84 Ebd, Nr. 213.
85 TLA, Best. 230, Verz. 1, BD 1 V, 127r.
86 Ebd, Aa 12, 130r-130v (»An den Rath tho Darpthe up her Harmen Marsouwen togeschickede breue«, 31. Oktober 1530); 130v-132r (»An eyn Radt tho Darpthe van der vocation Hern Simon Wanrat tom predickampthe«, nach 30. Oktober 1530); 137v-138r (»An eynen er[baren] radt tho Derrpthe van Magister Simon Wanrats wegenn«, 31. Mai 1531); 138v-139r (»An den Rat tho Darpthe Magister Simon Wandradts wegen«, 31. Mai 1531).
87 DIE EVANGELISCHEN KIRCHENORDNUNGEN DES XVI. JAHRHUNDERTS/ hrsg. von Emil Sehling, Bd. 5. Leipzig 1913, 17-31.