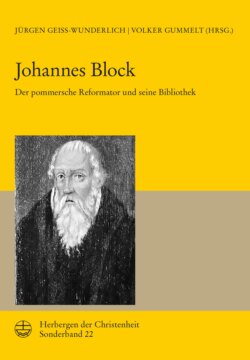Читать книгу Johannes Block - Группа авторов - Страница 13
Die Humanismusrezeption im Königreich Schweden im 16. Jahrhundert Von Outi Merisalo
ОглавлениеDieser Artikel wird die Anfänge der Humanismus und der Reformation im Königreich Schweden des 16. Jahrhunderts erörtern, mit besonderer Berücksichtigung des (Groß-)Herzogtums Finnland, wo auch der späterer Barther Reformator Block als Prediger des Wiburger Schlosses eine gewisse Rolle einnahm.
Zur Terminologie: Der Terminus »Herzogtum Finnland« wird hier benutzt, um eine der historischen Provinzen des Königreiches Schweden zu bezeichnen. Die Ausdehnung dieser Provinz zwischen dem 12. und dem 17. Jahrhundert stimmte natürlich mit der Ausdehnung des heutigen Staatsgebietes von Finnland nicht überein. Herzöge von Finnland gab es im 13. bis 14. und dann wieder seit dem 16. Jahrhundert. Von 1581 bis 1809, dem Jahr der Eingliederung ganz Finnlands ins russische Kaiserreich, war der König von Schweden auch Großfürst von Finnland, und Finnland war ein Großfürstentum (lat. »Magnus Ducatus«). Die Grenzen des Herzogtums bzw. Großfürstentums wurden zwischen dem 15. und der Mitte des 17. Jahrhunderts mehrmals verschoben, vom Frieden von Teusina (russ. Tjawsino, finn. Täyssinä) 1595 bis zu jenem von Stolbowo 1617. Seit dem karelischen Kreuzzug von Torkel Knutsson im Jahre 1293 war das im Norden der karelischen Landenge gelegene Wiburg (finn. Viipuri, schwed. Viborg, russ. Vyborg), das sich schnell zu einer internationalen Handelsstadt mit einer Gemeinschaft aus dem Heiligen Römischen Reich stammender deutschsprachiger Kaufleute entwickelte, die südöstliche Grenzfestung des schwedischen Königreiches. Im 16. Jahrhundert gelang es Schweden, sich auch Est- und Livland einzuverleiben.1
I Humanismus und Reformation
Die Anfänge des Humanismus im Königreich Schweden gehen zurück ins 15. Jahrhundert. Die am stärksten von dem neuen Kulturparadigma geprägte Persönlichkeit ist Kort Rogge, Reichskanzler und Bischof von Strängnäs (ab 1479). Nach Studien in Leipzig (1446-1449, Abschluss als »baccalaureus artium«) verbrachte er fünf Jahre in Perugia und wurde »doctor iuris canonici« (1460).2 Nach der Rückkehr in die Heimat machte er eine glänzende kirchlich-politische Karriere. Seine Bibliothek, die noch heute in Strängnäs aufbewahrt ist, bezeugt seine authentischen humanistischen Interessen.3 Obwohl Kort Rogge Kanoniker des Domkapitels zu Turku/Åbo und Vikar in Kirkkonummi/Kyrkslätt (ab 1460) war, hat er die kulturellen Verhältnisse in der östlichen Hälfte des schwedischen Königreiches, das heißt im Herzogtum Finnland, wohl nicht beeinflusst. Damit lassen sich – trotz mehrerer Geistlicher, die im 15. Jahrhundert in Italien (Neapel, Rom und Bologna) studierten – im Herzogtum zu dieser Zeit noch keine humanistischen Interessen nachweisen.
Punktuelle Neuanfänge gab es weiterhin nur in Schweden, etwa Anfang des 16. Jahrhunderts, als der spätere Erzbischof von Uppsala, Gustav Trolle, in Köln sogar den Vorlesungen des Gräzisten Johannes Caesarius von Jülich beiwohnte und dazu die griechische Grammatik von Emanuel Chrysoloras erwarb.4 Der humanistisch geprägte Ausbildungsweg des späteren Reformators Schwedens, Olavus Petri, ging von der Stadtschule in Örebro über die Universitäten von Uppsala, Rostock und Leipzig nach Wittenberg, wo er 1518 die Magisterwürde in Philosophie erlangte.5 Außer Theologie, wohl bei Luther, studierte er auch Griechisch bei Melanchthon, der 1518 nach Wittenberg gelangt war.6
Der erste authentisch humanistische aus dem Herzogtum Finnland entstammende Gelehrte ist Petrus Särkilahti. Nach einem ersten Studium an der Domschule von Turku wurde er für das Wintersemester 1516/1517 in Rostock immatrikuliert.7 Im Jahre 1517 ist er schon an der Universität Löwen als »Petr. Sarquelayx de Fynlandia« anwesend.8 Dort war inzwischen auch Erasmus angekommen.9 Von Särkilahtis weiterem Werdegang ist leider wenig bekannt. Nach seiner Rückkehr ins Herzogtum, die spätestens 1524 stattfand,10 lehrte Särkilahti an der Domschule von Turku u. a. Griechisch.11
Die Reformation erreichte Anfang der 1520er Jahre den nordöstlichen Ostseeraum. Der Weg führte dabei über die livländischen Städte Reval/Tallinn und Dorpat, vor allem aber über Riga, wo bereits früh evangelische Prediger tätig waren und schon 1523 protestantische Werke zirkulierten.12 Schweden nahm das Luthertum offiziell 1527 an und Dänemark 1536.13 Laurentius Andreae, Erzdiakon des Domkapitels in Strängnäs und späterer Kanzler des schwedischen Königs, war – zusammen mit dem oben erwähnten Olavus Petri, der aus Wittenberg 1518 zurückgekehrt und Sekretär des Bischofs von Strängnäs geworden war –14 der Hauptförderer reformatorischer Gedanken. Da Schweden, das sich durch den von König Gustav Wasa geführten und von der Hansestadt Lübeck finanzierten Aufruhr aus der Kalmarer Union 1523 gelöst hatte, schwer verschuldet war, brauchte der König dringend große Einnahmen, um die Situation zu beherrschen. Die Kirchenkritik der frühen Reformatoren war ihm dazu ein willkommenes Mittel. Die ersten nicht vom Papst bestätigten Bischofsweihen fanden 1523 statt.15 Die Beschlagnahmung des »überflüssigen« Eigentums der Kirche (die lutherisch gesehen nicht der Kirche, sondern quasi dem christlichen Volk gehörte) wurde 1527 auf dem Reichstag zu Västerås veranlasst. Nach einer Disputation mit Olavus Petri als Repräsentanten der evangelischen Seite wurde beschlossen, dass die christliche Lehre »rein« gepredigt werden sollte, was lutherische Verkündigung (neben katholischer) zuließ.16 1531 wurde Olavus’ Bruder Laurentius Petri, der – wie er – in Wittenberg bei Luther und Melanchthon studiert hatte, Erzbischof von Schweden.17 Dennoch entwickelte sich im Königreich die Neugestaltung der kirchlichen Praxis und Organisation wegen des heftigen Widerstands sowohl der Bevölkerung als auch der Kirchenmänner sehr langsam.18 Am Ende der 1530er Jahre setzte sich Gustav Wasa tatkräftig für ein landesherrliches Kirchenregiment ein und holte Georg Norman, noch einen Luther- und Melanchthon-Schüler, als allen anderen kirchlichen Würdenträgern überlegenen Superintendenten ins Reich.19 1543 wurde Norman jedoch zum Kanzler ernannt und die alte bischöfliche Ordnung blieb bestehen.20 Bereits zwei Jahre vorher (1541) erschien die vollständige schwedische Übersetzung der Luther-Bibel, ediert von Olavus und Laurentius Petri sowie Laurentius Andreae (»Gustav-Wasa-Bibel«). Auf dem Reichstag von Västerås 1544 wurde beschlossen, die Reformation in Schweden weiter zu führen.21 Die Lutherisierung wurde jedoch erst im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts vollbracht.22
Nach dem Zeugnis des finnischen Chronisten Paulus Juusten23 sei auch Petrus Särkilahti von Löwen zu einer unbekannten Zeit nach Wittenberg gezogen und hätte dort entweder an der Universität studiert oder zumindest Luther gehört und bei seiner Rückkehr ins Herzogtum Finnland aktiv lutherische Ideen verbreitet.24 Särkilahti hatte sich auch als erster Geistlicher des schwedischen Königreiches vermählt und damit eine grundlegende lutherische Idee in die Tat umgesetzt.25 Er genoss die Gnade des Königs und wurde zum Erzdiakon des Domkapitels Turku ernannt.26 Unter seinen Studenten in Turku finden wir Michael Olai Agricola, der in den 1520er Jahren die von Rektor Johannes Erasmi geleitete Schule in Wiburg auf der karelischen Landenge besucht hatte, wohin der Prädikant Johannes Block im Jahre 1528 als Schlossprediger aus Dorpat gelangte.27 Im gleichen Jahr wurde der Dominikaner Martin Skytte Bischof von Turku, der Johannes Erasmi zu seinem Kanzler ernannte und aus Wiburg nach Turku zog. Johannes Erasmi nahm seinerseits den jungen Agricola nach Turku als Schreiber mit. Damit hatte Agricola noch Gelegenheit, die Vorlesungen des Särkilahti zu besuchen, bevor dieser 1529 starb. Im gleichen Jahr verschwindet auch Johannes Erasmi aus den Quellen. Sein Nachfolger als bischöflicher Kanzler wurde Agricola, der vom Bischof 1530 zum Priester ordiniert worden war und von da an eifrig seinen pastoralen Aufgaben nachging.28 Zwischen 1536 und 1539 studierte er in Wittenberg bei Luther und Melanchthon und kehrte mit einem von Luther an den schwedischen König gerichteten Empfehlungsschreiben zurück.29 Von 1539 bis 1548 war er Rektor der Kathedralschule von Turku, wo er ein vollständig humanistisches Lehrprogramm einführte.30 Diesem Programm fügte sein Schüler und Nachfolger als Rektor, Ericus Matthei Herkepeus (Härkäpää), der ebenfalls in Wiburg, in Turku bei Agricola und in Wittenberg bei Melanchthon studierte hatte, 1566-1568 die altgriechische Sprache zu.31 1548 erschien Agricolas Übersetzung des Neuen Testaments ins Finnische (»Se Wsi Testamenti«), für welche er als Hauptquellen die Ausgabe des griechischen Textes, die lateinische Übersetzung von Erasmus,32 Luthers deutsche Bibel und die schwedische »Gustav-Wasa-Bibel« benutzte. Luthers Arbeit hatte er in seiner Wittenberger Studienzeit aus erster Hand erlebt.33
II Bibliotheken
Im östlichen Teil des schwedischen Königreiches gab es einige Büchersammlungen, welche die neue Ära widerspiegeln. Dazu zählt auch die Büchersammlung des Wiburger Schlosspredigers Johannes Block mit 127 teilweise handgeschriebenen und überwiegend gedruckten Bänden vorwiegend theologischen Inhalts.34 Dort finden sich auch humanistische Editionen von patristischen Texten, Erasmus’ Kommentar zum Neuen Testament und Werke Melanchthons, 35 dazu zwei Bände mit Werken des von Luther als Protoreformator stilisierten Scholastikers Wessel Gansfort, die Block interessanterweise nicht in den weitverbreiteten Wittenberger Ausgaben, sondern in den ursprünglichen Zwoller Drucken besaß.36 Erasmus ist einer der wichtigsten Autoren in Blocks Bibliothek. Es ist nicht auszuschließen, dass Michael Agricola diese Bibliothek kannte, auch wenn er im Jahr von Blocks Ankunft in Wiburg (1528) nach Turku gegangen war. Die schlechte Quellenlage zu seinen Wiburger Verhältnissen lässt jedoch keine Schlussfolgerungen zu.
Wie es auch Block zu tun pflegte,37 war es Agricolas für heutige Forscher mehr als erfreuliche Gewohnheit, sowohl den Kaufpreis als auch Zeit und Ort des Erwerbs in seine Bücher einzutragen. Daher wissen wir, dass er während seiner Wittenberger Jahre (1536-1539), als er bei Luther und Melanchthon studierte, mindestens fünf große Prachtbände kaufte, darunter eine zweibändige »Opera«-Ausgabe von Aristoteles (Basel, 1538; mit Kauf- und Besitzvermerk »Michaëlis Agricolae de Torsby liber Wittembergae tribus aureis cum dimidio emptus anno domini. 1539. Februarij vigesima (!) quinta«) oder Strabos »Geographicorum commentarii« (Basel, 1523; mit Kauf- und Besitzvermerk »Michaëlis Agricolae liber emptus Wittembergae aureis tribus cum dimidio. Anno 1539. Aprilis 3«) und die »Historia mundi« Plinius’ des Älteren (Basel, 1535).38
Simo Heininen hat die Bedeutung des Erasmus für Michael Agricola bewiesen. In seinen Randbemerkungen zu Luthers Postille, die er 1531 erwarb, benutzte Agricola reichlich dessen »Adagia«.39 Für seine finnische Übersetzung des Neuen Testaments, die 1548 erschien, ist – wie oben gezeigt – Erasmus’ neue lateinische Bibelübersetzung eine wichtige Vorlage.40 Die »Moriae encomium« soll Agricola ebenfalls gekannt haben.41 Sehr wichtig sind die erasmianischen »Precationes, quibus adolescentes assuescant cum Deo colloqui«42 als eine der Quellen für Agricolas finnisches Gebetbuch »Rucouskiria« von 1544 mit 37 Gebeten.43 Agricola hat also Luthers ablehnendes Urteil über Erasmus nicht übernommen – genausowenig wie Melanchthon und der Wiburger Prädikant Block –, sondern den niederländischen Humanisten offen gewürdigt und seinen Beitrag für seine eigenen Zwecke weiter entwickelt.
Unter Agricolas Schülern in Turku befanden sich 1547-1549 auch die hochadeligen Jungen Hogenskild Bielke und Nils Banér, sein Cousin. Hogenskild Bielke erwarb während seines langen Lebens eine der bedeutendsten Bibliotheken des 16. Jahrhunderts in Schweden, die heute noch etwa 400 Handschriften und Drucke umfasst.44 Diese beachtliche Sammlung enthielt die Kernautoren des humanistischen Leseprogramms von Terenz über Cicero bis zu neueren Autoren wie Francesco Petrarca.45 Hogenskild Bielke ist nur einer von tief vom Humanismus geprägten Staatsmännern im Schweden des 16. Jahrhunderts: Auf der höchsten Ebene des Reiches hatten auch Gustav Wasas Söhne, Erich XIV. und Johann III., den Humanismus vollständig rezipiert, wie es u. a. ihre reichen Bibliotheken aufweisen. Dazu kommen mehrere Hochadelige wie Göran Gylta, Erik Larsson Sparre, Abraham Brahe, die Rosenhanes und mehrere Mitglieder der eben genannten Familie Bielke, v. a. Ture und Clas Nilsson, die nicht nur Studienreisen in das Heilige Römische Reich und nach Italien unternahmen, sondern auch eine wichtige Bibliothek aufbauten, die immer noch im Schloss Skokloster in der Nähe von Uppsala aufbewahrt ist.46 Der Humanismus wurde somit nicht nur von Gelehrten, sondern auch von dem schwedischen Adel wenigstens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts vollständig rezipiert.
III Fazit
Obwohl es mit dem »doctor in utroque iure« Kort Rogge, dessen Bibliothek klare humanistische Einflüsse aufweist, eine authentisch humanistische Figur im Königreich Schweden des 15. Jahrhunderts gab, nimmt die Humanismusrezeption in Schweden eine neue Dimension erst im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts ein, und zwar in Verbindung mit der Verbreitung der Reformation. Der aus dem Herzogtum Finnland entstammende Petrus Särkilahti studierte 1517-1518 in Löwen, wohnte dort wahrscheinlich den Vorlesungen von Erasmus bei und ging vielleicht auch in Wittenberg bei Luther und Melanchthon den evangelischen Studien nach. Andere Wittenberger Studenten werden Reformatoren und Verbreiter humanistischer Ideen und Bildung: Olavus und Laurentius Petri, Michael Agricola, Paul Juusten und Erik Herkepeus. Der Humanismus ist aber nicht nur von Geistlichen, sondern auch von den königlichen Prinzen und im Hochadel rezipiert worden. Die vom »Praeceptor Germaniae« Melanchthon zusammengestellte sächsische Schulordnung bestimmte seit 1530 die pädagogische Entwicklung im Königreich Schweden im evangelischen Sinne. Trotz der relativen Trägheit bei der Festigung der lutherischen Reformation wurden sowohl der Humanismus als auch die evangelische Kirchenordnung ein fester Bestandteil der geistigen Landschaft des Königreichs Schweden bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, vor allem aber im 17. Jahrhundert.
1 Die Forschung für diesen Artikel wurde dank der Projekte »The Arrival of Humanism in Finland« (Akademie von Finnland, 2002-2006) und »Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance« (Tralmar, Akademie von Finnland und Universität Jyväskylä, 2013-2017) durchgeführt. Ich bedanke mich herzlich bei der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, die dafür ausgezeichnete Arbeitsvoraussetzungen schuf (2002-2006, 2014-2015). Für die hier beschriebenen geschichtlichen Entwicklungen vgl. z. B. Outi MERISALO: Classical and Humanist works in the libraries of Early Modern Finland (sixteenth – eighteenth centuries). Renaissance Studies 23,2 (2009), 186-199. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-4658.2009.00559.x/full.
2 Herman SCHÜCK: Kort Rogge. Svenskt biografiskt lexikon. http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6812; Jan ÖBERG: Vom Humanismus zum Traditionalismus: die Einwirkung der politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Verhältnisse auf das Kulturleben in Schweden am Beispiel von Kort Rogge. In: »Ut granum sinapis«: Essays on Neo-Latin Literature in Honour of Jozef IJsewijn/ hrsg. von Gilbert Tournoy; Dirk Sacré (Supplementa Humanistica Lovaniensia; 12), Leuven 1997, 24-38 (Edition von Rogges Promotionsrede 35-37); Sabine BLOCHER: Altertumskunde und Sammlungswesen in Schweden von den Anfängen bis zur Regierungszeit Gustavs II. Adolf (Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik; 31). Frankfurt a. M. u. a. 1993, 49.
3 Blocher: Altertumskunde … (wie Anm. 2), 49: »Rogge selbst ist ein am italienischen Humanismus geschulter Lateiner, wie er in seiner Doktorrede an der Universität in Perugia in den 1460er Jahren beweist. In Schweden ist er einer der wenigen Gelehrten, dessen Interesse sich deutlich in seiner Bibliothek mit einem Schwerpunkt auf humanistischer Kunstbetrachtung und Altertumskunde spiegelt. Auch seine Herkunft aus der Patrizierschicht passt in das Bild eines Humanisten«.
4 Ericus Michael FANT: Historiola Litteraturae Graecae in Suecia, Bd. 1. Upsaliae 1775, 8-11. Der Band, Emmanuel CHRYSOLORAS: Grammatica / hrsg. von E. Gourmontius. Paris 1507, enthält eigenhändige Einträge Trolles (u. a. Biografie des Chrysoloras, lateinische Übersetzungen und Bemerkungen, vgl. Fant: Historiola … (w. o.), Bd. 1, 10). Zu Johannes Caesarius vgl. Heinrich GRIMM: Caesarius, Johannes. Neue Deutsche Biographie 3 (1957), 90 f. Der Band gehörte später der Bibliothek des vielseitigen Uppsalaer Gelehrten, Universitätsbibliothekars und Bischofs von Linköping, Erik Benzelius d. J., die nach dem Tod des Bischofs in die Stiftsbibliothek von Linköping gelangte, vgl. Fant: Historiola … (w. o.), Bd. 1, 8 (der fälschlich vom »Kgl. Gymnasium« spricht); Claes ANNERSTEDT: Eric d. y. Benzelius. Svenskt biografiskt lexikon. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18503. Der Band befindet sich immer noch in der Linköpinger Stiftsbibliothek, vgl. http://libris.kb.se/bib/9543016?vw=full.
5 Tobias JÄGER: Olavus Petri, Reformator in Schweden und andere skandinavistische Beiträge (Biblia et Symbiotica; 13 = Disputationes linguarum et cultuum orbis Sectio; V,3). Bonn 1995, 11. Das Auslandsstudium von Olavus Petri wurde von Matthias Gregorii, Bischof von Strängnäs, finanziell unterstützt, ebd, 12.
6 Ebd.
7 30. Oktober 1516: »Petrus Sarkelaxt de Abold« [sic], mit der Anmerkung: »[…] quilibet expagavit 2 mr. exceptis quatuor intraneis qui nichil dederunt«, vgl. Matrikelportal Rostock: Datenbankedition der Immatrikulationen an der Universität Rostock seit 1419. http://matrikel.uni-rostock.de/id/100013741.
8 Matricule de l’Université de Louvain, Bd. 3: 31 août 1485 – 31 août 1527. Corrections et tables/ hrsg. von Arnold Schillings. Bruxelles 1962, 434.
9 Simo HEININEN: Mikael Agricola ja Erasmus Rotterdamilainen (= Erasmus) (Suomalaisen kirjallisuuden Seuran toimituksia; 192). Helsinki 2006, 13.
10 Ebd, 14.
11 Ebd. Im Jahre 1526 wurde Särkilahti von König Gustav Wasa die Hälfte eines Guts zurückgegeben, das als Mitgift seiner ins Kloster »Vallis Gratiae« (Nådendal/Naantali) eingetretenen Tante an den Konvent gegeben worden war, vgl. Fabian COLLAN: De reformationis in Fennia initiis. Diss. Helsingfors 1843, App. XVII (23.8.1526). Särkilahti war damals Stiftskanoniker von Turku.
12 Tiina KALA: Religious life in the late Middle Ages: The Reformation. Estonica. Encyclopedia about Estonia, http://www.estonica.org/en/History/ca_1200-1558_Estonian_middle_ages/Religious_life_in_the_late_Middle_Ages_The_Reformation/.
13 Simo HEININEN; Otfried CZAIKA: Wittenberger Einflüsse auf die Reformation in Skandinavien. EGO. European History Online, 16. http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/religious-and-confessional-spaces/simo-heininen-otfried-czaika-wittenberg-influences-on-the-reformation-in-scandinavia#Dnemark (!).
14 Jäger: Olavus Petri … (wie Anm. 5), 12.
15 Heininen; Czaika: Wittenberger Einflüsse … (wie Anm. 13), 16, 28-30. http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/religious-and-confessional-spaces/simo-heininen-otfried-czaika-wittenberg-influences-on-the-reformation-in-scandinavia#.
16 Ebd, 26-28.
17 Ebd, 30; Olle HELLSTRÖM: Laurentius Petri. Svenskt biografiskt lexikon. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=11080.
18 Ebd.
19 Heininen; Czaika: Wittenberger Einflüsse… (wie Anm. 13), 32.
20 Ebd, 34.
21 Ebd.
22 Ebd, 45.
23 Juusten war ein weiterer Melanchthon-Schüler, der 1543-1546 in Wittenberg und 15461547 im preußischen Königsberg studierte. Er wurde 1548 vom König zum Rektor der Domschule von Turku ernannt, später zum Bischof von Wiburg (1554) und Turku (1563), vgl. Kyösti VÄÄNÄNEN: Juusten, Paulus Petri (noin 1520-1575). Paimenmuisto. http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?eid=1257.
24 Paulus JUUSTEN: Catalogus et ordinaria successio episcoporum Finlandensium/ hrsg. von Simo Heininen (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia; 143). Helsinki 1988, 23; 45-49.
25 Heininen: Mikael Agricola ja Erasmus … (wie Anm. 9), 13.
26 Ebd, 15.
27 Block hatte während seiner Dorpater Zeit (1514-1528) das Luthertum angenommen. Im Jahre 1532 verließ er Wiburg, um die pommersche Stadt Barth zu reformieren, vgl. Simo HEININEN: Mikael Agricola: Elämä ja teokset. Helsinki 2007, 36-39.
28 Heininen: Mikael Agricola ja Erasmus … (wie Anm. 9), 16.
29 Heininen: Mikael Agricola: Elämä … (wie Anm. 27), 30-39; Outi MERISALO: Classical and humanist works in the libraries of early modern Finland between the sixteenth and eighteenth centuries. Renaissance Studies 23 (2009), 186-199, hier 190.
30 Ebd, 190.
31 Kyösti VÄÄNÄNEN: Härkäpää, Ericus Matthaei (K 1578). Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554-1721. http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?eid=1064.
32 Marja ITKONEN-KAILA: Mikael Agricolan Uusi testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. Helsinki 1997, 10; 64-70.
33 Simo HEININEN: Mikael Agricola raamatunsuomentajana. Helsinki 1999, 274.
34 Bis auf einen Band (Berlin, SBB-PK, Inc. 1515,5 (1990,5). Digitalisat: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000CDAD00000000) befindet sich Blocks Büchersammlung geschlossen in der Marienkirche in Barth/Vorpommern. Zu den Handschriften vgl. Renate SCHIPKE; Kurt HEYDECK: Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundesländern Deutschlands: Bestandsaufnahme der ehemaligen Arbeitsstelle ZIH. Wiesbaden 2000, 33 f. (Nr. 7: Barth, Kirchenbibliothek St. Marien [K], 2° E 20: Bibelindex und eine Verkürzung von Bonaventura, geschrieben 1481 in Reval, von Block um 1512 erworben; Nr. 8: Ebd, 2° F 26: Ein zwischen 1445 und 1487 geschriebener theologischer Sammelband. Digitalisat: http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/browse/bibliotheken.400kbbarth.100block/-/1/-/-/). Block hat auch ein Konvolut mit gedruckten Texten von antiken und humanistischen Auctores aus seiner Schulzeit, wohl in Stolp, aufbewahrt: Barth, K, 4° J 3 (Mitteilung von Jürgen Geiß-Wunderlich).
35 Heininen: Mikael Agricola: Elämä … (wie Anm. 27), 36 f.
36 Barth, K, 8° A 23 (3); 4° D 6 (1-4).
37 Mitteilung von Jürgen Geiß-Wunderlich.
38 Jetzt in der Roggebiblioteket in Strängnäs, vgl. Otfried CZAIKA: Plinius väg från Rom via Basel, Wittenberg och Finland till Roggebiblioteket: ett tillägg till Mikael Agricolas bibliotek. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 101 (2011), 21-36. In diesem Artikel weist Czaika den Band Bertil Eriksson Ljuster zu, dem Schreiber von Herzog Johann von Finnland (dem späteren König Johann III.) zwischen 1556 und 1561. Ljuster hatte zwar eine Plinius-Ausgabe, aber Agricolas Band weist keinen Besitzvermerk Ljusters auf, im Gegensatz zur Ausgabe »In psalmos interpretatio« von Johannes Bugenhagen, wo sich Besitzvermerke sowohl von Agricola als auch von Ljuster finden (ebd).
39 Heininen: Mikael Agricola ja Erasmus … (wie Anm. 9), 21.
40 Ebd, 22.
41 Ebd.
42 Precationes aliquot novae, quibus adolescentes assuescant cum deo colloqui: Item eiaculationes aliquot e scripturae Canonicae verbis contextae. Basel: Froben und Episcopius, 1535.
43 Rucouskiria, Bibliasta, se on, molemista Testamentista, Messuramatusta, ia muusta monesta, jotca toysella polella Luetellan, cokoonpoymettu Somen Turussa. Painettu Stocholmisa: Amund Lauritzenpoialda, 1544. Zu den von Erasmus übernommenen Gebeten vgl. Heininen: Mikael Agricola ja Erasmus … (wie Anm. 9), 32-34. Agricola folgt u. a. dem biblischen Gebetbuch von Otto Brunfels (1528); aus den traditionellen Kollektivgebeten (»Collecta«) eliminierte er die Hinweise auf den Heiligenkult. Dazu benutzte er das von Markgraf Albrecht von Brandenburg verfasste Gebetbuch, vgl. ebd, 30-32; zu Markgraf Albrecht, Hochmeister des Deutschen Ordens, der seine Würde 1525 ablegte und von König Sigismund I. von Polen in Preußen weltlich belehnt wurde vgl. Irene DINGEL: Albrecht Markgraf von Brandenburg-Ansbach, Herzog in Preußen. http://www.controversia-et-confessio.de/id/e126e97e-2269-4be3-8687-d0386a9b62a7. Eine weitere wichtige Quelle für Agricola ist das im Kreis von Kaspar von Schwenckfeld entstandene Gebetbuch, vgl. Heininen: Mikael Agricola ja Erasmus … (wie Anm. 9), 32.
44 Wolfgang UNDORF: Hogenskild Bielke’s library: A catalogue of the famous sixteenth-century Swedish private collection (Acta bibliothecae R. universitatis Upsaliensis; 32). Uppsala 1995.
45 Outi MERISALO: »Sapere aude«: The book as a vehicle of Classical culture in Northern Europe in the seventeenth and eighteenth centuries. In: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6.12. Aug. 2006/ hrsg. von Joaquin Pascual Barea u. a. (Medieval and Renaissance Texts and Studies; 386). Tempe/Ariz. 2010, 85.
46 Ebd, 84.