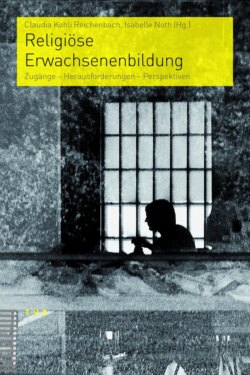Читать книгу Religiöse Erwachsenenbildung - Группа авторов - Страница 26
3.2. Gottfried Orth: Evangelische Erwachsenenbildung als Option für die Armen 60
ОглавлениеMit seiner Habilitationsschrift «Erwachsenenbildung zwischen Parteilichkeit und Verständigung»61 legte der evangelische Theologe Gottfried Orth ein Theoriemodell zur theologischen Erwachsenenbildung62 vor, das eine grosse Nähe zur Konzeption Ernst Langes und zu dem befreiungstheologischen Ansatz Paulo Freires aufweist. Gottfried Orth, lange Jahre theologischer Referent der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE), versucht dabei explizit, sein Modell einer theologischen Bildungsarbeit im Kontext Evangelischer Erwachsenenbildung «als Bildungsarbeit der evangelischen Kirche im Rahmen des Vierten Bildungsbereichs und seiner staatlichen Rahmenbedingungen theoretisch zu begründen und konzeptionell zu entwerfen».63
Bereits in der Einleitung seiner Habilitationsschrift geht er von der Prämisse aus, es gebe keine universal gültige Theologie, denn «die konkrete Wirklichkeit als ein Ort göttlicher Offenbarung [sei] sozialwissenschaftlich zu analysieren, damit Theologie auch analytisch beschreiben kann, wovon sie spricht, wenn sie von Wirklichkeit redet».64 Nach seiner Meinung sind Gesellschaft und Kirche in Westeuropa Teil und Profiteure eines Herrschaftssystems, das fortwährend Armut, Not und Unterdrückung in Lateinamerika, Asien und Afrika produziert.
Unter diesem Vorzeichen einer schuldhaften Verstrickung hat die Theologie bzw. theologische Erwachsenenbildung die Aufgabe, «zur Befreiung aller Menschen, zuerst der Armen und Unterdrückten beizutragen. Gott selber als Befreier wird zentrales Thema solcher Theologie sein.»65 Die unbedingte Solidarität mit den Armen wird zum konstitutiven Kriterium für glaubhafte christliche Existenz. Das bedeutet für seine evangelische Bildungsarbeit im pluralen staatlichen Weiterbildungssystem, dass «Bildungsbenachteiligte und Bildungsungewohnte – Arme, Arbeitslose, Behinderte, Frauen – erste Adressaten sowie Subjekte»66 seiner Konzeption theologischer Erwachsenenbildung sind. Es gilt daher, deren Erfahrungen von Unterdrückung und Armut sowohl biografisch aufzuarbeiten als auch die |34| gesamtgesellschaftlichen Macht- und Unterdrückungsmechanismen, die Armut und Unterdrückung produzieren, mit dem Ziel der Veränderung aufzudecken.
Den theologischen Zielhorizont für die anzustrebenden Veränderungen entwickelt Orth aus den biblischen Verheissungen. Es geht der theologischen Erwachsenenbildung «um eine Veränderung der gegenwärtigen Wirklichkeit aus der Zukunft des den Menschen vorausseienden Gottes her; dies zu denken ist freilich nur möglich, weil die Vergangenheit dieser Zukunft uns in Gottes Wort der Verheißung gegenwärtig ist».67 Die konkrete, gegenwärtige Wirklichkeit wird nicht in ihrer Faktizität, sondern von ihren zukünftigen Möglichkeiten her, für die Gott in Jesus Christus einsteht, zum Thema der Erwachsenenbildung. Er verweist auf die alttestamentlichen Propheten als Vorbilder dieser Konzeption einer theologischen Erwachsenenbildung, da sie «die alten Verheißungen und die neu ergangenen Worte Jahwes von der Gegenwart her und auf diese hin verstanden und zu konkretisieren wußten und auslegten».68 Ihre besondere Qualität habe in der Fähigkeit bestanden, die geschichtlichen Bewegungen und die Veränderungen ihrer Gegenwart wachsam wahrzunehmen und auf diese Wahrnehmungen mit ihren Verheissungen zu reagieren.
In der Bildungspraxis werden Menschen aus dem Umfeld des konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung faktisch zu den primären Adressaten von Orths Konzeption. Andere inhaltliche Zielsetzungen und Arbeitsschwerpunkte beurteilt er recht ungnädig, denn diese bewegten sich bezüglich der gesellschaftlichen oder politischen Organisiertheit der Teilnehmenden in einem «luftleeren Raum», die Teilnehmenden seien vor und nach den Veranstaltungen «individualisiert», die Angebote seien «folgenreich oder ebensogut folgenlos»69; solche Ansätze wollten überall sein und seien daher nirgends, da sie ihren gesellschaftlichen Ort verloren hätten.
Orths Theoriemodell besticht durch sein klares theologisches Profil und seine immanente Stringenz. Doch sein Modell ist eindimensional, es wird bestimmt durch seinen Zielhorizont und hat als Zielgruppe nur die Menschen im Blick, die seinen gesellschaftspolitischen Anspruch teilen. Die plurale soziokulturelle und psychosoziale Wirklichkeit der Adressaten wird ebenso ausser Acht geslassen wie die institutionellen Rahmenbedingungen von Institutionen der religiösen Erwachsenenbildung. |35|