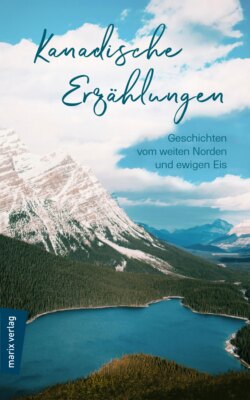Читать книгу Kanadische Erzählungen: Geschichten vom weiten Norden und ewigen Eis - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Als der Lachs ausblieb
Оглавлениеvon Pauline Johnson
Die »Wanderung« dieses Jahr war äußerst ertragreich gewesen, und inzwischen neigte sich die Rotlachssaison dem Ende zu. Deshalb wunderte ich mich mehr als einmal, warum meine alte Freundin, die ›Indianerin‹, sich keiner Fangflotte angeschlossen hattewar. So unermüdlich und arbeitsam wie sie war, machte sie für gewöhnlich sogar ihrem Mann, einem vortrefflichen Lachsfänger, Konkurrenz, und das gesamte Jahr über hatte sie kaum von etwas anderem als der bevorstehenden Wanderung gesprochen. Und dennoch befand sie sich ausgerechnet diesen Herbst nicht unter ihresgleichen. Die Fangflotten und Fischfabriken hatten nichts von ihr gehört, und jedes Mal, wenn ich jemanden aus ihrem Stamm fragte, erhielt ich lediglich die Antwort: »Sie ist dieses Jahr nicht dabei.«
An einem rotgoldenen Nachmittag im September aber sah ich sie schließlich. Ich war den Weg entlanggeschlendert, der vom Schwanenbecken bis um den Rand der Stromschnellen führt, als ich ihr elegantes, bogenförmiges Kanu erblickte, auf dem Weg zu dem Strand, wo die Tilikums2 der Mission am liebsten anlandeten. Ihr Kanu wirkte wie aus einem Traum, das Wasser ganz still, und über allem lag ein dünner, blauer Schleier, weil der Torf auf Lulu Island seit Tagen schwelte, sodass sein stechender Geruch und blaugrauer Dunst Meer, Ufer und Himmel in eine surreal anmutende Landschaft verwandelten.
Eilig lief ich am Ufer entlang, rief ihr in der Sprache der Chinook einen Gruß zu, und als sie mich hörte, hob sie das Paddel direkt über ihren Kopf als ›indianischen‹ Gruß.
Nachdem sie angelegt hatte, begrüßte ich sie, streckte die Hand aus, um ihr an Land zu helfen, denn die ›Indianerin‹ nähert sich allmählich einem fortgeschrittenen Alter; trotzdem paddelt sie noch wie ein junger Kerl gegen den Tidenstrom.
»Nein«, sagte sie, als ich sie bat, ans Ufer zu kommen. »Ich werde warten – ich. Ich komme nur, um Maarda abzuholen. Sie war in Stadt, sie bald kommen – jetzt.« Allerdings gab sie bei diesen Worten ihre aufrechte »Arbeits«-Haltung auf und hockte sich wie ein Schulmädchen in den Bug ihres Kanus, die Ellenbogen auf dem Paddel, das sie auf dem Dollbord abgelegt hatte.
»Ich habe dich vermisst, Indianerin. Drei Monde lang bist du nicht zu mir gekommen, hast weder gefischt noch bist du in der Konservenfabrik aufgetaucht«, bemerkte ich.
»Nein«, sagte sie. »Ich bleibe dieses Jahr zu Hause.« Dann beugte sie sich zu mir und fügte mit einer gewissen Bedeutungsschwere in ihrer Gestik, in ihren Augen und in ihrer Stimme hinzu: »Ich habe ein Enkelkind, in der ersten Juliwoche geboren, darum – bleibe ich.«
Das war also der Grund für ihre Abwesenheit. Selbstverständlich gratulierte ich ihr und erkundigte mich nach diesem besonderen Ereignis, denn schließlich war es ihr erstes Enkelkind und somit ist die kleine Person überaus wichtig.
»Und, wirst du aus ihm einen Fischer machen?«, fragte ich.
»Nein, nein, kein Jungen-Kind, es ist Mädchen-Kind«, antwortete sie mit einem gewissen unbeschreiblichen Gesichtsausdruck, der mich erahnen ließ, dass es ihr so lieber war.
»Du freust dich, dass es ein Mädchen ist?«, fragte ich überrascht.
»Sehr«, antwortete sie voller Überzeugung. »Ein Mädchen als erstes Enkelkind, sehr großes Glück. Unser Stamm ist nicht wie eurer; wir wollen Mädchen-Kinder zuerst. Wir wünschen nicht immer Knaben, geboren nur fürs Kämpfen. Deinen Leuten geht es nur um den Kriegspfad; unser Stamm ist friedlicher. Erstes Enkelkind ein Mädchen ist gutes Zeichen. Ich sage dir warum: Ein Mädchen-Kind wird vielleicht selbst eines Tages Mutter, Mutter sein ist große Sache.«
Ich fühlte, dass ich den geheimen Kern ihrer Gedanken verstanden hatte. Sie freute sich, dass dieses Kind eines Tages eine der Mütter ihres Volkes werden sollte. Wir sprachen noch etwas länger, wobei sie mehrmals Sticheleien gegen meinen Stamm austeilte, der das Muttersein viel weniger schätzte als ihrer, und dafür Schlachten und Blutvergießen umso mehr. Dann schweiften wir ab zu dem Rotlachs und hyiu chickimin3, das die ›Indianer‹ kriegen würden.
»Ja, hyiu chickimin«, wiederholte sie und seufzte zufrieden. »Immer, und hyiu muck-a-muck4, wenn große Lachswanderung. Hauptsache, das schlechte Jahr ganz ohne Fisch kommt nie wieder.«
»Wann war das?«, fragte ich.
»Vor deiner Geburt, und meiner, und«, dabei zeigte sie über den Park in Richtung Vancouver – eine Stadt, die an diesem Septembernachmittag Wohlstand und Schönheit ausstrahlte – »vor der Geburt dieses Ortes, bevor der weiße Mann herkam, oh, lange davor.«
Ach, liebe ›Indianerin‹! Ihr trüber Blick verriet mir, dass sie wieder ins Land der Legenden zurückgekehrt war und mein Schatz an ›Indianersagen‹ schon bald noch reicher sein würde. Sie saß, stützte sich immer noch auf das Paddel, die Augen halb geschlossen, den Blick auf die Umrisse der verschwommenen Berge auf der anderen Seite der Bucht gerichtet. Ich werde nicht weiter versuchen, ihr gebrochenes Englisch wiederzugeben, somit ist das hier lediglich ein trüber Spiegel ihrer Geschichte, die Legende ist ohne ihre persönliche Note, eine Blume, der es an Farbe und Duft zugleich fehlt. Sie nannte die Geschichte »Als die Lachswanderung ausblieb«.
Die Frau des Großen Tyee5 war ein blutjunges Mädchen, doch damals war einfach alles jung, selbst der Fraser River war jung und schmal, nicht der breite Strom von heute; doch der rosafarbene Lachs bevölkerte dessen Rachen schon damals, und die Tilikums fingen, pökelten und räucherten den Fisch so, wie sie es auch dieses Jahr taten und wie sie es immer tun werden. Der Winter war gekommen, die Regenfälle prasselten schräg herab und Nebelschwaden zogen über das Land, als sich die Frau des Großen Tyee vor ihn hinstellte und sagte:
»Vor der Lachswanderung werde ich dir ein großes Geschenk machen. Wirst du mir dankbarer sein für ein Jungen-Kind oder ein Mädchen-Kind?« Der Große Tyee liebte die Frau. Er war streng mit seiner Familie, streng zu seinem Stamm, leitete die Feuer-Versammlungen mit steinhartem Willen. Sein Medizinmann sagte, er trage kein menschliches Herz in seiner Brust; seine Kämpfer sagten, es fließe kein menschliches Blut in seinen Adern. Und doch umschloss er die Hände dieser Frau, und sein Blick, seine Lippen, seine Stimme waren so sanft wie die ihren, als er ihr antwortete:
»Schenke mir ein Mädchen-Kind – ein kleines Mädchen-Kind –, damit sie heranwächst und so wird wie du, und damit auch sie wiederum ihrem Ehemann Kinder schenkt.«
Als jedoch die Stammesmitglieder von dieser Wahl hörten, waren sie vor Ärger ganz aufgebracht. Voller Empörung umzingelten sie ihn in einem tiefen Kreis. »Du bist dieser Frau ein Sklave«, verkündeten sie, »und jetzt willst du dich zum Sklaven eines Frau-Kindes machen. Wir wollen einen Erben – ein Mann-Kind, der in den kommenden Jahren unser Großer Tyee wird. Wenn du alt und der Stammesangelegenheiten müde bist, wenn du in deine Decke gehüllt in der warmen Sommersonne sitzt, weil dein Blut alt und dünn ist, was kann ein Mädchen-Kind da für dich oder uns schon tun? Wer soll dann unser Großer Tyee werden?«
Und der Große Tyee stand mit verschränkten Armen inmitten dieses bedrohlichen Kreises, das Kinn stolz emporgereckt, der Blick felsenfest. Mit eiskalter Stimme entgegnete er:
»Vielleicht wird sie euch ein solches Mann-Kind schenken, und dann gehört jenes Kind euch; er wird euch gehören, nicht mir. Er wird dem Volk gehören. Aber wenn das Kind ein Mädchen wird, wird sie mir gehören – sie wird mein sein. Ihr könnte sie mir nicht wegnehmen, so wie ihr mich von der Seite meiner Mutter weggenommen und mich gezwungen habt, meinen gealterten Vater zu vergessen, um dem Stamm zu dienen. Sie wird mir gehören, die Mutter meiner Enkelkinder sein und ihr Mann wird mein Sohn sein.«
»Dir geht es nicht um das Wohl deines Stammes. Sondern nur um deine eigenen Wünsche«, protestierten sie. »Wenn die Lachswanderung nun kläglich ausfallen sollte, dann werden wir kein Essen haben, und wenn es dann kein Mann-Kind gibt, werden wir keinen Großen Tyee haben, der uns zeigt, wie wir von anderen Stämmen Essen bekommen, und somit werden wir verhungern.«
»Eure Herzen sind finster und blutleer«, erwiderte der Große Tyee darauf mit donnernder Stimme. Kampfbereit blickte er sie an: »Und eure Augen sind geblendet. Wollt ihr, dass der Stamm vergisst, wie bedeutend ein Kind ist, das eines Tages selbst Mutter sein und euren Kindern und Enkelkindern einen Großen Tyee schenken wird? Sollen die Menschen leben, wachsen und gedeihen, sollen sie sich vermehren und mächtiger werden ohne Mütter, die zukünftige Söhne und Töchter zur Welt bringen werden? Euer Geist ist tot, eure Hirne kalt. Doch selbst in dieser Ignoranz seid ihr noch meine Familie: Ihr und eure Wünsche müssen Beachtung finden. Ich werde alle großen Medizinmänner zusammenrufen, alle Hexenmeister und alle Zauberer. Sie sollen entscheiden, was passiert, je nachdem, ob es ein Jungen- oder ein Mädchen-Kind wird. Was sagt ihr dazu, ihr ach so mächtigen Männer?«
Entlang der Küste wurden Botschafter ausgesandt, den Fraser River hinauf und mehrere Meilen ins Landesinnere hinein, zu den Tälern, um all die weisen Männer einzuberufen, die sie finden konnten. Noch nie zuvor waren so viele Medizinmänner in einem Rat vereint. Sie machten große Feuer, tanzten und sangen mehrere Tage lang. Sie riefen die Götter der Berge, die Götter des Meeres an, bis sie schließlich eine »Eingebung« hatten. Sie stellten die Stammesmitglieder vor eine Wahl, und der älteste Medizinmann aus der gesamten Küstengegend erhob sich und verkündete ihren Beschluss:
»Der Stamm kann nicht alles haben. Sie wollen ein Jungen-Kind und eine ertragreiche Lachswanderung. Sie können nicht beides haben. Der Safalie Tyee, der große Mann der Magie, hat uns gezeigt, dass diese beiden Dinge zu Arroganz und Egoismus führen. Also muss der Stamm sich für eines entscheiden.«
»Ihr sollt wählen, ihr unwissenden Stammesmitglieder«, befahl der Große Tyee. »Die weisen Männer unserer Küste haben gesagt, dass das Mädchen-Kind eines Tages selbst Kinder zur Welt bringen und uns reichlich Lachs zum Zeitpunkt ihrer Geburt schenken wird, während ein Jungen-Kind lediglich sich selbst zu euch bringen wird.«
»Vergesst den Lachs«, riefen die Stammesmitglieder da, »aber schenkt uns einen neuen Großen Tyee. Schenkt uns ein Jungen-Kind.«
Und als das Kind geboren wurde, war es ein Knabe.
»Unheil wird euch heimsuchen«, wehklagte der Große Tyee. »Ihr habt eine Mutter verschmäht. Ihr werdet Unheil erfahren, an Hunger und Armut leiden, o ihr törichten Menschen! Wusstet ihr denn nicht, wie bedeutend ein Mädchen-Kind ist?«
In jenem Frühling reisten die Mitglieder dutzender Stämme zur Lachswanderung an den Fraser River. Sie kamen von weither – aus den Bergen, von den Seen, von den fernen trockenen Gebieten, doch kein einziger Fisch fand sich in den breiten Flüssen an der Pazifikküste. Die Stammesmitglieder hatten sich entschieden. Sie hatten vergessen, welche Ehre ihnen eine Mutter gebracht hätte. Sie hatten ihre Nahrung verspielt. Sie lebten in großer Armut. Im folgenden Winter litten sie Hunger. Seitdem ist die bevorstehende Geburt eines Mädchen-Kindes für unseren Stamm ein Grund zur Freude – wir wollen kein Jahr mehr, in dem der Lachs ausbleibt.
Als die ›Indianerin‹ ihre Geschichte beendet hatte, hob sie die Arme von dem Paddel, ihr Blick ließ von den verschwommenen Konturen der violett gefärbten Berge ab. Sie war wieder zurück in diesem guten Jahr – ihre Legendenwelt war verschwunden.
»Vielleicht«, fügte sie hinzu, »verstehst du jetzt, warum ich mich über ein Enkelin freue. Es bedeutet viel Lachs im nächsten Jahr.«
»Das ist eine wunderschöne Geschichte«, sagte ich, »und mich erfüllt eine diebische Freude, wenn ich daran denke, dass eure weisen Männer die Menschen für ihre törichten Entscheidungen bestraft haben.«
»Das liegt daran, dass du selbst ein Mädchen-Kind bist«, sagte sie und lachte.
Hinter mir hörte ich das leiseste Huschen eines Schrittes. Als ich mich umdrehte, stand Maarda fast neben mir. Mit steigender Flut löste sich das Kanu vom Uferboden, und als Maarda einstieg und die ›Indianerin‹ nach hinten rutschte, trieb es aufs Wasser hinaus.
»Kla-how-ya«, verabschiedete sich die ›Indianerin‹ und nickte mir zu, als sie das Paddel geräuschlos eintauchte.
»Kla-how-ya«, sagte auch Maarda lächelnd.
»Kla-how-ya, Tilikums«, erwiderte ich und schaute ihnen noch eine Weile nach, während das Kanu mit ihnen davontrieb, bis es schließlich in der verschwommenen Ferne mit dem Violett und Grau des anderen Ufers verschmolz.