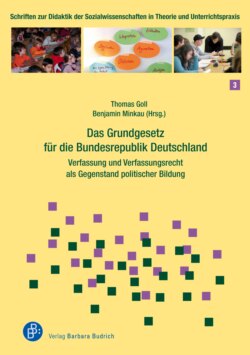Читать книгу Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Politische Lagen – Deutschland 1930 und 2019
ОглавлениеDie politische Lage in der Weimarer Republik des Jahres 1930 stand im Zeichen der sich seit Oktober 1929 (Beginn der Weltwirtschaftskrise) verschlechternden Wirtschaftslage, das Deutsche Reich „rutschte in eine Dauerkrise“ (Bohr 2017: 212). Daran scheiterte am 27. März 1930 die große Koalition aus SPD, Zentrum, DVP und DDP (1928–1930) (vgl. Hesse et al. 2015: 67ff.). Das Kabinett um Reichskanzler Hermann Müller (SPD) trat zurück. Schon am 29. März 1930 wurde Heinrich Brüning (Zentrum) zum Reichskanzler ernannt und damit der Weg in die Präsidialregierungen beschritten und das parlamentarische Regierungssystem „fortan Schritt für Schritt ausgehöhlt“ (Hengst 2017: 225).
[16] Angesichts der Ergebnisse der Reichstagwahl vom 14. September 1930 (vgl. Kolb 1988: 258f.), deren Gewinner und damit zweitstärkste Kraft im Reichstag mit 18,3 % der abgegebenen Wählerstimmen (1928: 2,6 %) und einem Zuwachs auf 107 Mandate (1928: 12) die NSDAP war, fand sich die SPD, die 24,5 % (1928: 29,8 %) und 143 Mandate erreichte, bereit, das Kabinett Brüning zu tolerieren (vgl. Plumpe 2018: 33). Das Zentrum errang 11,8 % (1928: 12,1 %), die DVP 4,5 % (1928: 8,7 %) und die DNVP 7,0 % (1928: 14,2 %). Die KPD konnte 13,1 % (1928: 10,6 %) verbuchen. Rechts- und Linksextremisten konnten deutliche Zuwächse erringen, die demokratische Mitte hatte endgültig keine Mehrheit mehr. Im Gegenteil, mit NSDAP, KPD und DNVP „rückte der antidemokratische Teil des Reichstags gefährlich nah an die Mehrheit heran“ (Möller 2018: 46).
Das politische Klima heizte sich immer mehr auf. Die KPD bekämpfte die SPD als „Sozialfaschisten“ (Traub 2017: 236), die bürgerlichen Parteien „vollzogen einen Rechtsruck“ (Bohr 2017: 214). Schon am 23. Januar 1930 war mit Wilhelm Frick zum ersten Mal in Deutschland (Thüringen) ein Minister aus der NSDAP in ein Kabinett berufen worden. Insgesamt kann das Parteiensystem der Weimarer Republik als extrem polarisiert gekennzeichnet werden. Es war von einem verbreiteten Freund-Feind-Denken geprägt (vgl. Möller 2018), das auch die politische Kultur des Landes durchzog. Seit geraumer Zeit ist gesichert, dass die Gesellschaft der Weimarer Republik stark fragmentiert (Lehnert und Megerle 1987) und extrem segmentiert (Winkler 1993) war. Es bestand kein Verfassungskonsens (Steinbach 1986), sondern über die längste Zeit ihres Bestehens wurde die Republik aktiv bekämpft (Sontheimer 1987), sodass von einer „belagerten Civitas“ (Stürmer 1985) „in der Klammer von Rechts- und Linksextremismus“ (Knütter 1988) gesprochen werden kann. Nicht nur kulturell war Weimar damit überspitzt gesagt eine „Republik der Außenseiter“ (Gay 1987).
Ganz anders die Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart. Alle amtlichen Statistiken weisen seit Jahren eine stabile wirtschaftliche Situation aus (vgl. Destatis 2019a, 2019b): Das BIP ist stabil und liegt im zweiten Quartal von 2019 bei 844,730 Mrd. €. Die Zahl der Erwerbstätigen beträgt im Juli 2019 42,23 Mio. Personen, die der Erwerbslosen 1,35 Mio., was einer Erwerbslosenquote von 3,1 % entspricht. Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung spricht von einem zehnjährigen stetigen „Wachstumskurs“ (BMWI 2019). Zwar fehlt der deutschen Konjunktur laut ifo-Institut gegenwärtig der „Schwung“, was insbesondere auf die Unsicherheiten der Weltwirtschaft zurückzuführen ist, aber „die konjunkturelle Entwicklung [ist] gespalten“ (Wollmershäuser et al. 2019: 25). Anders als 1929/30 kann von einer Wirtschaftskrise nicht gesprochen werden. Es gibt auch keine grundlegende Krise der sozialen Sicherungssysteme und keine bodenlose Ungerechtigkeit des Sozialsystems. [17] Eine aktuelle Bestandaufnahme konstatiert sogar: „Deutschland ist gerechter, als wir meinen“ (Cremer 2018).
Auch die parlamentarische Demokratie steht nicht unter dem Druck der Weimarer Zeit. Dennoch hat sich das Parteiensystem spätestens mit der dauerhaften Etablierung der AfD gewandelt. Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 24. September 2017 (Bundeswahlleiter 2017) führte zu einer Wiederauflage der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD, die trotz ihrer Verluste im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl (in Klammern) über eine klare Parlamentsmehrheit verfügen: CDU 26,8 % (–7,4 %), CSU 6,2 % (–1,2 %), SPD 20,5 % (–5,2 %), AfD 12,6 % (+7,9 %), FDP 10,7 % (+5,9 %), Linke 9,2 % (+0,6 %), Grüne 8,9 % (+0,5 %). Bei der Europawahl 2019 (Bundeswahlleiter 2019) erzielte die AfD 11,0 % (+3,9 %), während die CDU 22,6 % (–7,5 %), die CSU 6,3 % (+1,0 %), die SPD 15,8 % (- 11,4 %), FDP 5,4 % (+2,1 %), Linke 5,5 % (–1,9 %) und Grüne 20,5 % (+9,8 %) erreichten. Mit der Veränderung des Parteiensystems wird die Regierungsbildung in Bund und Ländern schwieriger. Eine antidemokratische Mehrheit ist dort jedoch nicht in Sicht.
Allerdings verändert sich das politische Klima. Der Ton wird rauer. Ein älterer Sammelband konstatiert eine „gespaltene Gesellschaft“ (Lessenich und Nullmeier 2006), eine jüngere Analyse gar „feindselige Zustände“ (Zick 2016), abzulesen an verbaler und physischer Gewalt. Ähnlich wie in den 1920er Jahren kann ein allgemeiner „Aufstieg des Rechtspopulismus“ (Hirschmann 2017) festgestellt werden. „Bürgerliche Scharfmacher“ (Speit 2017) behaupten „Volkes Stimme“ (Niehr und Reissen-Koch 2019) zu sein. Die Debatte wird durch subtile Äußerungen und plakative Verlautbarungen, durch „Provokationen und Tabubrüche“ (Ernst 2017) angeheizt, deren Kommentierung selbst wieder kommentiert wird (vgl. http://lügen-presse.de/). Die Rede ist von „Lügen-presse“, „Systempresse“ oder auch „Pinocchiopresse“ (Martella 2017: 90). In den „Echokammern“ der sozialen Medien und des Internets potenziert sich der je eigene Eindruck. Der „mediale Filter- und Verstärkungseffekt“ (Daniel 2018: 62) schlägt sich im Bewusstsein derer nieder, die immer schon zu spüren meinten, dass sie von den Medien manipuliert werden. Die politische Kommunikationsforschung nennt solche Konstellationen Dialogblockaden (Klein 1996: 6).
Die politische Kultur der Weimarer Republik ist von solchen Dialogblockaden gekennzeichnet. Am deutlichsten hat der Staatsrechtler Carl Schmitt in seiner Schrift „Begriff des Politischen“ deren Grundlage und Konsequenz beschrieben, indem er als „spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, […] die Unterscheidung von Freund und Feind“ (Schmitt 1932/2015: 25) bestimmt und daraus den „Krieg als das extremste politische Mittel“ ableitet, das „die jeder politischen Vorstellung zugrunde liegende Möglichkeit dieser [18] Unterscheidung von Freund und Feind [offenbart]“ (ebd.: 34). Der für politische Einheiten, nicht für Privatpersonen geltende Freud-Feind-Gegensatz führt innenpolitisch in einen Bürgerkrieg, wenn die staatliche Einheit durch parteipolitische Gegensätze aufgehoben wird, wenn also „innerhalb eines Staates die parteipolitischen Gegensätze restlos ‚die‘ politischen Gegensätze geworden sind“ (ebd.: 31). Grundsätzlich kann dabei in den Augen von Carl Schmitt „[j]eder religiöse, moralische, ökonomische, ethnische oder andere Gegensatz“ zu einem politischen werden, „wenn er stark genug ist, die Menschen nach Freund und Feind effektiv zu gruppieren“ (ebd.: 55).
Wie sehr Carl Schmitts Darstellung dem Geist der Zeit entsprach, sollten die kommenden Jahre zeigen, in denen der an die Macht gekommene Nationalsozialismus entlang seiner von ihm selbst definierter Freund-Feind-Konstellationen ganze Gruppen von Menschen zu Feinden erklärte und sich an deren Auslöschung machte. Das stellt die Frage nach der Verfasstheit der Republik, genauer ob diese aufgrund unzureichender institutioneller Bremsen den Weg in Mord und Barbarei ermöglichte und wie das Grundgesetz in Reaktion auf das Scheitern der Weimarer Republik konstruiert und weiterentwickelt wurde.