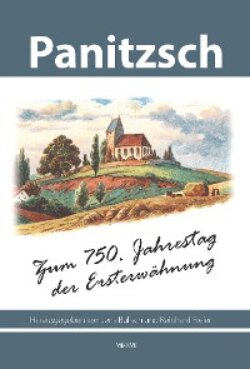Читать книгу Panitzsch - Группа авторов - Страница 11
ORT – KIRCHE – LANDSCHAFT
ОглавлениеVom Parthendorf zum Ortsteil
Schlaglichter aus der Panitzscher Geschichte
Birgit Horn-Kolditz
Einleitung
Panitzsch, ein altes Straßendorf, liegt im östlichen Vorfeld der Stadt Leipzig in guter Verkehrslage zur Bundesstraße 6 und zur Autobahn Halle-Dresden. Schaut man vom höchsten Punkt des Ortes, dem Wachberg mit Kirche und Friedhof, nach Nordwesten, erblickt man die Tauchaer Kirche und den Weinberg mit seinem Aussichtsturm. Im Norden und Nordosten ziehen sich die Sandhügel der Endmoränenkette hin, die sich von Weißenfels her über Rückmarsdorf gegen Eilenburg erstreckten. Gegen Osten schließt sich der bewaldete Rücken des Tresens an. Im Südosten zeigen sich die Porphyrkuppen, die hinter Brandis und Beucha aufsteigen. Auf der Hochfläche bei Liebertwolkwitz ragt das Völkerschlachtdenkmal empor. Im Westen aber erhebt sich die Silhouette der Großstadt Leipzig.
Die schriftlich nachweisbaren Wurzeln von Panitzsch reichen bis ins Jahr 1267 zurück. Die aus dem Slawischen stammende Bezeichnung des Ortsnamens als „villa Bansc“ oder „Bancz“ lässt sich frei übertragen als Panitzsch, das Dorf im Tal der Parthenaue. Die Schreibung des Ortsnamens wechselte mehrfach, beispielsweise in „Baynsch“ 1335, „Bans“ 1378, „Panczsch“ 1437, „Banczsch“ 1438 oder auch Bantzsch um 1547. Seit 1552 ist die heutige noch gültige Schreibweise überliefert. Auf älteren Karten finden sich allerdings auch danach noch andere Schreibweisen wie „Banitz“ und „Panisch“ (1730) oder „Panitsch“ (1873).
Die ursprünglich slawische Besiedlung setzte um das Jahr 1000 ein. Die Siedlungsweise der Slawen ist zum Teil noch heute im alten Ortskern an der Kirchgasse sichtbar. Durch deutsche Ansiedlungen im Bereich der „Langen Reihe“ (heute Lange Straße) und den Zuzug aus wüst gefallenen Dörfern (Ausbau um die Teichstraße) entstand aus der Auenrandsiedlung an der Parthe ein straßenangerähnliches, dreiflügeliges Zeilendorf mit Gewannfluren, wie auf der Flurkarte von 1840 (siehe S. 27) gut zu erkennen ist.
Die weithin sichtbare Panitzscher Kirche, 1928.
Urkundliche Ersterwähnung und häufiger Besitzwechsel
In einer Besitzteilungsurkunde des Stiftes Merseburg für die Brüder von Friedeburg vom 14. Februar 1267 wurde Panitzsch erstmals urkundlich erwähnt. Die wohl aus dem Mansfeldischen kommenden Edelherrn von Friedeburg waren eines der wenigen Herrengeschlechter der Kolonisationszeit, die im Osten Leipzig namhaft wurden. Hoyer der Jüngere von Friedeburg erhielt außer dem linkssaalischen Besitz den Ort „mit allen Zubehörungen“. Damit gemeint waren wahrscheinlich einige Dörfer zwischen Leipzig und Naunhof, darunter unter anderem Althen, Borsdorf und Zweenfurth. Doch schon am 29. April 1269 verkaufte Hoyer der Jüngere diesen Besitz, die „villa Bansc“, an den Bischof Friedrich von Merseburg. Damit ging Panitzsch in kirchlichen Besitz über, nachdem es bisher der Verwaltung des Markgrafen Dietrich von Landsberg unterstand. Daran änderten die nachfolgenden Einsprüche des Landgrafen mit teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen nichts, denn der Bischof konnte diese Besitzungen in Vergleichen mit dem Markgrafen 1270 und 1272 behaupten.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wirkte sich die rasche Besiedlung negativ aus, die Böden waren nicht mehr ertragreich und die Bevölkerungszahlen sanken durch Abwanderungen der Ansiedler stark ab. In der unmittelbaren Umgebung von Panitzsch entstanden Wüstungen wie das nach 1349 verlassene Dorf Wilchwicz (oder Wilwisch) zwischen Panitzsch und Sommerfeld, wovon heute noch die Bezeichnung Wilwischgraben zeugt. Im Osten lag etwa 1350 Conradisdorf oder Conradsdorf, in der Nähe des heutigen Cunnersdorf gelegen, dessen Bewohner nach Panitzsch umsiedelten. 1438 wies Markgraf Friedrich V. von Meißen als Landesherr Panitzsch mit seinen Einkünften der Leipziger Universität zu. 1467 werden als Grundherrn die Brüder Meisenburg genannt, an die 33 Bauern (auch als „Wirte“ bezeichnet) entsprechend der Größe ihres Besitzes Abgaben zahlten.
Panitzsch wird Leipziger Ratsdorf
Kurfürst Johann Georg und das Domkapitel zu Merseburg genehmigen den Kauf des Dorfes Panitzsch seitens des Rates zu Leipzig von Oswald aus dem Winkel, 3. Februar 1612.
1534 lag die Grundherrschaft über Panitzsch beim Rittergut Taucha, von dem es die Herren von Bünau auf Brandis kauften und in ihr bereits 1516 erworbenes Rittergut Cunnersdorf eingliederten. Aufgrund der hohen Verschuldung war diese Adelsfamilie jedoch bald zum Verkauf des Rittergutes gezwungen. Starkes Interesse bekundete der Leipziger Rat, dem schon andere ländliche Güter und verschiedene Ortschaften außerhalb seiner Stadtgrenzen gehörten. Schon 1601 ließ Leipzig einen „Anschlag“ (Schätzung) über das stark belastete Cunnersdorf anfertigen. Nach längeren Verhandlungen über den Kaufpreis und die Ablösung der bestehenden Schulden kaufte der Leipziger Rat im August 1607 das Rittergut Cunnersdorf mit dem Ort Panitzsch „mit Zinsen und allen Gerichten“ vom vormaligen Besitzer Oswald aus dem Winkel auf Brandis. Als Kaufsumme verzeichnen die Leipziger Stadtkassenrechnungen rund 18.500 Gulden Nürnberger Währung (= 14.095 Meißnische Gulden). Den Kauf der Merseburgischen Güter schloss der Rat ab, ohne sich an die früher übernommene Verpflichtung zur Einholung der Zustimmung des Domkapitels zu halten, zu dessen Lehnsgebiet auch Cunnersdorf gehörte. Und so führte die unberechtigte Belehnung des Leipziger Rates mit dem gesamten neu erworbenen Besitz durch den Landesherrn zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Domkapitel in Merseburg. Ob es allein an der Versicherung des Leipziger Bevollmächtigten lag, „daß man nur aus Unwissenheit versäumt habe, die Erlaubnis einzuholen“ und um „nachträgliche Genehmigung“ bat, ist fraglich. Die Quellen halten nur die tatsächliche Belehnung mit „dem Gut Cunnersdorf samt den Gerichten oberst und niederst über Hals und Hand in Cunnersdorf und Panitzscher Mark sowohl im Dorf Panitzsch auch das Kirchenlehen daselbst...“ urkundlich fest. Zum neuerworbenen Gut gehörten „etwa 170 Acker Feld, stattliche Teiche und Triftrechte auf beiden Fluren“. Panitzsch mit seinen 36 Nachbarn (davon sechs Pferdner) das größte Dorf im Umkreise, trieb den Ratsbesitz weiter nach Osten. Die meisten Dörfer an der Parthe gehörten jetzt mit voller Gerichtsbarkeit der Stadt Leipzig“, stellte Werner Emmerich in seinem Buch zum ländlichen Besitz des Leipziger Rates 1936 fest.
Die Erwerbung von Panitzsch und Cunnersdorf fiel in eine Zeit der umfassenden Rittergutsankäufe durch den Rat der Stadt Leipzig, beginnend mit dem Erwerb der Lehnsherrschaft über das Rittergut Taucha im Jahr 1569. Mit der Ratslandstube entstand eine einzigartige städtische Verwaltungsstelle für die eigenen „Land- und Rittergüter“. In den für die Stadt Leipzig ausgestellten Besitzurkunden, den Stadtkassenrechnungen bzw. den Unterlagen der Landstube bzw. des Ratslandgerichtes finden sich zahlreiche Belege zu den Bewohnern des Ortes Panitzsch, zu Besitz- und Abgabeverhältnissen sowie zu juristischen Auseinandersetzungen der Bewohner untereinander oder mit Nachbargemeinden wegen Grundstücksgrenzen oder des Wegerechts.
Aus dem ländlichen Besitz standen dem Rat der Stadt Leipzig als Grund- und Gerichtsherr eine Reihe von „Erträgnissen“ in Form von Geld- und Naturalleistungen, darunter Getreide, Hühner, Lämmer oder Brotlieferungen, zu. Für Panitzsch ist beispielsweise überliefert, dass ein „Nachbar“ zwei Gulden und fünf Groschen zahlen musste sowie ein Huhn abzuliefern hatte. Allerdings waren die Dorfbewohner nicht allein gegenüber dem Grundherrn abgabenpflichtig, sondern ebenso gegenüber dem Pfarrer („Pfarrlehn“) sowie dem Schullehrer (Schullehn). Von persönlichen Frondiensten waren die Bewohner der Leipziger Ratsdörfer allerdings befreit.
Die Landerwerbungen brachten dem Leipziger Rat nicht immer den erhofften wirtschaftlichen Gewinn. Schon 1610, also kurz nach dem Kauf von Cunnersdorf und Panitzsch, zeichneten sich finanzielle Schwierigkeiten ab, die schließlich während des Dreißigjährigen Krieges aufgrund der hohen Kriegskontributionen 1625 ihren Höhepunkt erreichten. In Panitzsch selbst entstanden durch die Truppendurchzüge, Einquartierungen und Plünderungen große Schäden. Als Ausweg blieb dem Leipziger Rat schließlich nur die Wiederveräußerung von Besitzungen möglichst gegen Barzahlung. Als dies nicht gelang, verpfändete der Rat 1627 fast alle Rittergüter und acht Ortschaften, darunter nicht zuletzt Taucha und Cunnersdorf mit Panitzsch an den vom Landesherrn eingesetzten Finanzkommissar David von Döring. Der Leipziger Rat verlor damit fast vollständig die Kontrolle über die verpfändeten Güter.
Aufnahme aus dem alten Ortskern von Panitzsch mit einem typischen Dreiseitenhof.
Als der Finanzkommissar von Döring 1638 verstarb, nahm der Rat der Stadt Verhandlungen mit seinen Erben auf, die schließlich 1650 zum Erfolg führten. Da die Schuldsummen mit den Einnahmen fast ausgeglichen waren, stimmten die Erben der Rückgabe von Taucha mit Plösitz und Pröttitz sowie von Cunnersdorf mit Panitzsch an die Stadt Leipzig zu. Allerdings waren zwischenzeitlich Cunnersdorf und Panitzsch ohne Rechtsgrundlage durch die Döringschen Erben an Hans Ulrich von Grünroth gegeben worden. Erst nachdem der Rat 1666 die ausstehenden Schulden an Grünroth bezahlte, gehörten Cunnersdorf und Panitzsch wieder uneingeschränkt der Stadt Leipzig.
Die Gerichtsbarkeit im Rittergut Cunnersdorf sowie im Dorf und in der Flur Panitzsch für Angelegenheiten der Obergerichte (Strafgerichtsbarkeit über Kopf und Hand) und der Niedergerichte für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung lagen beim Leipziger Rat. Als Guts- und Gerichtsherr wurde der Leipziger Rat durch Beamte des Ratslandgerichts vertreten, die in Panitzsch Gerichtstage abhielten. Als Richter ernannte der Rat auf Lebenszeit Panitzscher Nachbarn, die zum Kreis der „Ansässigen“ (Landeigentümer, als Hufner oder Gutsbesitzer bezeichnete Bauern) gehörten, denen bis zu vier Beisitzer (Gerichtsschöppen) zur Seite standen. Richter und Schöppen bildeten das Ortsgericht. Die Gerichtstage fanden in der Regel in den Spätherbst- oder Wintermonaten in der Wohnstube des Ortsrichters, in der Pfarrwohnung oder in einer Schankstube statt.
Die Verhältnisse, Rechte und Pflichten der Altgemeinde waren in der vom Grundherren bestätigten Dorfordnung festgehalten. Diese wurden ursprünglich mündlich überliefert und erst seit dem 15. Jahrhundert schriftlich festgehalten. Die Dorfordnung wurde auf den jährlichen Gerichtstagen, zu denen nach festgelegtem Ritual zusammengerufen wurde, öffentlich vorgelesen und bis ins 19. Jahrhundert immer wieder den veränderten Bedingungen angepasst. Für einzelne Angelegenheiten bestand außerdem die Zuständigkeit des Königlichen Kreisamtes Leipzig als landesherrliche Unterbehörde. Nach der Umsetzung der sächsischen Justizreform von 1856 übernahm das Königliche Gerichtsamt in Taucha alle Justizangelegenheiten.
Prunkwappen der Stadt Leipzig am Altar der Panitzscher Kirche.
An das Patronatsrecht des Leipziger Rates erinnert noch heute das Leipziger Stadtwappen, das sich an der 1705 geschaffenen Altaranlage in der Kirche befindet und ebenso auf der kleinsten der drei Kirchenglocken aus dem Jahr 1756 zu sehen ist. Erwähnt werden soll an dieser Stelle noch, dass vom 20. März 1697 bis zu seinem Tode am 16. Juli 1729 Magister Johann Jacob Vogel aus Leipzig als Pfarrer in Panitzsch wirkte. Bis heute ist Vogel durch sein „Leipzigisches Geschicht-Buch Oder Annales“ für den Zeitraum vom Jahr 661 bis 1714 bekannt, einem Werk, das für die Geschichte der Stadt Leipzig und deren Umgebung nach wie vor unentbehrlich ist.
Einwohnerzahlen und sozialer Status
Zunächst veränderte sich die Zahl der in Panitzsch lebenden Einwohner kaum. 1552 nennen die Quellen für Panitzsch 34 „besessene“ Mann (auch als Hufner bezeichnet), fünf Häusler (ohne Grundbesitz; sie verdienten ihren Unterhalt als Tagelöhner für die Guts- und Grundherrn, die Gemeinde oder die Pfarrei) sowie fünf „Inwohner“.
Seit dem 11. Jahrhundert entstand die Dorfflur in Hufeneinteilung. Ein Hufner war ein Bauer, der als Grundbesitz eine, mehrere oder einen Teil einer Hufe Land bewirtschaftete. Die Gesamtheit der bald alteingesessenen landbesitzenden Hufner bildete die sogenannte Altgemeinde des Dorfes. Ein Hufner war Vollmitglied der Gemeinde der Bauern, besaß Mitspracherecht in der Gemeinde und ihm stand die Nutzung des „Allgemeingutes“ (der Allmende) wie an Wegen, Wiesen oder Gewässern außerhalb der parzellierten, in Fluren aufgeteilten Flächen zu. In der sozialen Hierarchie der dörflichen Gemeinschaft standen die Hufner als Vollbauern und Besitzer eines Hofes mit Land von einer Fläche zwischen 30 bis zu 100 Morgen vor den Häuslern, die niemals Mitglied der Altgemeinde werden konnten. Die ursprünglich freien Dorfgemeinschaften waren im Laufe der Zeit jedoch immer stärker unter die Verwaltung der Grundherrschaften gekommen, so dass ihnen in ihrer eigenen Zuständigkeit nur noch die Regelung der kleinen alltäglichen Dinge verblieben war.
Das Erbregister von 1684 verzeichnete fünf Pferdner, 30 Hintersassen (Hufner) und fünf Drescher, letztere im Ostteil des Dorfes wohnend. Die Pferdner waren wie die Hufner Besitzer eines Gutes und betrieben die Landwirtschaft mit Pferden. 1764 sind 35 „besessene“ (besitzende) Mann und zwölf Häusler aufgeführt. Diese Zahlen geben keinen Anhaltspunkt über die jeweiligen Familiengrößen, zu denen in der Regel neben der Ehefrau eine unterschiedliche Zahl von Kindern gehörte.
Die in den Quellen in der jeweiligen Zeit unterschiedlich bezeichneten Eigentümer an Grund und Boden werden später als „Gutsbesitzer“ geführt. Sie waren jedoch keine Großgrundbesitzer in unserem heutigen Verständnis dieses Begriffes, sondern besaßen ein Bauerngut mit einer Grundfläche von bis zu 30 Ackern. Der größte Teil der Fläche war Feld. Außerdem gehörten zu den Bauerngütern meist ein Acker Wiese sowie verschieden große Waldflächen. Die Nutzfläche für einen Hufner lag damit bei knapp 10 bis 20 Hektar Bodenfläche. In Panitzsch gab es aber nicht nur „Vollhufner“, sondern auch Halb- oder sogar nur Viertelhufengüter mit einer entsprechend geringeren Anbau- und Nutzungsfläche. Keine landwirtschaftlichen Nutzflächen gehörten dagegen zu den gemeindlich verwalteten Gebäuden wie dem Armenhaus oder den im Ort liegenden Wohngebäuden ohne Feld und Wiese.
Neben einer gemeinsamen „Badstube“, ohne Trennung nach Männern und Frauen, gab es in Panitzsch einst sogar ein Brauhaus, das sich vermutlich in einem der sechs Häuser gegenüber dem Gutshaus befand. Im sogenannten Spießhaus wurden „Übeltäter“ eingeschlossen und von den Dorfbewohnern gemeinsam bewacht. Bereits im 16. Jahrhundert besaß Panitzsch eine Windmühle im Dorf sowie einen Dorfschmied. Für sonstige Handwerksleistungen mussten Handwerker aus dem Umland beauftragt werden.
Im „Vollständigen Staats-Post- und Zeitungs-Lexikon von Sachsen“ zeichnet der Autor August Schumann 1821 folgendes zeitgenössisches Bild von Panitzsch: „Panitzsch, ein bedeutendes Pfarrkirchdorf im Königr. Sachsen, Leipziger Kreisamtes, gehört zu dem, 3/8 Stunde davon östlich gelegenen schriftsässigen Rittergute Cunnersdorf, folglich dem Leipziger Stadtrath. Es liegt am Rande der Pardenaue, auf einem Hügel über dem linken Ufer des Flusses, 2 ½ Stunden östlich von Leipzig, 3/4 Stunden südöstlich von Taucha, 5/43 Stunden nordwestlich von Brandis, gegen 450 Pariser Fuß über dem Meere, in einer fruchtbaren Gegend, die jedoch außerhalb der Aue wenig Annehmlichkeit besitzt; durch das Dorf geht auch die, fast durchaus (aber jetzt schlecht genug) gepflasterte Straße, an deren Statt jetzt die Chaussee (nämlich nach Dresden) über Borsdorf geführt ist, und welche nächst Gerichshayn wieder auf die neue Straße trifft. Panitzsch hat in 70 Häusern gegen 306 Bewohner, viel starke Güter mit 26 Hufen, einen sehr geringen Gasthof, eine Windmühle in West und eine Wassermühle in Ost; eine Brücke über den Fluß, die geistlichen Gebäude u.s.w. Die Parochie begreift noch die Filiale Althen und Sommerfeld (weshalb der Pfarrer an manchen Festtagen 4mal zu predigen hat) und gehört zum Tauchaer Kreis der Ephorie, die Collaturen übt der Leipziger Rath... Bei Panitzsch findet man gute Feuersteine... In den Fluren grenzt es mit Borsdorf, Ritterg. Cunnersdorf, Sehlis, Plösitz, Sommerfeld und Althen“.
Bis 1834 stieg die Einwohnerzahl auf 403 Bewohner, von denen 21 in Cunnersdorf und 381 in Panitzsch lebten.
Ablösung der Altgemeinde/Übernahme der Verwaltung durch den Gemeinderat (um 1840)
Im Zuge der revolutionären Umwälzungen 1830 in Sachsen, der Errichtung der konstitutionellen Monarchie und der bürgerlich-liberalen Reformen wurde bereits 1832 die Sächsische Städteordnung erlassen. Die Verwaltung und Verfassung der Dörfer in Sachsen war ebenso reformbedürftig wie jene der Städte. Nach 1830 zerfielen die feudalen Strukturen in Sachsen immer mehr und die Erb-, Lehns- und Gerichtsherrschaften wurden in ihren Befugnissen mit der Zeit weiter eingeschränkt. Die sächsischen Gemeinden erhielten mit der Sächsischen Landgemeindeordnung vom 7. November 1838 ab 1. Mai 1839 formell das Selbstverwaltungsrecht. Die Bauern und Dorfbewohner wurden jedoch als unmündige Untertanen angesehen und unterstanden weitaus stärker als die Städter der „obrigkeitlichen“ Aufsicht durch die sächsische Staatsverwaltung bzw. deren Lokal- und Regionalbehörden (Ämter bzw. Gerichtsämter, Amtshauptmannschaft und Kreisdirektion). Die traditionell gebräuchliche Bezeichnung „Dorf“ wurde nicht übernommen, sondern das Gesetz verwendet den Begriff „Landgemeinde“.
Die Landgemeindeordnung erweiterte die volle Gemeindemitgliedschaft über den Kreis der in der alten Dorfgemeinde zusammengeschlossenen Bauern hinaus, indem sie alle Personen, die in der Gemeinde Grundbesitz oder ihren ständigen Wohnsitz (ohne Grundbesitz) hatten, einbezog. Über die Aufnahme von „Fremden ohne Grundstücke“ in eine Gemeinde entschied nicht diese selbst, sondern die Obrigkeit. Stimmberechtigt in allen Gemeindeangelegenheiten waren jedoch nur die im Gemeindebezirk ansässigen Gemeindeglieder, d. h. die Besitzer von Grund und Boden, wobei pro ungeteiltem Grundstück nur ein Mitglied das Stimmrecht besaß. Nicht stimmberechtigt war, wer mit Abgaben länger als zwei Jahre in Verzug geriet, wer der Armenkasse „anheim fiel“ (kein eigenes Einkommen hatte), als „Verschwender oder Geisteskranker“ galt, wer verschuldet war, als Straftäter oder „Verbrecher“ von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen oder „durch unsittliche Aufführung der öffentlichen Achtung sich verlustig gemacht“ hatte. Das Stimmrecht war persönlich auszuüben; bei verheirateten Frauen durften nur die Ehemänner an den Gemeindeversammlungen teilnehmen. Damit wurden die bisher von der Dorfgemeinde ausgeschlossenen Gärtner und Häusler zwar mit einbezogen, aber die sonstigen Angehörigen der grundbesitzlosen dörflichen Unterschicht blieben weiterhin ohne Mitwirkungsrechte in der Gemeinde.
Die Inhaber der Grundherrschaft beaufsichtigten nach wie vor das gesamte Gemeindewesen sowie die Wahl des Gemeindevorstandes, genehmigten Ortsstatuten, verwalteten die Ortspolizei, entschieden Streitigkeiten und berichteten in Polizei- und Gemeindeangelegenheiten an die unmittelbar vorgesetzte Landesbehörde. Ortsobrigkeit war die Behörde, der die Erbgerichtsbarkeit zustand. Für Panitzsch lag damit bis zur Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit 1856 die Zuständigkeit bei der Landstube bzw. beim Ratslandgericht des Rates der Stadt Leipzig.
Vermutlich wurde in Panitzsch erstmals nach 1840 ein Gemeinderat gewählt. Allerdings liegen darüber keinerlei Unterlagen mehr vor. Das früheste überlieferte Protokollbuch für die Gemeinde Panitzsch beginnt mit Einträgen ab dem 1. Januar 1870. Erhalten geblieben ist allerdings das erste, am 28. Oktober 1848 verfasste und Mitte November 1848 vom Amt Leipzig genehmigte Ortsstatut für Panitzsch, das folgende Angaben enthielt: Das Gemeindegebiet umfasste alle Grundstücke, die im Flurbuch vom 30. September 1840 erfasst waren, außer einer in der Ortsflur Sehlis liegenden Wiesenparzelle des Rittergutes Cunnersdorf. Jeder neu Zuziehende hatte sich bei der Gemeinde anzumelden und eine „Aufnahmegebühr“ von 2 Talern zu entrichten, die für Ausgaben der Ortsarmenkasse dienten. Bei jeder Eigentumsübertragung war eine Gebühr zu entrichten, unabhängig davon, ob es sich um Verkauf, Tausch, Schenkung oder Erbschaft handelte.
Die Verwaltung des Ortes lag nun nicht mehr in der Hand der Stadt Leipzig als Gerichtsherr, sondern wurde von einem gewählten Gemeinderat übernommen. Der Gemeinderat bestand aus dem Gemeindevorstand (vergleichbar mit einem ehrenamtlichen Bürgermeister), drei bzw. später zwei Gemeindeältesten und zwölf Gemeindeausschussmitgliedern. Diese Personen wurden über Wahlmänner gewählt. Für die Wahlen wurden die stimmberechtigten Gemeindemitglieder in drei Wahlklassen gegliedert: Gutsbesitzer, Hausbesitzer und Unangesessene (Gemeindemitglieder ohne Grundbesitz). Aufgrund der Besitzverhältnisse in Panitzsch waren beispielsweise 1848 acht Gemeinderatsmitglieder Gutsbesitzer, zwei waren Hausbesitzer und zwei Unangessene. Der Gemeinderat wurde auf sechs Jahre gewählt. Jährlich sollte ein Drittel der Mitglieder ausscheiden, wobei eine Neuwahl der bisherigen Mitglieder möglich war.
Die Geschäfte des Gemeinderates regelten sich nach § 38 der Landgemeindeordnung. Der erste Gemeindeälteste hatte das gesamte Abgabenwesen zu verwalten, der zweite die Aufsicht über die Instandhaltung der Wege zu führen; der dritte vertrat den Vorstand bzw. die beiden ersten Gemeindeältesten im Verhinderungsfall. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhielten der Gemeindevorstand jährlich 15 Taler, die drei bzw. zwei Gemeindeältesten lediglich drei Taler als Aufwandsentschädigung aus der Gemeindekasse. Zur Schlichtung einfacher Streitfälle wurde von der Stadt Leipzig als Oberbehörde zusätzlich ein Lokalrichter eingesetzt, der mit 15 Talern pro Jahr zu entschädigen war. Diese Sätze wurden im Laufe der Zeit durch verschiedene Nachträge zum Ortsgesetz angepasst und erhöht. So erhielt der Gemeindevorstand 1886 für seine Tätigkeit ein Gehalt von 400 Mark jährlich. Die Entschädigung für den immer noch ehrenamtlich tätigen Gemeindevorstand betrug im Januar 1918 bereits 2.000 Mark und stieg im Januar 1919 auf jährlich 2.400 Mark. Den übrigen ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern wurden lediglich anfallende Auslagen erstattet. Alle für die Gemeindeverwaltung aufzuwendenden Beträge (Ausgaben) mussten aus der Gemeindekasse beglichen werden. Reichten die aus Gebühren, Geldstrafen, Ablösesummen und sonstigen Beträgen erzielten Einnahmen nicht aus, konnte der Gemeinderat eine „Anlagenerhebung“ von den Gemeindemitgliedern beschließen. Die Planung der Ausgaben erfolgte ebenso wie die jährliche Abrechnung durch Beschlüsse im Gemeinderat. Allgemeine Bekanntmachungen wurden durch Aushänge im späteren Gemeindebüro und zeitweise im Gasthaus „Zum Hirsch“ oder durch besondere Umläufe veröffentlicht.
1840 wohnten in Panitzsch annähernd 400 Einwohner, die sich auf 20 Häuser und 40 Nachbarstellen verteilten. Nach den Besitzverhältnissen sind für dieses Jahr angegeben: sechs Pferdnergüter, siebzehn Hufengüter, elf Halbhufengüter, ein Viertelhufengut, sechs Dreschergüter, zwei Häusler und sechs „Brauhäuserchen“. Außerdem gab es eine Windmühle, die Krämerei und einen Erbschmied. Die Fläche der Gemeinde umfasste rund 770 Hektar.
Die 40 Nachbarberechtigten finden sich ebenfalls im Anhang zum Ortsstatut von 1848 als Besitzer von Grundstücken, die mit den Nummern des Brandkatasters bezeichnet sind. Ihnen wurden die Nutzung und das gemeinsame Eigentum an 32 Grundstücken übertragen, die mit den Nummern des Panitzscher Flurbuches einzeln aufgeführt wurden. Genannt werden der Dorfanger und die Dorfstraßen sowie die „Communicationswege“ (öffentliche Wege von Panitzsch in die umliegenden Orte), eine alte Sandgrube (als Kirchloch bezeichnet) sowie zwei Wasserbrunnen. Zu den Pflichten der Grundstückseigentümer gehörten neben der Besoldung des Richters der Bau bzw. die Instandhaltung aller Wege, der Brücken, Schleusen, Stege im Gemeindebezirk einschließlich der Lieferung des Baumaterials, die Räumung des Schnees, das „Botschaftsgehen“ in Kriegs- und Friedenszeiten, das Weiterleiten von gerichtlichen Patenten sowie die Beförderung von Briefen in Gemeindeangelegenheiten „ohne Zutun der Häusler und Unangesessenen“. Außerdem mussten Wachdienste beim Auffinden von Toten und bei Gefangenentransporten von sämtlichen Gemeindemitgliedern geleistet werden, wenn dazu nicht ausdrücklich bestimmte Personen benannt worden waren. Die Häusler und Unangesessenen durften aus den Teichen der Grundbesitzer Wasser holen, aber nicht darin baden. Verboten war ihnen das Wäschewaschen sowie das Tränken des Viehs in den Teichen.
Ausschnitt aus dem „Situationsplan von dem Orte Panitzsch, Aufgenommen und gez(eichnet) im Monat Mai 1853. Friedrich August Kästner, Brand. Versicher(ungs) Assistent“.
Nach Abschnitt 13 des Ortsstatuts verpflichteten sich die 40 Nachbarschaftsberechtigten, die Gemeinderatsversammlungen in dem ihnen gehörenden Gemeindehaus unentgeltlich stattfinden zu lassen sowie dieses Gebäude instand zu halten. Das Gemeindebuch sowie sämtliche Papiere zur Gemeindeverwaltung mussten in einer „Gemeindelade“ bzw. in einem „Gemeindeschrank“ verwahrt werden. Bei den Vermögenswerten der Gemeinde wurden 1848 neben den Geräten zur Feuerbekämpfung (einer Spritze, vier Sturmfässern, drei Leitern und drei Haken), das Gemeindesiegel, Gegenstände zur Leichenbestattung (Leichenbahre, Totentuch) das Gemeindearmenhaus im Grundstück Nr. 59 B aufgeführt sowie der Bestand der Armenkasse mit 503 Talern angegeben. In späteren Verzeichnissen wurden außerdem drei Dorfteiche und eine alte Sandgrube als Gemeindevermögen aufgeführt.
Das Ortsstatut von 1848 unterzeichneten Friedrich August Klas als Gemeindevorstand sowie ein Beamter des Ratslandgerichts Leipzig. Im Jahr 1886 wurde das Ortsstatut neu erarbeitet, trägt die Unterschriften des Gemeindevorstands Ernst Heinrich Hanke sowie aller Gemeinderatsmitglieder und enthält erstmals Fristen für die Wahl des Gemeindevorstandes durch die Gemeindeältesten. Anhand des maschinenschriftlich abgefassten Ortsstatuts für die Gemeinde Panitzsch vom 2. Oktober 1911 ist ersichtlich, dass zu dieser Zeit Erst Otto Carl Weiland Gemeindevorstand war.
Die Panitzscher konnten auch im Gasthaus zum Hirsch die Aushänge des Gemeinderates zur Kenntnis nehmen.
Die Zusammensetzung und die Anzahl der Gemeindevorstandsmitglieder wechselten immer wieder. Für 1886 sowie für 1911 ist beispielsweise überliefert, dass dem Gemeindeverstand nur acht Ausschussmitglieder angehörten. Davon waren vier Gutsbesitzer. Gleichzeit gab es vier Ersatzmänner, deren Wahl ebenfalls nach Besitzklassen erfolgte.
In enger Verbindung auf dem Weg zur Durchsetzung bürgerlich-liberaler Verhältnisse auf dem Land sind neben dem Inkrafttreten der Landgemeindeordnung die Ablösungen der bisherigen feudalen Abgaben zu sehen. 1841 wurde in Panitzsch die Altgemeinde aufgelöst und es kam in einem langwierigen Prozess zur Ablösung der Lasten, die jeder Einwohner in bisher unterschiedlicher Höhe zu leisten hatte. In der Regel handelte es sich dabei um Geld- und Naturalleistungen. So mussten die Panitzscher zum Beispiel Beiträge für das „Schullehen“, aus dem die Schule unterhalten und der Lehrer finanziert wurde, leisten. Dies konnten je nach Besitz- und Vermögensstand die Lieferung von Broten, Eiern, Korngarben oder ersatzweise die Zahlung von „Hafer“- oder „Häuslergroschen“ sein. Ebensolche Lehen gab es für die Kirche und den Pfarrer. Im Zuge der staatlich geforderten Ablösungen fertigte der Gemeindevorstand Verzeichnisse über die Belastungen pro Grundstück an. Gegen Leistung eines entsprechenden Geldwertes erloschen diese Abgaben künftig. Allerdings mussten die meisten Einwohner dafür Kreditbeträge bei der neugeschaffenen Sächsischen Landrentenbank aufnehmen. Die Ablösung für das Pfarrlehn betrug allein über 3.800 Taler. Verschiedene Zahlungen der Panitzscher an das Rentamt der Stadt Leipzig wie Kalbgeld, Heuwaagegeld und Weinwaagegeld wurden 1846 ebenfalls gegen die Zahlung eines Mehrfachen des bisherigen jährlichen Geldwertes erlassen. 1852 folgte die Ablösung der Handdienste und der Druschfronen der Panitzscher Drescher.
Da sich durch die Ablösungen die regelmäßigen Einnahmen des Staates verminderten, wurde nach 1830 ein neues staatliches Abgabesystem geschaffen, zu dem das Gewerbe- und Personalsteuergesetz von 1834 mit einheitlicher Besteuerung gewerblicher Unternehmen und des persönlichen Einkommens sowie das Gesetz von 1843 zur Einführung eines neuen Grundsteuersystems gehörten. Das Grundsteuergesetz beseitigte alle bisherigen Steuersysteme und -befreiungen. Ausnahmen galten nur für Kirchen- und Gottesdienstgebäude, öffentliche Straßen und Plätze, für Ödlandflächen und für fließende Gewässer. Alle übrigen nutzbaren Grundstücke wurden zur einheitlichen Grundsteuer herangezogen. Zur Umsetzung des Gesetzes erfolgte eine Steuervermessung des Landes, in deren Ergebnis Flurkrokis sowie Flur- und Besitzstandsbücher erstellt wurden. Außerdem wurden Grund- und Hypothekenbücher eingeführt, die bei den zuständigen Gerichten anzulegen waren. Die bisher meist seit dem Ende des 18. Jahrhunderts vergebenen Brandkatasternummern pro Grundstück wurden durch die neuen Flurstücksnummern ersetzt bzw. in Verbindung beider Ziffernsysteme für die Identifizierung von Flächen und deren Eigentümern benutzt. Das Panitzscher Hypothekenbuch enthält unter den Flurnummern 1 bis 53 sowie 57 die privaten Grundstücke. Die Gemeindeschafhirtenwohnung folgt unter Nummer 54, das Gemeindehaus als Nummer 55, mit der Nummer 56 die Gemeindenachtwächterwohnung, mit den Nummern 58 und 59 die Kirche und die Pfarrwohnung sowie unter Nummer 60 die Schulwohnung. Zu dem neuen Steuersystem gehörte seit 1850 die Erhebung indirekter Steuern für Branntwein, Bier, Malz, Wein, Tabak oder die Schlacht- und Stempelsteuer. Die Aufgaben einer Ortssteuereinnahmestelle wurden Privatpersonen übertragen, so zum Beispiel zwischen 1905 und 1910 dem Gasthofbesitzer Hermann Graul.
1856 wurden in Sachsen die Stadt- und Patrimonialgerichte aufgehoben. Damit verlor der Rat der Stadt Leipzig seine Zuständigkeit für Panitzsch und Cunnersdorf. Die Gerichtsbarkeit übernahm das neu eingerichtete Gerichtsamt Taucha bzw. ab 1876 das Amtsgericht Taucha. Die Funktion der ehrenamtlichen Ortsrichter bzw. Gerichtsschöppen und deren Besetzung mit Panitzscher Gutsbesitzern blieben erhalten. So ist zum Beispiel überliefert, dass bis zum Herbst 1885 Karl Jakob sen. das Amt niederlegte und zu dessen Nachfolger der Gutsbesitzer Ernst Otto Karl Weiland ernannt wurde, der später auch als Gemeindevorstand fungierte. Bis in die 1940er Jahre ist die Funktion des Ortsrichters, zu der damals der Bürgermeister Haase ernannt wurde, belegt.
Auch in anderen Bereichen änderten sich die Rechtsgrundlagen. So wurde beispielsweise die seit 1775 geltende Dorffeuerordnung, die unter anderem Passagen zum Brandschutz bei der Errichtung und Ausstattung von Gebäuden enthielt, 1869 durch die Sächsische Baupolizeiverordnung abgelöst.
Die Panitzscher Kommunalgarde 1848
Im Rahmen der bürgerlichen-demokratischen Revolution 1848/1849 konnten für Panitzsch keine besonderen Ereignisse ermittelt werden. Aber die Kunde von den Unruhen in Leipzig erreichte auch das Leipziger Land. Am 21. Mai 1848 wurde zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Ruhe und Ordnung in Panitzsch eine Kommunalgarde errichtet. Zum Dienst waren 20 männliche Einwohner vom 21. bis zum 50. Lebensjahr verpflichtet, die „unbescholtenen Rufes“ sein mussten. Eine Dienstbefreiung konnte nach den Rechtsvorschriften nur erlangen, wer erkrankt war. Nicht zum Dienst zugelassen waren Personen, gegen die gerichtliche Untersuchungen liefen. Den Kommunalgardenausschuss bildeten fünf Personen (Gemeindevorsteher August Klas sowie Gottlob Kinne, Gottlob Schmidt, Wilhelm Brauer als Kommandant und August Rödler). Die Kommunalgarde unterstand dem Generalkommando beim Sächsischen Ministerium des Innern in Dresden, von dem der Ausschuss seine Befehle erhielt. Im April 1849 trat die Althener Kommunalgarde der Panitzscher Garde bei. Die Leitung bei den gemeinsamen Exerzierübungen für die nun insgesamt 60 Gardisten lag weiter beim Panitzscher Kommandanten. Die zeitlich letzten Dokumente zur Kommunalgarde sind für April 1849 überliefert. Daten der Auflösung liegen bisher nicht vor.
Am Deutsch-Französischen Krieg (Reichseinigungskrieg) 1870/71 nahmen 13 Panitzscher teil, von denen zwei Soldaten gefallen sein sollen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Einwohnerzahl in Panitzsch von 514 Bewohnern im Jahr 1871 (Cunnersdorf 19 Einwohner in zwei bewohnten Gebäuden) auf 700 im Jahr 1900 an. Zu dieser Zeit verzeichnete die Gemeindeverwaltung 97 bewohnte Gebäude in Panitzsch. Im Ort gab es seit 1894 eine Kaiserliche Postagentur. Ab 1913 war die Postagentur an den Fernsprechbetrieb angeschlossen.
Panitzsch nach 1900
Aus dem „Handbuch für den Verwaltungsbereich der Königlichen Amtshauptmannschaft Leipzig“, das 1909 erschien, lassen sich folgende Angaben entnehmen: Panitzsch lag als selbständige Gemeinde im Zuständigkeitsbereich der Amtshauptmannschaft Leipzig und hatte 740 Einwohner. Als Gemeindevorstand fungierte der Gutsbesitzer Ernst Otto Carl Weiland, sein Stellvertreter war der Gutsbesitzer Wilhelm Emil Mahler, Gutsbesitzer in Panitzsch. Zu dieser Zeit bestand für Panitzsch ein eigenes Standesamt. Als Standesbeamter war ebenfalls Mahler tätig. Panitzsch bildete mit dem Rittergut Cunnersdorf einen eigenen Schulbezirk, dem Pfarrer Hoffmann gleichzeitig als Vorsitzender des Schulvorstandes und Ortsschulinspektor vorstand. Pfarrer Hoffmann oblag des Weiteren die Leitung des Parchochialbezirkes Panitzsch mit dem Rittergut Cunnersdorf sowie der Tochterkirche in Althen. Für alle Impfangelegenheiten und staatlichen Gesundheitsaufgaben war der Tauchaer praktische Arzt Karl Adam Fischer zuständig. Der zuständige Tierarzt Emil Oskar Richard Fünfstück kam ebenfalls aus Taucha, wo sich außerdem die nächstgelegene Apotheke befand.
Einzelne Aufgaben wurden innerhalb der Amtshauptmannschaft von Beamten oder Beauftragten für verschiedene Gemeinden durchgeführt. So gab es im Bereich der ordnungspolizeilichen Verwaltung einen Gendarmen, der neben Panitzsch und Cunnersdorf für mehrere Orte um Umfeld der Stadt Taucha zuständig war. Als Amtsstraßenmeister fungierte ein in Sellerhausen wohnhafter Baumeister. Da in Panitzsch keine Hebamme ansässig war, übernahm dies aufgrund der örtlichen Nähe die Borsdorfer Hebamme, zu deren Einzugsgebiet außerdem Althen und das Rittergut Cunnersdorf gehörten.
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts veränderte sich das ursprünglich ländliche geprägte Ortsbild mit den Höfen, Stallungen und angrenzenden Ackerflächen. Durch den Verkauf von vormaligen Ackerflächen und deren Umwidmung zum Bauland begann ab 1912 die Errichtung einer „Villenkolonie“ an der Borsdorfer und an der Neuen Straße. Die Bauarbeiten kamen durch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges allerdings zum Stillstand.
Zum Kriegsdienst eingezogen waren in der Zeit von 1914–1918 192 Panitzscher. An die 40 Gefallenen erinnert der Gedenkstein der Gemeinde auf dem Friedhof.
Gedenkstein für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Im Zuge der Novemberrevolution 1919 fanden in Panitzsch Wahlen zu einem Arbeiter- und Bauernrat statt. Auf der Grundlage einer Verfügung des Sächsischen Ministeriums des Innern vom 13. März 1919 versammelten sich am 16. März 1919 im Gasthof Panitzsch 30 Personen in einer angeordneten „Vollversammlung“. Diese wählte vier Personen als Arbeiterräte sowie vier weitere als Bauernräte. Die Bauernräte waren Vertreter aus der Gruppe der Gutsbesitzer, unter ihnen der damalige Gemeindevorstand Max Jacob. Welche Aufgaben der Arbeiter- und Bauernrat tatsächlich wahrnahm, ist nicht überliefert. Schon im Juni 1920 waren diese Gremien in ganz Deutschland wieder aufgelöst worden.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden die Bauarbeiten in der Villenkolonie wieder intensiviert, stagnierten allerdings nochmals Ende der 1920er Jahre im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Ende 1920 entstand durch die Wohnbebauung auf bereits vorhandenen Gartenbauflächen auf Panitzscher Flur die „Dreiecksiedlung“. Der Name ergab sich durch die drei, im Dreieck zusammenlaufenden Straßen, die das Gebiet umsäumten: die Sommerfelder, die Engelsdorfer und die Dresdner Straße. Heute verläuft durch die Dreiecksiedlung der ökumenische Pilgerweg, gekennzeichnet durch eine gelbe Muschel auf blauem Grund als Wegweiser für jeden Jakobspilger.
Anfang 1920 wurden nicht nur die neuen Straßen im Bebauungsgebiet, sondern auch die bisher gebräuchlichen Straßennamen in Panitzsch offiziell mit Namen versehen. Durch den Zuzug von Außerhalb stieg die Zahl der Einwohner von 833 um 1913/1914 auf über 1.000 Personen in 310 Haushaltungen im Jahr 1919 weiter an. Schon 1911 wurde der Ort vom Gemeinde-Elektrizitätverband Oetzsch mit Elektrizität versorgt. Auch die Ortsstraßen erhielten eine elektrische Beleuchtung.
Erst seit dem 1. April 1920 wurde die Gemeinde durch einen hauptamtlichen Bürgermeister geleitet. Diese Funktion übernahm Eduard Friedrich Haase (geb. am 24. Januar 1894 in Deuben als Sohn eines Friseurmeisters). Die Gemeindevertreter wählten ihn 1925 für eine weitere Amtszeit von zwölf Jahren, die vom 1. April 1926 bis zum 1. April 1938 andauerte. Als Vertreter des Bürgermeisters wurden aus dem Gemeindevorstand jeweils zwei Stellvertreter gewählt. Im Mai 1920 erhielt die Gemeinde Panitzsch die Genehmigung der Amtshauptmannschaft Leipzig zur Durchführung öffentlicher Gemeinderatssitzungen. Das Gemeindeamt, das Standesamt und die 1921 eingerichtete Girokasse befanden sich 1926 in der Hauptstraße 62 c und 48, die Postagentur in der Hauptstraße 95.
Das von Panitzsch aus zwei Kilometer östlich gelegene Cunnersdorf wurde 1921 infolge der Auflösung der bisher selbstständigen Gutsbezirke in Sachsen nach Panitzsch eingemeindet und damit unter die Verwaltung der Gemeinde Panitzsch gestellt.
Werbung der Girokasse 1937.
Ursprünglich gab es beim Gemeindevorstand keine Aufgabenteilung. Dies änderte sich jedoch im Lauf der Jahrzehnte, denn durch die wachsenden Einwohnerzahlen erhöhte sich der Verwaltungsaufwand. Deshalb bildete der Gemeinderat mehrere Ausschüsse zur Durchführung von Einzelaufgaben, in die er Vertreter verschiedener Organisationen oder Parteien, aber ebenso einzelne Bürger berief. 1924 bestanden beispielsweise folgende Gremien: Finanz- und Verwaltungsausschuss, Schätzungsausschuss, Wohlfahrts- und Fürsorgeausschuss, Bauausschuss, Feuerlöschausschuss, Kreditausschuss der Girokasse, Wohnungsausschuss, Schulausschuss oder Schlachtviehausschuss. Die Ausschüsse wurden allerdings alle von Bürgermeisterei Haase persönlich geleitet.
Im August 1923 trat in Sachsen eine neue Gemeindeordnung in Kraft, die die Selbstverwaltung der Kommunen stärkte und die Amtszeit der Bürgermeister auf sechs Jahre bzw. bei Wiederwahl bis auf zwölf Jahre festlegte. Schon seit den ersten Jahren der Bildung einer eigenen Gemeindeverwaltung zeigte sich, dass es nicht möglich war, alle Verwaltungsaufgaben eigenständig in Panitzsch durchzuführen. Im Laufe der Jahrzehnte bildete die Gemeinde deshalb einen gemeinsamen Kirchen-, Schul- und Armenverband mit dem Rittergut Cunnersdorf. Ein anderes Beispiel ist die Bildung eines gemeinsamen Knaben- und Mädchenfortbildungsschulverbandes mit der Stadt Taucha seit 1923 sowie die Berufsschulpflicht für die Panitzscher Schüler in Taucha. Derartige Zweckverbände waren in der Gemeindeverordnung von 1923 ausdrücklich gefordert worden.
Enge Kontakte bestanden neben Taucha insbesondere zur benachbarten Gemeinde Althen. Nach verschiedenen Vorabsprachen beschlossen die Panitzscher Gemeindevertreter am 28. September 1932, einer Verwaltungsgemeinschaft zwischen den Gemeinden Panitzsch und Althen grundsätzlich zuzustimmen. Nach Prüfung verschiedener Formalien, insbesondere der Höhe der finanziellen Verbindlichkeiten Althens, übernahm der Panitzscher Bürgermeister Haase in Personalunion die Amtsgeschäfte der damals 490 Einwohner zählenden Nachbargemeinde. Panitzsch bildete nun mit Althen einen zusammengesetzten Standesamtsbezirk. Panitzsch mit Cunnersdorf zählte zu dieser Zeit insgesamt 1.320 Einwohner.
Zwischen 1934 und 1936 entstanden in Panitzsch neue Häuser in der Querstraße. Die Einwohnerzahl erhöhte sich nochmals um fast 40 Bewohner und lag 1935 bei 1.350 Einwohnern in rund 400 Haushaltungen. Die Gemeinde war Eigentümer von drei Wohngebäuden mit insgesamt 15 Wohnungen. Zu dieser Zeit betrug die Gemeindefläche 2.000 sächsische Acker (rund 1.100 Hektar). Die Ortsstraßen wiesen eine Länge von insgesamt fast 17 Kilometern auf. 1934 betreute die Girokasse in Panitzsch rund 300 Konten mit einer Einlage von über einer Million Reichsmark. In einem Bericht an die Amtshauptmannschaft Leipzig im Juli 1935 kennzeichnete Bürgermeister Haase die Gemeinde Panitzsch mit folgenden Worten: „Sie trägt den Charakter einer Arbeiterwohnsitzgemeinde, hat starken Durchgangsverkehr und wird auch als Ausflugsort von Leipzig aus sehr besucht.“
Politische Verhältnisse im Gemeinderat während der Weimarer Republik
Seit den 1920er Jahren gehörten Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und der späteren (Vereinigten) Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) als gewählte Vertreter dem Panitzscher Gemeinderat an. Beide Arbeiterparteien hatten Ortsvereine in Panitzsch und leisteten offensichtlich eine erfolgreiche politische Arbeit. Bei den Gemeindeverordnetenwahlen 1923 erhielten die SPD und eine weitere Arbeiterliste über 35 Prozent aller abgegebenen Wählerstimmen und besetzten fünf Sitze im Gemeindeverordnetengremium. Die Stimmenmehrheit erzielte allerdings eine gemeinsame Liste der „Bürgerpartei“, so dass dieser acht Sitze bei den Gemeindeverordneten zustanden. Bei der Reichspräsidentenwahl am 29. März 1925 waren in Panitzsch 734 Personen wahlberechtigt. Bemerkenswert ist, dass für den Kandidaten der KPD, Ernst Thälmann, 46 Personen stimmten, Erich Ludendorff für die Deutschvölkische Freiheitspartei jedoch nur drei Stimmen erhielt. Die Mehrheit der Panitzscher Stimmen fiel allerdings mit Dr. Karl Jarres auf einen Vertreter der rechtskonservativen Deutschnationalen Volkspartei.
Mitglieder der KPD und der SPD besetzten in der Folgezeit zeitweise sechs oder sieben von insgesamt 13 Gemeindeverordnetensitzen. So saßen 1926 jeweils drei Kommunisten und drei Sozialdemokraten im Gemeinderat, während die „Bürgerpartei“ sieben Sitze inne hatte. In der Wahlperiode zwischen 1926 und 1929 veränderte sich die Zusammensetzung der Gemeindevertreter leicht, da ein KPD-Mitglied in die SPD übergetreten war.
1927 wählten die Gemeindeverordneten den Schriftgießer Paul Lippmann (SPD) zu ihrem Vorsteher, 1928 zum ersten Stellvertreter. Ab 1928 bekleidete nach Abstimmung der Gemeindeverordneten Bürgermeister Haase das Amt des Gemeindeverordnetenvorstandes in Personalunion selbst. Die beiden Stellvertreter des Vorstandes, der Bankbeamte Otto Prinz und der Gutsbesitzer Paul Polter, gehörten einer bürgerlichen Partei an. 1931 und 1932 wurde Paul Lippmann erneut als 2. Stellvertreter des Gemeindeverordnetenvorstehers gewählt, Otto Prinz blieb 1. Stellvertreter.
Stimmzettel der Arbeiterparteien zur Gemeindeverordnetenwahl 1923
Ergebnisse der Gemeindeverordnetenwahlen 1923 bis 1933
| Wahldatum | Abgeg. Stimmen (Sitze) | Abgeg. Stimmen (Sitze) | Abgeg. Stimmen (Sitze) | Abgeg. Stimmen (Sitze) | Abgeg. Stimmen (Sitze) |
| Bürgerl. Einheitsliste | SPD | Arbeitervertreter | KPD | NSDAP | |
| 13.01.23 | 327 (8) | 121 (3) | 84 (2) | --- | --- |
| 14.11.26 | 324 (7) | 144 (3) | --- | 105 (5 | --- |
| 17.11.29 | 378 (8) | 194 (4) | --- | 66 (1) | --- |
| 13.11.32 | 353 (8 bzw. 7) | 215 (4) | --- | 152 (2) | --- |
| 01.04.33 | --- | 222 (3) | Andere Parteien | --- | 429 (7) |
Für das Jahr 1933 entstand eine neue Konstellation bei den Gemeindeverordneten. Der Arbeiter Franz Rudolph (KPD) wurde als Vorsteher der Gemeindeverordneten gewählt, als 1. Stellvertreter Paul Lippmann und der Arbeiter Friedrich Kretzschmar (KPD) als zweiter Stellvertreter. Es ist nicht überliefert, inwieweit die Vertreter der „Bürgerlichen Einheitsliste“ sich dem widersetzen. Obwohl der Gendarmerieposten Engelsdorf am 25. Januar 1933 darauf hinwies, dass Kretzschmar führendes Mitglied der Ortsgruppe der KPD war und bei „Versammlungen hetzerische Reden“ hielt, bestätigte die Amtshauptmannschaft Leipzig zu diesem Zeitpunkt seine Wahl.
Nach Korrektur der Stimmenauszählung der Wahl vom November 1932 wurde die Wahlliste der Gemeindeverordneten im Januar 1933 berichtigt. Die bürgerliche Einheitsliste verlor eine Stimme an die KPD. Dadurch erhielt mit der Hausfrau Gertrud Peucker erstmals eine Frau überhaupt in Panitzsch ein öffentliches Amt als Gemeindevertreter. Dies sollte allerdings bis nach 1945 so bleiben. Allerdings konnten die KPD-Mitglieder aufgrund der politischen Radikalisierung ihre Ämter nicht mehr ausüben.
Interessant ist, dass nicht nur während der Zeit der Weimarer Republik, sondern über 1933 hinaus, beim Standesamt Panitzsch eine relativ hohe Zahl von Kirchenaustritten registriert wurde, wie an wenigen Beispielen gezeigt werden soll: 1921=93, 1925=44, 1936=2 und 1939=18 Personen. Dies ist vermutlich mit dem Zuzug von Arbeitern, aber außerdem mit der Zunahme der NSDAP-Mitglieder im Ort allgemein sowie vor allem in der antikirchlichen Politik und Propaganda des NS-Regimes begründet.
Gleichschaltung der Kommunalverwaltung von 1933 bis 1945
Bis Ende der 1920 Jahre übten Vertreter der bürgerlichen Parteien im Gemeinderat die Stellvertreterfunktion für den Bürgermeister aus. Doch Anfang der 1930er Jahre änderten sich hier ebenfalls die politischen Verhältnisse. Der Schriftgießer Paul Lippmann (SPD) übernahm zeitweise die Funktion des ehrenamtlichen zweiten, später des ersten Stellvertreters. Kurz nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933 traten neue Rechtsvorschriften wie die Verordnung über die Neubildung der Gemeindekörperschaften vom 6. April 1933 in Kraft. Im Vorfeld erging am 11. März 1933 eine Mitteilung der Amtshauptmannschaft Leipzig an alle Bürgermeister, in der angedroht wurde, „Gemeindeleitern und ihren Stellvertretern mit marxistischer Weltanschauung die Polizeigewalt zu entziehen, da sie keine Gewähr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ böten. Zunächst meldete Bürgermeister Haase, dass er dem „Opferring der NSDAP“ angehöre. Sein Stellvertreter, der Schriftgießer Paul Lippmann gehöre der SPD an, sei aber bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1933 geflohen. Der 2. Stellvertreter, der Arbeiter Friedrich Kretzschmar, sei Mitglied der KPD und befinde sich wegen des angeblichen Diebstahls eines Strohballens in „Schutzhaft“. Über das weitere Schicksal der Beiden ist bisher nichts bekannt. In den Gemeinderat wurden an ihrer Stelle zwei „Personen mit nationaler Gesinnung“, der Bankbeamte und NSDAP-Ortsgruppenleiter Otto Prinz sowie der Buchhändler Paul Böhme gewählt.
Wenige Tage später teilte Bürgermeister Haase an die Amtshauptmannschaft Leipzig mit, dass „... sämtliche hier beschäftigte Beamte und Angestellte sowie der Wegewart ...deutschnationaler bezw. nationalsozialistischer Gesinnung (seien). Es erübrigt sich daher, Dienststrafverfahren auf Dienstentlassung einzuleiten. Ebenso sind sämtliche Lehrer der hiesigen Volksschule ganz national gesinnte Leute.“ Am 29. April 1933 versicherten neben Bürgermeister Haase die bei der Gemeinde Beschäftigten (Kassierer Alfred Klas, Kassenangestellter Walter Eckelt, Kanzleiangestellter Johannes Feidecke, Gemeindewachtmeister Louis Lindner und Wegewart Wilhelm Walter), dass sie jederzeit für den Nationalen Staat eintreten werden und vorher nicht Mitglied einer kommunistischen oder sozialdemokratischen Partei bzw. deren Hilfs- oder Nebenorganisation waren.
Bei der Neubildung der Gemeindeverordneten im April 1933, die ohne separate Wahl, sondern ausschließlich nach dem Ergebnis der Reichstagswahl vom 5. März 1933 erfolgte, erhielt die bis dahin bei Wahlen nicht in Erscheinung getretene NSDAP mit 429 Stimmen das höchste Ergebnis und erreichte sieben Sitze. Der SPD gelang es trotz politischer Repressalien mit 222 gewonnenen Stimmen immerhin noch drei Gemeindevertreter aufzustellen. Auf der Liste der NSDAP findet sich eine Vielzahl von Namen aus der vorherigen „Bürgerlichen Einheitsliste“, unter ihnen Beamte, Angestellte, Lehrer, Gärtner, Landwirte, Landarbeiter und Gutsbesitzer. Die übrigen für die Reichstagswahl zugelassenen Parteien erlangten in Panitzsch nur geringe Stimmenanteile und damit keinen Gemeindeverordnetensitz.
Im Juni 1933 teilte Bürgermeister Haase der Amtshauptmannschaft Leipzig mit, dass „im Zuge der Gleichschaltung die drei SPD-Mitglieder ihre Sitze niedergelegt hatten ...“ Durch die veränderten politischen und rechtlichen Bedingungen „verzichtete“ die SPD auf eine Listennachfolge. Die freien Sitze wurden nicht mehr besetzt, so dass sieben NSDAP-Mit-glieder allein in der Gemeindevertretung verblieben.
Im Rahmen der Vorbereitung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden in Panitzsch die Verwaltungen und Organisationen erfasst, die im weitesten Sinne mit dem Sport verbunden waren.
Bürgermeister Haase übernahm bis 1935 wieder den Vorstandssitz in diesem Gremium. Erster und zweiter Stellvertreter wurden Otto Prinz und der Kaufmann Otto Sicker. Bürgermeister Haase versicherte gegenüber der Amtshauptmannschaft Leipzig am 18. Mai 1933, dass „sämtliche Herren … nationalsozialistischer Gesinnung“ waren. Von Mai 1933 bis Mai 1936 übte der Ortsgruppenleiter der NSDAP, der Bankbeamte Otto Prinz, außerdem das Amt des 1. Stellvertreters des Bürgermeisters aus. Prinz meldete sich 1941 freiwillig zum Dienst in der Wehrmacht und wurde deshalb am 12. Juli 1941 von seinem Amt als Gemeinderat entbunden.
Die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 vereinheitlichte das Kommunalrecht in ganz Deutschland. Zwar blieb de jure die kommunale Selbstverwaltung erhalten, jedoch erfolgte die Festlegung der Befugnisse und Stellung des „Gemeindeleiters“ nicht nur im Sinne des Zentralstaates, sondern im Sinne des Führerprinzips. Die Leiter der Gemeinden wurden als Bürgermeister nicht mehr gewählt, sondern berufen. Die Funktion der bisherigen Stellvertreter wurde beibehalten, aber in „Beigeordnete“ umbenannt. Die beiden Beigeordneten waren künftig wie die Gemeinderäte immer NSDAP-Mitglieder. Zum 1. Beigeordneten wählten die Gemeinderäte im Mai 1936 den Gutsbesitzer Arthur Achilles, der gleichzeitig Ortsbauernführer war.
1938 wurde Haase auf Vorschlag des NSDAP-Kreisbeauftragten durch den Leipziger Amtshauptmann für weitere 12 Jahre als Bürgermeister ernannt. Seine Dienstzeit hätte dann bis zum 1. April 1950 gedauert. Als Haase sich Ende 1941 aus privaten Gründen nach seiner Scheidung als Amtskommissar „zur Aufbauarbeit nach Polen“ meldete, berief der Gemeinderat den Verwaltungsobersekretär Walter Eckelt als ständigen stellvertretenden Bürgermeister, der allerdings im März 1944 ebenfalls zum Kriegsdienst einberufen wurde. Bis Haase Mitte 1944 nach Panitzsch zurückkehrte, nahm ein Beamter aus Taucha die Amtsgeschäfte in Panitzsch wahr. Haase beging am 1. April 1945 zwar noch sein 45-jähriges Dienstjubiläum im Ort, wurde allerdings zum Kriegsende abgesetzt und „verzog nach Westdeutschland“.
Auch in Panitzsch kam es während der NS-Diktatur zur Strafverfolgung und -verurteilung politisch Andersdenkender, zu Verdächtigungen und Denunziationen wie die folgenden Beispiele zeigen. Aus einer Mitteilung des Amtsgerichts Taucha an die Gemeinde Panitzsch vom 27. September 1933 geht hervor, dass der Arbeiter Friedrich Ernst Paschi, geb. 7. Juli 1915 in Panitzsch, wohnhaft in Panitzsch, Sehliser Str. 56, wegen „Zusammenhaltens eines aufgelösten marxistischen Verbandes ...“ am 20. Juli 1933 zu einem Monat Haft verurteilt wurde, die in eine Bewährungsstrafe bis zum 1. August 1935 umgewandelt wurde. Verurteilt wurde ebenso der Arbeiter Willy Wilhelm Friedrich Book (geb. 29. Januar 1906 in Priester), damals wohnhaft in der Langen Straße 33 in Panitzsch. Seine Strafe wurde ebenfalls auf Bewährung ausgesetzt. Über das weitere Schicksal dieser Personen ist bisher nichts bekannt. Die seit 1929 in Panitzsch tätige und engagierte Ärztin Dr. Margarete Blank wurde denunziert und am 28. Februar 1945 in Dresden hingerichtet. Die nationalsozialistische Propaganda führte sogar soweit, dass im Herbst 1944 in Panitzsch eine Tochter ihren eigenen Vater wegen des Abhörens feindlicher Sender im Radio anzeigte.
Während der Zeit der NS-Diktatur etablierten sich in Panitzsch verschiedene NS-Organisationen und -gruppierungen. Diese Gremien waren besonders intensiv in die Vorbereitung und Durchführung des ersten Heimatfestes „1267 – 1937. Panitzsch“ vom 17. bis 19. Juli 1937 eingebunden, das ganz im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung stattfand. Die sechsmonatige Vorbereitung lag in der Hand eines Hauptausschusses (Vorsitzender Bürgermeister Haase) und verschiedener Arbeitsausschüsse wie Wirtschaft/Vierjahresplan, Ortsschmückung, Platzorganisation, parteiliche Veranstaltungen, Werbung bei Handel und Gewerbe und musikalische Ausgestaltung. Unter maßgeblicher Ägide der Funktionäre der nationalsozialistischen Organisationen wie NSDAP, SS, SA, HJ, BDM, Ortsbauernschaft und dem Vorsitzenden des Sportvereins wurde das Festprogramm erstellt sowie die Schmückung des Ortes mit „Illuminationslämpchen“, Dauergirlanden und Hakenkreuzfähnchen bindend festgelegt.
Titelseite des Festprogramms des Heimatfestes 1937.
Zur Verschönerung des Ortsbildes sollten die Panitzscher ihre Zäune reparieren und schadhafte Stellen an Gehwegen ausbessern. Hauptveranstaltungsorte waren die Heimatfestwiese und die Festhalle (Reithalle). Im Rahmen des Festumzuges am dritten Festtag waren 34 gestaltete Bilder aus der Panitzscher Ortsgeschichte zu sehen. Am Abend führte die Panitzscher Laienspielgruppe das Singspiel „Auf Befehl des Königs“ aus der Zeit Friedrichs des Großen auf. Die Sportwettkämpfe waren zum Teil militärisch geprägt wie der 20-km-Gepäckmarsch, den die Tauchaer SA gewann. Obwohl die Große Leipziger Straßenbahn während der Festwoche aus Kostengründen keinen Omnibusanschluss einrichtete, konnte Panitzsch doch tausende Besucher anziehen. Das von Heinz Quirin, einem damaligen Geschichts- und Geografiestudenten an der Universität Leipzig, im Rahmen des Reichsberufswettkampfes 1936/37 gestaltete „Heimatbuch“ mit historischen Abhandlungen wurde ebenso gut verkauft wie die Werbepostkarten, wie der Rechnungsabschluss des Hauptausschusses gegenüber der Gemeinde 1940 belegte. Am 20. Dezember 1938 wurde in der Panitzscher Schule eine NS-Gemeindebücherei mit einem Bestand von 150 Bänden eingerichtet, die an Sonntagvormittagen geöffnet hatte.
Aufnahme aus dem Festzug 1937
Kriegsauswirkungen 1939 bis 1945
Nach dem Kriegsbeginn im September 1939 zeichneten sich in Panitzsch erst allmählich Veränderungen im Alltag ab. Der Bürgermeister wurde mit einer Flut von Anfragen und Festlegungen der NSDAP-Kreisleitung sowie der Kreisverwaltung konfrontiert, zu denen in der Regel kurzfristige Meldungen zu erfolgen hatten. Dazu gehörte selbst die scheinbar lapidare Antwort des Bürgermeisters Haase an den Landrat vom 4. Juni 1940, die „keine Juden in der Gemeinde“ vermeldete. Ob die Benennung von Sprachkundigen als Dolmetscher und Übersetzer im Dezember 1940, von denen einzelne Panitzscher Englisch, Polnisch, Französisch, Spanisch und Neugriechisch beherrschten, tatsächlich zum Einsatz für kriegswichtige Aufgaben führte, ist nicht überliefert. Im November 1941 musste die Bronzeglocke der Volksschule Panitzsch mit einem Gewicht von 35 kg abgenommen und der Metallsammlung zugeführt werden. Sogar eine Arrestzelle für entwichene Kriegsgefangene und Ausländer war im Juli 1942 einzurichten. Polnische Zwangsarbeiter arbeiteten nicht nur auf dem Rittergut Cunnersdorf oder beim Gutsbesitzer Achilles in Panitzsch, sondern bei mehreren anderen Bauern und Gärtnern im Ort. Im Panitzscher Betriebsteil der Mechanischen Weberei Altstadt GmbH, Filiale Panitzsch, waren Griechen beschäftigt, in der Obstverwertung Engelhardt zeitweise englische Kriegsgefangene.
Für die Errichtung von mehreren Behelfsheimen und von 30 „Volkswohnungen“ hatte die Gemeinde schon 1940 ca. 10.000 Quadratmeter Fläche am ehemaligen Sportplatz erworben.
Standardisierte Zeichnung für den Bau eines Behelfsheims.
Das Panitzscher Gemeindegebiet mit dem Gelände der Trabrennbahn und den umliegenden Feldern wurde in den 1930er Jahren von verschiedenen Flak-Einheiten und Truppenteilen der Wehrmacht zu Übungen genutzt. In diesen Zeiten mussten die Ackergeräte sowie das Vieh entfernt werden. Nicht selten kam es durch die Truppenübungen zu Vieh- und Flurschäden. Im Januar und September 1940 verursachte die Flakgruppe Leipzig N 24 in der Trabrennbahngaststätte Schäden durch die Belegung mit einer Flak-Abteilung in der Gemeinde Panitzsch sowie durch Aufschüttungen und Ausschachtungen einschließlich Bunkerbau, Bau von Geschützstellungen und zwei bis drei Meter tiefen Unterständen und Gräben. Die Grundstückseigentümer bzw. Pächter der Trabrennbahn und des Gartenbaubetriebes Sommerfelder Str. 83 b stellten erhebliche Schadenersatzansprüche. Noch 1944 fanden Übungsschießen der Flakartillerie um Taucha und Panitzsch ohne die sonst übliche Absperrung des Schussgebietes statt. Der Leipziger Polizeipräsident und der Landrat in Leipzig forderten lediglich, dass die „Bevölkerung … sich selbst bewusst verhalten“ sollte. Die Besatzungen der in Panitzsch in der Nähe der Rennbahn und am Ortseingang in der Borsdorfer Straße stationierten Flakscheinwerferstellungen wurden Anfang April 1945 nach Leipzig abgezogen.
Strenge Regeln galten für die Verdunklungsmaßnahmen während der Zeit der zahlreichen Fliegeralarme. Allerdings hatten die Gemeinde bzw. der Ortspolizist immer wieder Verstöße zu ahnden. Auf die Anzeigen des Luftschutzwarts Paul Fritzsche wegen fehlender oder ungenügender Verdunklung folgten meist Geldstrafen. Bei dem schweren Luftangriff der britischen Luftwaffe gegen Leipzig am 20. Oktober 1943 wurde neben Borsdorf ebenso Panitzsch um 20.35 Uhr schwer getroffen. Die Verbände überquerten aus östlicher Richtung kommend Panitzsch, Engelsdorf und Sommerfeld Richtung Leipzig. Bomben fielen vor allem auf das Gelände der Obstverwertung Engelhard, wo ein Gebäudetotalschaden entstand. An verschiedenen Stellen im Ort traten Brände in Stallungen und Scheunen in insgesamt elf weiteren Grundstücken, darunter an der Windmühle, auf.
Mehrere Gebäude in der damaligen Adolf-Hitler-Straße (Neue Straße) wiesen leichte Schäden an Fenstern und Türen auf, andere erlitten schwere Schäden v. a. an den Dächern, so dass innerhalb des Ortes Umquartierungen erforderlich waren. In Panitzsch fanden zur gleichen Zeit Ausgebombte, vor allem aus Leipzig und Berlin, zeitweise ein neues Dach über dem Kopf. Bei den weiteren Luftangriffen auf Leipzig verzeichneten die Einwohner in Panitzsch trotz der zahlreichen Überflüge meist nur geringe Schäden. Im Jahr 1944 wurde nur das Verwaltungsgebäude der Trabrennbahn schwer getroffen. Waren Brandstellen bekämpft, leistete die Freiwillige Feuerwehr Löschhilfe im Umland und unterstützte vor allem die Leipziger Ostwache.
Siegel/Wappen der Gemeinde Panitzsch, vor 1945.
Mit einem Appell am 12. November 1944 in Panitzsch fand die Verpflichtung der Volkssturmmänner aus Althen, Hirschfeld und Panitzsch auf den Adolf Hitler statt. Im Februar 1945 wurden Volkssturmmänner teilweise in die Feuerwehrbereitschaften sowie die Werkfeuerwehren eingegliedert. Im Zweiten Weltkrieg ließen 72 von 287 zum Kriegsdienst Verpflichtete Panitzscher an verschiedenen Frontabschnitten ihr Leben für das im Frühjahr 1945 untergehende „Tausendjährige Reich“. Ebenso wie die Gemeinden im Umland wurde Panitzsch Mitte April 1945 von amerikanischen Truppen besetzt. Zunächst leitete Paul Graupner kommissarisch ab 1. Mai 1945 die Gemeindeverwaltung, bis Franz Rudolph (KPD) als erster Bürgermeister nach dem Krieg eingesetzt wurde. Rudolph, der am 10. August 1900 in Panitzsch geboren wurde, saß aufgrund seiner Tätigkeit als politischer Leiter der KPD während der NS-Zeit 53 Wochen in Leipzig und Sachsenburg/Sa. in Haft.
Lebenslauf von Franz Rudolph, 03.11.1945.
Die Gemeinde Panitzsch unterstand der Amtshauptmannschaft Leipzig. 1939 wurde die Amtshauptmannschaft Leipzig in Landkreis Leipzig umbenannt. Der Landkreis Leipzig bestand bis zur Verwaltungsreform im Juli 1952 in der DDR fort und ging dann in den Kreis Leipzig-Land im Bezirk Leipzig über.
Nachkriegszeit und Alltag in der DDR
Die schwierige Versorgungslage nach dem Kriegsende brachte viele Reglementierungen mit sich. Der Leipziger Landrat forderte im Auftrag der amerikanischen bzw. ab Anfang Juli 1945 der sowjetischen Besatzungsmacht die Bürgermeister ständig zur Berichterstattung auf. Abgefragt wurden NSDAP-Mitgliedschaften, der Stand der Entnazifizierungsverfahren, der Aufenthalt von ausländischen Arbeitskräften sowie von ehemaligen SS- und Wehrmachtsangehörigen oder der Durchzug von Flüchtlingen und Vertriebenen. Anders als für Borsdorf, wo eine Reihe von Augenzeugenberichten und Niederschriften für diesen Zeitraum vorliegen, ließen sich für Panitzsch nur fragmentarische Daten ermitteln. Am 25. April 1945 wies die amerikanische Militärregierung die Bürgermeister des Landkreises an, sämtliche Waffen und Munition abzuliefern und zu ermitteln, ob sich deutsche Soldaten in Zivil oder Uniform im Gebiet aufhielten. Den Orten, die sich den Anweisungen der Besatzungsmacht widersetzen sollten, wurde „Gewalt durch Artilleriefeuer“ angedroht. Ende April und Anfang Mai 1945 lieferten die Panitzscher mehrere Waffen, darunter Revolver und Jagdgewehre mit einer erheblichen Menge Munition ab.
Die Frage der allgemeinen Sicherheit spielte in den ersten Nachkriegswochen eine nicht unerhebliche Rolle. Oft war eine geregelte Bewirtschaftung der Felder und Höfe in den damals in Panitzsch erfassten 28 Bauernwirtschaften kaum möglich oder rentabel. Häufig kam es zu Felddiebstählen, Plünderungen oder Überfällen. Nicht nur die hungernden Leipziger, sondern auch ehemalige Zwangsarbeiter aus den Lagern in Leipzig und Umgebung überfielen Bauerngehöfte und deren Insassen. Nicht selten kam es dabei zu Verletzten oder zu Todesfällen wie auf dem Universitätsgut Cunnersdorf, wo im April 1945 der Verwalter bei einem nächtlichen Überfall durch polnische Fremdarbeiter ums Leben kam. Noch im Frühjahr 1947 verpflichtete ein von den Gemeindeverordneten erlassenes Ortsgesetz alle im Ort ansässigen arbeitsfähigen Männer zwischen 18 und 60 Jahren zu „Nachtwachen zum Schutz der Ernte und des Eigentums gegen Diebstahl“.
Aus heutiger Sicht lässt sich kaum mehr nachvollziehen, wie die alltägliche Versorgung mit Nahrungsmitteln oder Heizmaterialien sichergestellt werden konnte. Genauso schwierig war die Zuweisung und Lieferung von Fensterglas, Dachpappe, Zement oder Baukalk. Die Baumaterialien wurden zur Reparatur oder zum Wiederaufbau der luftkriegsgeschädigten Einfamilienhäuser, insbesondere in der Neuen Straße, sowie zur Errichtung von Notwohnungen oder Behelfsheimen dringend benötigt. Selbst wenn man einen Bezugsschein durch den Landrat des Kreises Leipzig erhielt, war nicht immer sofort ein Kauf der begehrten Materialien möglich.
Die Sozialkommission der Gemeindeverordneten entschied bis in die 1950er Jahre über die Vergabe von Unterstützungen in schweren Erkrankungsfällen, zahlte Schulentlassungsbeihilfen, verteilte Braunkohlenkontingente sowie Lebensmittelzusatzkarten und vermittelte bedürftige Kinder in Erholungseinrichtungen. Die Mitglieder der Volkssolidarität und engagierte Einwohner sammelten Spenden und Lebensmittel, um beispielsweise Kinderfeste mit Brötchen und Würstchen oder bedürftige Rentner in der Weihnachtszeit mit Stollen zu versorgen. Im Ort ansässige Firmen wie die Obstverwertung Panitzsch spendeten Obstweine oder Saft.
Vereinzelt finden sich in den Akten der Gemeindeverwaltung Zahlen zur Bodenreform sowie zur Landverteilung und Ansiedlung von Neubauern. Im Rahmen der Bodenreform wurden in Panitzsch insgesamt rund 118 Hektar Land enteignet, darunter Flächen der Familie Achilles (Lange Straße mit dem Gebäudekomplex des „Blauen Engels“) sowie des Jacobschen Besitzes (Sommerfelder Straße mit dem Gutshaus einschließlich des zum Gut gehörigen Parks). Davon wurden knapp 90 Hektar an 46 besitzlose oder landarme Bauern zugeteilt, unter ihnen 14 Neubauern. 23 Hektar dienten dem Landaustausch mit den Städten Leipzig und Taucha, fast fünf Hektar Fläche fiel an verschiedene Organisationen, darunter die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB). Die Gemeinde erhielt eine Fläche von rund drei Hektar mit dem Herrenhaus, fünf Wohnhäusern, zehn Ställen und acht Scheunen in eigene Verwaltung. Ein Teil dieser Gebäude wie das Gutshaus sollte auf Anweisung der Kreisverwaltung abgebrochen und das Baumaterial für die Errichtung von Neubauerngehöften verwendet werden. Das Gutshaus blieb jedoch aufgrund von Einsprüchen der Gemeinde erhalten und wurde schon 1948 zur Schule umgebaut. In freiwilligen Arbeitseinsätzen leisten die Panitzscher bis 1949 beim Schulbau über 4.000 Arbeitsstunden. Sie beräumten Schutt, bargen Steine, klopften diese ab und führten Planierungsarbeiten aus. Im Januar 1949 befürworteten die Gemeindeverordneten den Antrag, die neue Grundschule nach Margarete Blank zu benennen.
Im Januar 1946 wurden für Panitzsch 146 „Ansiedler“ gemeldet, deren Aufnahme in die Gemeinde zum Teil von einer Reihe von Hilfsmaßnahmen, wie dem Bereitstellen von Bettstellen oder der Zahlung von einmaligen Unterstützungen begleitet wurde. Die Zahl der Umsiedler wuchs bis zum Mai 1947 auf 348 Personen an, darunter 83 Männer, 154 Frauen sowie 111 Kinder. Im Oktober 1946 wies das Umsiedlerlager Taucha der Gemeinde erneut vier Männer, 14 Frauen und zwölf Kinder als Umsiedler zur Einbürgerung in Panitzsch zu. Die Eingliederung verlief allerdings nicht immer reibungslos, zumal für die Einrichtung der 14 Neubauernstellen in den geforderten Landgrößen mit Alteigentümern Grundstücksflächen getauscht werden mussten. Neubauernstellen befanden sich unter anderem an der Tauchaer sowie an der Plösitzer Straße (hinter der Bäckerei Hoffmann). Die Neubauern erhielten Steuervergünstigungen, staatliche Unterstützungen beim Viehankauf, Zuweisungen von Altmaterialien sowie die Gewährung günstiger Kredite im Rahmen des Bodenreform-Bauprogramms, alteingesessene Familien hingegen nicht. Größere Maschinen und Traktoren wurden im Zuge der Bodenreform zwar ebenfalls enteignet, aber nicht aufgeteilt, sondern in Maschinenausleihstationen (MAS) bzw. Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS) zum Verleih an die Bauern verwaltet. Das Eigentum ging später erst leihweise, dann durch Ankauf in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) über.
Im Mai 1947 übermittelte Bürgermeister Rudolph an den Landrat in Leipzig folgende Angaben: Einwohner insgesamt 1.652, davon 539 Männer, 725 Frauen sowie 388 Kinder (davon 186 Jungen, 202 Mädchen). Zu dieser Zeit befanden sich noch 125 Panitzscher in Kriegsgefangenschaft, davon 43 in englischer, 62 in amerikanischer, einer in französischer sowie 19 in „russischer“ (sowjetischer) Gefangenschaft. 70 Panitzscher hatten im Zweiten Weltkrieg bei der Infanterie (53), der Luftwaffe (12) und der Marine (5) gedient.
Bis zum 1. Oktober 1947 wuchs die Panitzscher Einwohnerzahl auf 1.660 Personen (ein Zuwachs von über 22 Prozent im Vergleich zu 1941 mit 1.359 Einwohnern). Die Gemeindefläche umfasste 924 Hektar. Pro Quadratmeter lebten durchschnittlich 180 Einwohner des Ortes.
1947 existierte in Panitzsch eine eigene Polizeistation, die sich in der Hauptstraße 62 c befand. Ab 1. April 1949 wurde das Meldeamt durch die Volkspolizei übernommen. Angestellte des Volkspolizeipräsidiums Leipzig hielten in Panitzsch einmal wöchentlich Sprechzeiten ab.
Am 1. Juli 1949 eröffnete in Panitzsch ein Land-Ambulatorium, in dem eine Gemeindeschwester sowie eine Hilfsschwester die Patienten versorgten. Die medizinische Betreuung oblag nach vertraglicher Regelung mit der Gemeindeverwaltung dem Betriebsarzt des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) Engelsdorf, Herrn Dr. Lehmann.
Im Amtlichen Straßenverzeichnis für die Stadt Leipzig und Umgebung wurden für 1947 folgende 14 amtliche Straßennamen in Panitzsch aufgeführt: Althener Straße, Borsdorfer Straße, Ernst-Thälmann-Straße (früher und heute wieder Neue Straße), Gerichshainer Straße, Hauptstraße, Kirchgasse, Krickauer Straße (heute Kriekauer Straße), Langestraße (heute Lange Straße), Margarete-Blank-Platz, Margarete-Blank-Straße, Plösitzer Straße, Sehliser Straße, Sommerfelder Straße und Teichstraße. Als Anfahrtsmöglichkeit nach Panitzsch wurde zu dieser Zeit die Nutzung der Straßenbahnlinie 4 in Leipzig bis Engelsdorf und der sich anschließende Fußweg, meist über die Dreiecksiedlung, ausgewiesen.
Blick in Richtung der Dreiecksiedlung.
Bereits kurz nach dem Kriegsende bildete sich die Ortsgruppe der KPD neu und Anfang 1946 folgte die politische Aktivierung der Ortsgruppe der SPD. Im April 1946 entstand in der sowjetischen Besatzungszone aus beiden Arbeiterparteien die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), so dass sich in Panitzsch ebenfalls eine SED-Ortsgruppe organisierte. Aktiv war auch eine Ortsgruppe des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB). Neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem Sportverein (ab 1950 Betriebssportgemeinschaft „Traktor Panitzsch“) agierten zu DDR-Zeiten in Panitzsch verschiedene andere gesellschaftliche Organisationen und Parteien. Die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) nutzte die gesamte Trabrennbahn mit der alten Schießanlage als Ausbildungsgelände, das zwischen 1987 und 1990 zu einem Bezirksausbildungszentrum ausgebaut wurde. Später waren vor allem die SED- und FDGB-Betriebsorganisationen für die politische Arbeit im Interesse des SED-Staates maßgebend.
Am 1. September 1946 fanden die ersten Wahlen für einen neuen Gemeinderat nach dem Kriegsende statt. Auf dem Stimmzettel konnten die 964 stimmberechtigten Panitzscher über Kandidaten der SED, der Christlichdemokratischen Union (CDU) und des Kommunalen Frauenausschusses abstimmen. Gewählt wurden jeweils acht Gemeindevertreter aus den Reihen der SED sowie der CDU. Formell arbeiteten die Gemeindeverordneten, der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung selbstständig, unterstanden jedoch der Rechtsaufsicht des zuständigen Landrates. Bürgermeister Rudolph war nicht berufsmäßig angestellt und erhielt eine monatliche Vergütung, die sich nach der Einwohnerzahl des Ortes errechnete. Als Franz Rudolph im Jahr 1949 erkrankte, übernahm der 1947 gewählte 1. Stellvertreter Otto Hanke (CDU) die Amtsgeschäfte. Im Januar 1951 wählten die Gemeindeverordneten mit dem Arbeiter Rolf Beyer (Demokratische Bauernpartei Deutschlands) wieder einen besoldeten Bürgermeister.
Mit Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 7. Oktober 1949, der Auflösung der Länder 1952 sowie der immer stärkeren Etablierung der SED-Diktatur wurden die Möglichkeiten für eine kommunale Selbstverwaltung weiter beschnitten, bis sie schließlich mit dem Gesetz über die örtlichen Organe der Staatsmacht vom 18. Januar 1957 gänzlich abgeschafft wurden. Wenn die gewählten „Volksvertreter“ der Gemeinde (Gemeindeverordnete) weiter wichtige Fragen der örtlichen Entwicklung berieten, anregten und beschlossen, waren sie von der Genehmigung durch die Planungsstellen des Rates des Kreises Leipzig sowie den Entscheidungen der SED-Führung abhängig. Entscheidungen waren ohne Zustimmung der SED-Ortsgruppe, den Parteifunktionären in den Betrieben und Produktionsgenossenschaften sowie der SED-Kreisleitung nicht möglich.
Wie in anderen Orten fanden in Panitzsch Veranstaltungen zu den gesellschaftlichen Feiertagen wie dem 1. Mai oder dem Tag der Republik statt. Überliefert sind für den Maifeiertag die Fahrten mit mehreren Pferdegespannen und motorisierten Fahrzeugen zur Kundgebung nach Taucha sowie der abendliche Maitanz im Gasthof. Auch die jährlichen Jugendweihefeiern und die späteren sozialistischen Namensweihen wurden im Ort meist in der Schule sowie im Kulturhaus der Gemeinde (Gasthof) begangen. Abwechslung im Alltag gab es durch zahlreiche Kultur- und Kinoveranstaltungen, Dorffeste sowie die Betätigung im Sportverein. Später war im Ort ein Dorfclub aktiv, der die kulturellen Aktivitäten koordinierte und unterstützte. In der Schule im Gutshaus stand den Einwohnern die in einem Raum untergebrachte Gemeindebücherei zur Verfügung.
Auftritt des Klampfenorchesters.
Schon in den 1950er Jahren entstanden in Panitzsch verschiedene soziale Einrichtungen, die besonders die Berufstätigkeit der Frauen erleichtern sollten. Am 31. Mai 1953 eröffnete die Gemeinde in der Borsdorfer Straße in einer umgebauten Tischlerwerkstatt einen Kindergarten, in dem zwei Kindergärtnerinnen und eine zusätzliche Beschäftigte bis zu 30 Kinder betreuten. Seit 1957 konnten in der Kinderkrippe der Gemeinde 20 Kleinkinder in den Räumen des ehemaligen „Cafés zur Mühle“ betreut werden. Die Konsumverkaufsstelle befand sich zunächst in der Hauptstraße in verschiedenen Gebäuden, ehe schließlich 1974 der Neubau an der Parthe in der Borsdorfer Straße (heute Sitz der Firma Abt Pumpentechnik) öffnete.
Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung im Ort hatten die beiden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). Am 15. November 1952 wurde durch wenige Einzel- und Neubauern zunächst eine LPG Typ I gebildet. Diese bildete sich nach dem Beitritt fast aller Einzelbauern 1957 in eine LPG Typ III um und erhielt den Namen „Dr. Margarete Blank“. Damit war die Gemeinde außer den Obstbauern vollgenossenschaftlich organisiert. Mitte der 1960er Jahre zählte die LPG über 80 Mitglieder und bewirtschaftete rund 530 Hektar Fläche. Der Viehbestand der LPG wies neben Pferden insbesondere Kühe, Rinder und Schweine sowie Hühner auf. Mit zunehmender Technisierung verringerte sich der Pferdebestand im Laufe der Jahre. Neben der Arbeit in der LPG betrieben die Mitglieder zum Teil umfangreiche Hauswirtschaften und hielten privat Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen oder Pferde.
Hier befand sich die 1974 neu errichte Konsumverkaufsstelle.
1958 schlossen sich sieben Obstbaubetriebe mit einer Fläche von 36 Hektar als LPG Typ I „Prof. Dr. Friedrich“ zusammen und betrieben vorrangig Obstbau, produzierten aber daneben Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüse. Abgeliefert wurden außerdem Milch und Eier. 1974 zählte diese LPG jedoch nur noch drei Mitglieder, die 17,4 Hektar Land bewirtschafteten. Drei andere Obstbauern arbeiteten zu dieser Zeit auf einer Fläche von 33 Hektar wieder als private Obstbaubetriebe.
Dass es den Vertretern der örtlichen Staatsmacht nicht immer gelang, alle Panitzscher Bewohner an den Ort zu binden, zeigte sich 1956. In diesem Jahr genehmigte der Rat des Kreises Leipzig den Bewohnern der Borsdorfer Straße 22 bis 34 die Ausgliederung aus dem Gemeindeverband Panitzsch und den Wechsel in die Gemeinde Borsdorf. Durch die unmittelbaren Randlage der Grundstücke an der Gemeindegrenze zu Borsdorf und der Entfernung von einer halben Stunde Fußweg, entlang am freien Feld, vom eigentlichen Panitzscher Ortskern fühlten sich die Bewohner stärker an Borsdorf gebunden und wollten ihren Kindern darüber hinaus den langen Fußweg nach Panitzsch ersparen. Diesen Argumenten hatten die Panitzscher Gemeindevertreter nichts entgegenzusetzen und der Landkreis stimmte der Neuordnung zu.
Später führte das ungenügende Wohnungsangebot in Panitzsch dazu, dass es immer schwieriger wurde, Fachkräfte im Ort dauerhaft anzusiedeln. Im Gegenteil, die LPG verlor oftmals gute Arbeitskräfte, weil andere Gemeinden oder Betriebe besseren oder überhaupt einen Wohnraum anboten oder in den 1980er Jahren den Eigenheimbau mit Hilfe der dortigen LPG stärker unterstützten. Darüber hinaus bestanden vor allem in der LPG „Dr. Margarete Blank“ vermutlich nicht nur ideologische Probleme, wie es in Berichten der SED-Kreisleitung Leipzig-Land in den 1970er Jahren heißt. Viel schwerer wogen die wirtschaftlichen Misserfolge in der Tierzucht, vor allem bei Rindern, aber ebenso im Pflanzenbau.
Daneben galt es, Versorgungsengpässen bei Dienstleistungen und Konsumgütern zu begegnen und die jährlichen „Ernteschlachten“ zu schlagen. Trotzdem gab es im Ort viele gemeinschaftliche Initiativen zur Verbesserung der aus heutiger Sicht oft bescheiden anmutenden Lebensverhältnisse. Davon zeugen die zahlreichen Einsätze im Rahmen des „Nationalen Aufbauwerks“ (NAW) sowie den späteren „Subbotniks“ mit unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden wie beim Bau des Sportplatzes, des Sportlerheims und der Parkbühne Anfang der 1960er Jahre. Im Ort wurden entlang der Parthe Bäume gepflanzt, Grünflächen gestaltet und Parkbänke aufgestellt wie am Kirchberg. 1966 begannen die Renovierungsarbeiten an den bis dahin nicht mehr genutzten Gebäuden der Trabrennbahn.
Festplakette zur 700-Jahrfeier 1967.
Die Vorbereitung des Festprogramms „700 Jahre Panitzsch 1267 – 1967“ vereinte die Panitzscher Einwohner bei vielfältigen Aktivitäten. Das Festkomitee leitete das Ratsmitglied Karl Herbst, der gemeinsam mit einem Autorenteam die vom Rat der Gemeinde publizierte Chronik verfasste. Die Festwoche vom 26. Mai bis zum 3. Juni 1967 bot den Panitzschern und ihren Gästen bei der Festsitzung des Gemeinderates am 4. Juni 1967, dem Festumzug, bei verschiedenen kulturellen Darbietungen auf der Parkbühne, einem Volks- und Heimatliederabend, einem Volkssportfest sowie dem DDR-offenen Springreitturnier auf dem Gelände der Trabrennbahn ein vielfältiges Programm. Höhepunkte waren sicher der Auftritt des Schlagersängers Frank Schöbel sowie der Sommernachtsball als Festabschluss. Am Tag des Festumzuges, dem 27. Mai, konnten die Gäste Panitzsch mit Sonderbussen ab Leipzig-Paunsdorf und Leipzig-Thekla erreichen.
Bis zum Ende der DDR 1990 blieb Panitzsch ein Dorf mit ca. 1.000 Einwohnern, bestehend aus einem Dorfkern mit vielen charakteristischen Hofanlagen, neuerer Wohnbebauung Richtung Borsdorf an der Kreisstraße 22, dem Ortsteil Cunnersdorf, der Dreiecksiedlung sowie der Parksiedlung an der Kriekauer Straße, die vorwiegend von Erholungssuchenden an den Wochenenden genutzt wurde.
Gesellschaftliche Veränderungen nach 1989/1990
Die am 17. Mai 1990 in Kraft getretene neue Kommunalverfassung ermöglichte die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung in den Städten und Gemeinden auf dem Gebiet der DDR. Auf der Grundlage des „Gesetzes über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise“ von 1990 fanden am 6. Mai 1990 die ersten freien Kommunalwahlen in der DDR statt. In Panitzsch erhielten 15 Gemeindevertreter, unter ihnen Mitglieder der SPD und der CDU, das Vertrauen der Wahlberechtigten. Ende Mai 1990 trat der neue Bürgermeister Lothar Perschmann sein Amt an und übernahm die Leitung der Panitzscher Gemeindeverwaltung. Diese befand sich seit 1978 in dem von der Gemeinde errichteten Mehrzweckgebäude Am Rain 5 (heute Kindergarten) und bestand nur aus fünf hauptamtlich Beschäftigten: dem Bürgermeister, einem Stellvertreter und drei weiteren Mitarbeitern.
Auf der ersten Einwohnerversammlung am 13. September 1990 im Saal des Gasthofes standen die künftigen Bauvorhaben in Panitzsch, zu denen der Ausbau der Trabrennbahn zum Freizeitcenter sowie die Sicherung des Schulstandortes gehörten, im Mittelpunkt der Diskussionen. Die nach einer kurzen Bauplanung und Bauzeit am 20. August 1993 eingeweihte Grundschule „Dr. Margarete Blank“ bietet mit ihrer hellen und freundlich gestalteten Einrichtung, besonders dem überdachten Mittelbau (der Aula/des Atriums) vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Ausstellungen, Schulkonzerte und -feiern und wird oft für größere Veranstaltungen der Gemeinde wie Einwohnerversammlungen oder als Wahllokal genutzt.
Plan der Gemeinde Panitzsch, Stand Mai 1992.
In den folgenden Jahren beschäftigte sich der Gemeinderat in seinen meist öffentlichen Sitzungen, die in der Regel einmal im Monat stattfanden, mit folgende Themen: Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohnraum, Erstellung von Bebauungsplänen, Untersuchungen zur Erhaltung und Gestaltung des Dorfkerns, Haushalts- und Finanzierungsfragen, Gebührenerhebung wie beispielsweise für die Betreuung in den Kindereinrichtungen, Grundstücksverkäufe für Eigenheime und Wohnbebauung, Ansiedlung von Gewerbe, Straßenbau mit einer Grunderneuerung der bis dahin meist noch einfach ausgebauten Straßen im Ort. Darüber hinaus wurden in den 1990er Jahren im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) Arbeiten am Friedhof bzw. dem Pfarrgelände (Wiedererrichtung der Mauern) ausgeführt. Über den Zweckverband Parthenaue erfolgte die Renaturierung der Parthe. Vor allem im Rahmen privater Initiativen nutzen mehr als 40 Panitzscher Fördergelder für Außensanierungen sowie grundlegende Innensanierungen an ihren Gebäuden. Langsam verbesserte sich das Erscheinungsbild der Gemeinde. Bereits im November 1992 belegte Panitzsch im Wettbewerb des Kreises „Unser Dorf soll schöner werden“ den 2. Preis und wurde durch den Rat des Kreises Leipzig mit 500 DM prämiert.
Sanierte Mauer des Kirchhofs.
Ein Höhepunkt für die Panitzscher und ihre Gäste war die 725-Jahrfeier, die zu Pfingsten 1992 vom 5. bis 8. Juni mit verschiedenen Veranstaltungen auf der Trabrennbahn begangen wurde. Gezeigt wurde die Ausstellung „725 Jahre Panitzsch“. Zum Festprogramm gehörte außerdem die feierliche Wiedereröffnung der renovierten Kirche.
Bei den Wahlen zum Gemeinderat 1994 erhielt Lothar Perschmann erneut das Vertrauen der Gemeinderäte und wurde als Bürgermeister des nunmehr 1.250 Einwohner zählenden Ortes wiedergewählt. Zur Lösung einzelner Verwaltungsaufgaben bildete der Gemeinderat einen Verwaltungs- sowie einen Technischen Ausschuss. In diesem Zeitraum entstand die Neubebauung an der Gerichshainer Straße mit Ein- und Mehrfamilienhäusern für ca. 1.000 Bewohner. Den hier als Straßennamen vergebenen Vogelnamen verdankt die Siedlung im Volksmund die Bezeichnung als „Vogelsiedlung“.
Blick in Richtung der Dreiecksiedlung.
Dank der im April 1993 erfolgten Anerkennung als „Programmdorf“ durch das Sächsische Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten bzw. das Staatliche Amt für ländliche Neuordnung (mit Sitz in Markkleeberg) sowie die Zuweisung von Fördermitteln im Zeitraum bis 1998 konnten weitere kommunale und private Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgeführt werden. Im Mittelpunkt der 3,78 Millionen DM umfassenden Planungsvorhaben standen die Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes des Ortes, die Herausbildung eines Dorfmittelpunktes mit privaten und öffentlichen Einrichtungen sowie Dienstleistungsangeboten, eine maßvolle bauliche Verdichtung durch Neubau und Umnutzung von Bausubstanz im Dorfkern und in den Randbereichen sowie der grundlegende Ausbau bzw. die Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse. Nicht zuletzt sollten historisch wertvolle Bauten erhalten werden, was allerdings wie beim Gebäudekomplex des ehemaligen „Blauen Engels“ nicht immer gelang. Die Planung für die Neubebauung dieses Geländes sah sogar bis zu 18 verschiedene Geschäfte vor. Anfang 1997 wurde die Wohnanlage „Blauer Engel“ fertiggestellt.
Wohnungen und Geschäfte prägen die neue Anlage auf dem Gelände des ehemaligen „Blauen Engels“. Re.: Das erhaltenes Hauszeichen vom „Blauen Engel“.
Viele Panitzscher Bürger erhielten damit die Möglichkeit zum Bezug einer modernen komfortablen Wohnung. Inzwischen war das Telefonnetz ausgebaut worden und jeder Hauseigentümer hatte die Möglichkeit, sich an das Erdgasnetz im Ort anzuschließen. Mit der Fertigstellung des neuen Gebäudes auf dem Gelände des alten Gutshofes gegenüber der neuen Grundschule 1993 entstanden neben der neuen Konsum-Verkaufsstelle mehrere 2- und 3-Raumwohnungen, deren Erbauung durch den Freistaat Sachsen gefördert wurde. 1998 beteiligte sich die Gemeinde Panitzsch am Kreiswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft“. Im Juli 1998 stellte die Bewertungskommission anerkennend fest: „Panitzsch hat sich in den letzten Jahren zum attraktiven großstadtnahen Wohnstandort entwickelt. Die enorme bauliche Entwicklung hatte einen starken Anstieg der Bevölkerung von 1.040 Einwohner 1990 auf derzeit ca. 3000 Einwohner zur Folge. Allerdings ist der dörflich-bäuerliche Charakter dabei weitestgehend verloren gegangen ...“ Hervorgehoben wurde die frühzeitige Aufstellung der Bebauungspläne, der Gestaltungssatzung, des Dorfentwicklungsprogramms und der Baumschutzsatzung. 96 Prozent der Grundstücke konnte an das neue Abwassertrennsystem im Ort angeschlossen werden. Weiter heißt es in der Begutachtung „Neben klein- und mittelständischen Unternehmen gibt es in Panitzsch eine breite Palette von Handwerksbetrieben, vor allem auf den Gewerbeflächen an der Borsdorfer Straße. Mit Kindergarten, Schule/Hort, verschiedenen Arztpraxen, Läden des täglichen Bedarfs, Friseur, Apotheke und Gaststätte gibt es ein verhältnismäßig breites Spektrum an sozialen und kulturellen Einrichtungen. Im Ort arbeiten 11 Vereine unter Mitwirkung der Dorfgemeinschaft. Jugendclub, Kunstgalerie, Bibliothek, Museum und ein mitgliederstarker Sportverein tragen dazu bei, dass die Integration der zahlreich zugezogenen „Neubürger“ unproblematisch erfolgte. Die neu entstandenen Wohngebiete am Ortsrand und der Dorfkern mit traditionellen Hofanlagen prägen das Ortsbild. Hier wurde auf entsprechende Begrünung geachtet, der Dorfteich wurde saniert und mit Schilfgürtel und Seerosen natürlich angelegt. Die Kirche einschließlich des Pfarrhofs wurden saniert. und stellen eine Dominante im Ort dar. Baumpflanzung an Wegen und Straßen, die Bepflanzung innerörtlicher Grünflächen, öffentlicher Plätze und privater Grundstücksflächen wurden umgesetzt.
Kritisch bewertet wurde allerdings, dass nicht immer die Bebauungsvorgaben eingehalten wurden: „Es sind allerdings Tendenzen der Abwendung von dorftypischen Strukturen, wie staudenreicher Vorgärten oder dorfuntypischer Laubgehölze zu verzeichnen.“
Panitzsch verliert seine kommunale Selbstständigkeit
Trotz der Einsicht in die Notwendigkeit der Lösung von Verwaltungsaufgaben im Verbund mit Nachbarorten, wie z. B. Althen, Engelsdorf oder Taucha, fasste der Gemeinderat im Februar 1994 zunächst den Entschluss zum Erhalt der Eigenständigkeit des Ortes und kam damit den Wünschen der Panitzscher nach. Schon 1994 wurden erneut Diskussionen zur bevorstehenden Gemeindegebietsreform in Sachsen geführt. Dabei ging es immer wieder um die Frage, zu welchem Kreis Panitzsch künftig gehören würde, zum Landkreis Leipzig oder zum Muldentalkreis. Favorisiert wurde seit 1995 zunächst eine freiwillige Zusammenarbeit mit Borsdorf in einer Verwaltungsgemeinschaft, wobei Borsdorf als „erfüllende Gemeinde“ tätig werden sollte. Mit Wirkung vom 1. April 1996 genehmigte das Innenministerium des Freistaates Sachsen die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft Borsdorf/ Panitzsch, allerdings mit dem Zusatz, dass dies „nur (als) ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Bildung einer Einheitsgemeinde“ zu sehen sei. Ab April 1996 wurde ein Teil der Borsdorfer und Panitzscher Verwaltungsaufgaben für nunmehr insgesamt fast 6.800 Einwohner gemeinsam geleistet. Dazu gehörte unter anderem die Zuständigkeit des Meldeamtes Borsdorf für die Panitzscher Bürger sowie die Bearbeitung von Aufgaben des Sozialamtes und des Gewerbeamtes im Rathaus Borsdorf. Der aus Vertretern beider Gemeinden gebildete Verwaltungsausschuss, dem beide Bürgermeister angehörten, prüfte in der Folgezeit die jeweiligen Gemeindesatzungen und bereitete den späteren Zusammenschluss vor.
Luftbild der Gemeinde Panitzsch, Ende der 1990er Jahre, rechts das neu erschlossene Wohngebiet Am Wiesenweg.
Auch wenn die Panitzscher Einwohner gern ihre Eigenständigkeit bewahrt hätten, führte an der Eingemeindung kein Weg mehr vorbei. Am 15. Dezember 1998 tagte der Gemeinderat Panitzsch zum letzten Mal als eigenständiges Gremium. Zum 1. Januar 1999 entstand die neue Gemeinde Borsdorf mit den Ortsteilen Borsdorf, Cunnersdorf, Panitzsch und Zweenfurth (nach Borsdorf eingemeindet per 1. Juni 1973). Durch die Eingemeindung nach Borsdorf wechselte Panitzsch gleichzeitig aus dem Landkreis Leipziger Land in den 1994 gebildeten Landkreis Muldental.
Zehn Panitzscher Gemeinderäte arbeiteten zunächst mit 15 Borsdorfer Vertretern in einem gemeinsamen Gemeinderat. Ansprechpartner, darunter der noch 1998 gewählte Ortsvorsteher, standen für die Panitzscher vor Ort weiter zur Verfügung. Da beide Bürgermeister bei der Zusammenlegung ihr Amt verloren, fand am Sonntag, dem 28. März 1999 die Neuwahl für das Bürgermeisteramt statt. Als neuer Bürgermeister für Borsdorf wurde Ludwig Martin gewählt, der dieses Amt seitdem ausübt.
Hatten die Panitzscher sich mittlerweile an die neuen Behördenwege beim Landratsamt in Grimma oder der Außenstellen in Wurzen gewöhnt, stand ihnen nochmals ein Veränderung bevor: Im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform in Sachsen wurden mit Wirkung vom 1. August 2008 die ehemaligen Landkreise Muldentalkreis und Leipziger Land zum neuen Landkreis Leipzig vereinigt. Kreissitz wurde nunmehr Borna, wobei sich einige Verwaltungsstellen des Landratsamtes noch in Grimma befinden.
Durch Fusionen anderer Orte im Umfeld ist Borsdorf heute die flächenmäßig kleinste selbstständige Gemeinde im Landkreis Leipzig. Wenn aktuell zur Zeit keine weiteren Eingemeindungsverhandlungen auf der Tagesordnung stehen, zeichnet sich jedoch schon seit längerer Zeit ab, dass es erforderlich ist, die Verwaltungsaufgaben zukunftsfähig zu lösen und personelle und finanzielle Ressourcen zu bündeln. So wurden zum 1. Januar 2016 die Aufgaben des Standesamtes für Borsdorf an die Stadt Brandis, mit der auch eine Kehrmaschine gemeinsam genutzt wird, übertragen.
Sind die Ortsteile der Gemeinde Borsdorf inzwischen vor allem durch die Parthenfeste näher zueinander gerückt, werden sich trotzdem Traditionen und regionale Besonderheiten nach wie vor nicht verlieren. Zum gegenseitigen Miteinander trägt das gemeinsame Begehen der Ortsjubiläum 2014 in Zweenfurth sowie 2017 anlässlich der urkundlichen Ersterwähnungen von Panitzsch und Borsdorf vor 750 Jahren sicher bei.
Ein besonders Dankeschön geht an Frau Angela Neubert für die vielfältige Unterstützung bei den Recherchen!
Werbung zur 750-Jahrfeier im Dorfteich an der Hauptstraße.
Aktuelle Informationen wie den Behördenwegweiser oder Grunddaten zur Gemeinde und ihren Ortsteilen kann man der Internetseite der Gemeinde (www.borsdorf.eu) entnehmen.
Quellen und Literatur
Archive und Sammlungen
Stadtarchiv Leipzig: Ratslandstube/Ratslandgericht; Güteramt; Akten der Stadtverordneten; Akten des Rates der Stadt Leipzig (Kapitelakten).
Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig: 20009 Amt Leipzig; 20028 Amtshauptmannschaft Leipzig; 20234 Kreistag und Kreisrat Leipzig.
Kreisarchiv des Landkreises Leipzig: Gemeindeverwaltung Panitzsch (vor und nach 1945); Kreistag und Rat des Landkreises Leipzig.
Gemeinde Borsdorf, Akten der Gemeindeverwaltung.
Unterlagen des Heimatvereins Borsdorf e. V.
Werner Emmerich: Der ländliche Besitz des Leipziger Rates. [...], Leipzig 1936.
Eberhard Fischer: Der Bürgermeister und seine Stellvertreter in Panitzsch von 1920–1945. In: Vor Ort, Borsdorfer Amtsblatt mit Kirchennachrichten, 16. Jg. Nr. 1, März 2005. S. 26–30.
Ders.: Eine Episode aus dem „Nachkriegs-Panitzsch“. In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 14. Jg. Nr. 3, Juli 2003, S. 12–14.
Ders.: Daten aus der Ortsgeschichte Panitzsch und Cunnersdorf. In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 14. Jg. Nr. 6, Dezember 2003, S. 9–12.
Ders.: Das Café „Zur Mühle“. In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 14. Jg. Nr. 4, September 2003, S.16–19.
Harro Gehse: Panitzsch vor 150 Jahren.Ein Ortsstatur tritt in Kraft. In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 10. Jg. Nr. 5, November 1999, S. 3–7.
Bernd Haube: Altes Panitzsch – alte Panitzscher. Posthalter, Gutsbesitzer, Jagdpächter. Gutsbesitzer Heinrich Julius Jaeger. In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 12. Jg. Nr. 6, Weihnachten 2001, S. 9–15.
Ders.: Gestüt mit Reitbahn. (Julius Heinrich Jaeger). In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 13. Jg. Nr. 4, September 2002, S. 7–11.
Ders.: Altes Panitzsch – alte Panitzscher. Zur Geschichte eines Pferdnergutes. In: Vor Ort, Blatt für Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth, 13. Jg. Nr. 5, November 2002, S. 3.
Lutz Heydick: Der Landkreis Leipzig. Historischer Führer, Beucha 2004.
Heinz Quirin: Panitzsch. Eine Heimatgeschichte. (Nachdruck in: Lutz Heydick, Uwe Schirmer, Markus Cottin [Hrsg.]: Zur Kirchen- und Siedlungsgeschichte des Leipziger Raumes 2/2002, S. 181–234, Beucha 2001.
Vollständiges Staats-Post- und Zeitungs-Lexikon von Sachsen, verfasst von August Schumann, Achter Band, Zwickau 1821.
Handbücher der Amtshauptmannschaft Leipzig.
Gemeinde-und Ortsverzeichnis für das Königreich Sachen, Dresden 1904 (Zahlen der Volkszählung 1904).
1267–1967. 700 Jahre Panitzsch. Hrsg. vom Rat der Gemeinde Panitzsch. Panitzsch 1966
Digitales historisches Ortsverzeichnis von Sachsen: http.//hov.isgv.de/Panitzsch bzw. Cunnersdorf
wikipedia: https://de.wikipedia.org
Kleinräumiges Gemeindeblatt für Borsdorf. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, September 2014.
Die Panitzscher Kirche 2017.