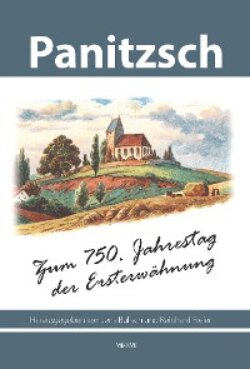Читать книгу Panitzsch - Группа авторов - Страница 9
ОглавлениеDie Urkunde mit der Ersterwähnung Panitzschs vom 14. Februar 1267
Beobachtungen zur Diplomatik sowie Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte
Markus Cottin
Die Urkunde
Die Urkunde vom 14. Februar 1267 mit der Ersterwähnung Panitzschs1 verdient über diese lokalgeschichtliche Tatsache hinaus für die Geschichte des weiteren Leipziger Umlandes große Beachtung. Mit der Urkunde wurde nämlich durch den Merseburger Bischof Friedrich I. ein Gütertausch zwischen den Brüdern Hoyer dem Älteren und Hoyer dem Jüngeren, Herren von Friedeburg, beurkundet. Neben Panitzsch wurden zwei Burgen in Schkeuditz sowie die Burg Bornstedt (bei Eisleben) als Tauschobjekte genannt. Die beiden Brüder namens Hoyer tauschten ihren Besitz derart, dass Hoyer der Ältere die beiden Burgen in Schkeuditz bekam, während Hoyer der Jüngere die Burg Bornstedt sowie Panitzsch mit weiterem, nicht näher bezeichnetem Zubehör (cum omnibus attinentiis) erhielt. Zudem wird erwähnt, dass die edle Frau Gertrud, Witwe des Ulrich, Herrn von Friedeburg, sowie die Mutter der Tauschpartner namens Mechthild, einen Anteil der Güter zu ihrer Ausstattung auf Lebenszeit, genannt Leibgedinge (libgedinge), erhalten hatten. Dieser Umstand verdient noch eine weitere Betrachtung.
Wie üblich deutet sich also auch bei dieser Ersterwähnung an, dass der genannte Ort wesentlich älter war und zudem bereits eine Entwicklung durchlaufen hatte, die ihn im Falle Panitzschs zum Mittelpunkt weiterer umliegender Besitzungen hatte werden lassen.
Die Urkunde wird heute als Nr. 65 im Domstiftsarchiv Merseburg aufbewahrt. Sie kann sich allerdings ursprünglich nicht hier befunden haben, auch wenn der Merseburger Bischof 1267 den Vorgang des Tausches beurkundete. Vielmehr handelte es sich dabei um die Ausstellung und Beurkundung durch den Merseburger Bischof Friedrich I. in fremder Sache, d. h. er hatte nach dem Wortlaut der Urkunde nichts mit deren Rechtsinhalt zu tun.
In einer Urkunde vom 14. Februar 1267 wird der Ortsname Panitzsch zum ersten Mal erwähnt. Die Urkunde wird heute im Domstiftsarchiv Merseburg aufbewahrt.
Demnach müsste die Urkunde zunächst an anderer Stelle verwahrt worden sein, sehr sicher im Besitz der Herren von Friedeburg. Die Nennung der Burgen Schkeuditz und Bornstedt nährt die Vermutung, dass es dort Möglichkeiten zur sicheren Aufbewahrung von Urkunden gab. Dass die Urkunde schließlich in das Archiv des Merseburger Domkapitels gelangte, hängt damit zusammen, dass sowohl Schkeuditz als auch Panitzsch wenig später in den Besitz der Merseburger Kirche gelangten. Der Merseburger Bischof Friedrich I. dürfte daher nicht zufällig zur Beurkundung herangezogen worden sein, war er doch als benachbarter Territorialfürst bereits in die Vorgänge um die Herren von Friedeburg eingebunden. Seine Mitwirkung dürfte bereits auf die spätere Erlangung der Friedeburgschen Besitzungen abgezielt haben.
Die Urkunde muss sich spätestens im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts in Merseburg befunden haben, denn damals wurde sie in das sogenannte Chartularium magnum (Domstiftsbibliothek Merseburg, Cod. I, 118) eingetragen. Dabei handelte es sich um ein bischöfliches Kopialbuch, das die Abschriften der wichtigsten Urkunden der Merseburger Kirche enthielt.2 Angelegt hatte es der oberste Schreiber der bischöflich-merseburgischen Kanzlei, Nikolaus Schlehndorf, der an der päpstlichen Kurie, der damals wohlorganisiertesten Behörde des lateinischen Westens, Erfahrungen gesammelt hatte. Insbesondere im 18. Jahrhundert ist die Urkunde dann in Merseburg noch mehrfach abgeschrieben worden. Ihre erste und bislang einzige wissenschaftliche Edition erfuhr sie im Rahmen des Merseburger Urkundenbuchs durch Paul Fridolin Kehr. Dieser hatte die Merseburger Urkunden bis zum Tode des Merseburger Bischofs Heinrich VI. im Jahre 1357 ediert.3 Dank seiner Untersuchungen im Rahmen der Urkundenedition gibt es sogar Vorstellungen zum Schreiber der Urkunde. Kehr bezeichnete diesen, wie in der Urkundenforschung üblich, als „Notar B“. Dem namenlosen Schreiber konnten einige in Handschrift, Diktat und Stil gleiche Urkunden aus der bischöflichmerseburgischen Kanzlei zugewiesen werden.4 Diese wurden zwischen 1255 und 1296 ausgefertigt. Der in einigen Urkunden unter Bischof Friedrich I. genannte „magister Martinus notarius“ könnte jener „Notar B“ gewesen sein, der die Ersterwähnungsurkunde geschrieben hat. Dieser hätte somit dem Merseburger Domklerus angehört. Otto Posse, königlich-sächsischer Archivrat und Archivar am Sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden, wies dem Schreiber in seinem Werk über die Privaturkunden (dazu zählten auch bischöfliche Urkunden) mehrere Urkunden zu.5 Zu diesen zählten auch weitere Stücke, die Rechtsgeschäfte der Herren von Friedeburg betrafen. Hervorzuheben ist die Urkunde vom 29. April 1269, mit der Hoyer der Jüngere von Friedeburg Panitzsch an den Merseburger Bischof Friedrich I. verkaufte.
Der Erwerb Panitzschs durch den Merseburger Bischof Friedrich I.
Um im östlichen Leipziger Land einen Stützpunkt zu gewinnen, hatten sich die Merseburger Bischöfe seit der Mitte des 13. Jahrhunderts den Herren von Friedeburg angenähert. Deren Besitzungen sollten bald dem Hochstift zuwachsen.6 Die Herren von Friedeburg, ursprünglich um den namengebenden Ort an der Saale, bei Halle, im Mansfelder Land und bei Eilenburg ansässig,7 zogen sich aus diesen Besitzungen zurück und fanden im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts in der Oberlausitz ein neues Betätigungsfeld.8 Dort zeugt noch heute der Name der Stadt Hoyerswerda von den Friedeburgern als Stadtgründer. Von 1243 bis 1317 verfügten die Herren von Friedeburg über ganz enge Beziehungen zu den Merseburger Bischöfen,9 die u. a. auch zur Veräußerung der Schkeuditzer Burgen führte. Dem Merseburger Bischof gelang es vielfach jedoch erst nach zähen Auseinandersetzungen mit den wettinischen Markgrafen von Meißen, die neu erworbenen Besitzrechte zu sichern. Der Erwerb Panitzschs mit weiteren zugehörigen Dörfern bildete einen wichtigen Baustein, um die merseburgischen Ansprüche im Leipziger Land durchzusetzen.
Erst durch Verträge von 1270 und neuerlich 1271 vertrug sich der Wettiner Dietrich, Markgraf von Landsberg mit Bischof Friedrich I. über Panitzsch und die umliegenden Dörfer,10 die nunmehr unangefochten Merseburger Besitz sein sollten. 1270 werden die Dörfer mit Zweenfurth, Borsdorf, Althen, Wolfshain (halb), Schönefeld und Volkmarsdorf einzeln aufgeführt. Dabei handelt es sich offenbar um das „weitere Zubehör“ der Urkunde von 1267. Ein Teil dieser Dörfer, soweit sie zum Kirchspiel Panitzsch gehörten,11 sollen in die Betrachtung mit einbezogen werden, um ein Bild vom Siedlungsgang in der Landschaft um Panitzsch zu gewinnen.
Neue siedlungs- und herrschaftsgeschichtliche Überlegungen zur Urkunde von 1267
Heinz Quirin ist eine ausführliche Ortsgeschichte Panitzschs zu verdanken,12 ferner hat Max Müller 1937 für den Ostteil der Leipziger Tieflandsbucht eine Siedlungsgeschichte vorgelegt.13 Beide sind auf die Bedeutung der Urkunde von 1267, ihre Stellung im Ringen zwischen den Bischöfen von Merseburg und den Wettinern um das Leipziger Land sowie auf Panitzsch eingegangen. Ihre Ansicht, bei Müller nur vorsichtig geäußert, die Herren von Friedeburg hätten rings um Panitzsch durch die Besiedlung ein kleine Gerichts- bzw. Grundherrschaft aufgebaut, soll im Folgenden einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Dabei sind archäologische, schriftliche und siedlungskundliche Quellen gleichermaßen zu befragen.
Letztere Quellen, also die Dorf- und Flurformen der Orte aber auch die Kirchenorganisation14 erlauben Aussagen über die Zeit vor der Ersterwähnung Panitzsch von 1267. Als stabilste Strukturen des Mittelalters haben sich die Kirchensprengel erwiesen, deren Veränderung sich zudem aufgrund der besseren Überlieferungslage kirchlicher Archive gut nachweisen lässt. Die Panitzscher Kirche bildete bis 1529 die Pfarrkirche für die Filialkirchen in Althen, Sommerfeld und Zweenfurth. In letztere Kirche war zudem Borsdorf, das nicht über eine eigene Kirche verfügte, eingepfarrt. Die meisten dieser Orte werden erstmals im Zusammenhang mit den Friedeburgschen Besitzveränderungen in den 1260er bzw. 1270er Jahren genannt. Als Pfarrkirche stellte die Panitzscher Kirche zweifelsohne die älteste Kirche dieses Sprengels dar. Zudem müssen die eingepfarrten Dörfer in einer herrschaftlichen Beziehung zu Panitzsch gestanden haben, sonst wären sie nicht in die dortige Kirche gepfarrt worden. Vom hohen Alter der Panitzscher Kirche zeugen archäologische Funde.15 So lässt sich nachweisen, dass es vor dem Bau einer steinernen Kirche zwei aufeinanderfolgende Holzkirchen an dieser Stelle gab. Offenbar stammt der Steinbau aus der Mitte des 12. Jahrhunderts spätestens jedoch aus der Zeit um 1220. Aus diesem Jahr stammt die Ersterwähnung Sommerfelds16 – sie ist die früheste im gesamten Panitzscher Kirchspiel. Markgraf Dietrich von Meißen übereignete in jenem Jahr Sommerfeld an das eben gegründete Heilig Kreuz-Kloster in Meißen. Dabei können zwei für den Siedlungsgang bemerkenswerte Tatsachen beobachtet werden. Zum einen hatte der Markgraf die Sommerfelder Güter von Heinrich Vogt von Schkeuditz gekauft. Zum anderen ist mit den in der Urkunde genannten 32 Hufen, der Gesamtumfang Sommerfelds wohl annähernd umrissen.17 Gemäß der mittelalterlichen Dorf- und Flurverfassung bildete der Besitz einer an eine Hofstelle gebundenen Hufe die Grundlage für die Teilhabe des Hofstellenbesitzer am Gemeinderecht. Eine Hufe war zudem eine wirtschaftliche Einheit, die die Möglichkeit bot, eine Familie (im weiteren Sinne mit Gesinde und Auszüglern) zu ernähren. Da es im 16. Jahrhundert in Sommerfeld nur noch 26 Höfe gab, muss es bis dahin einen Rückgang gegeben haben.18 Siedlungsgenetisch stellt Sommerfeld ein Straßenangerdorf dar.
Der Sommerfelder „Bauernastronom“ Christoph Arnold zeichnete im Jahre 1690 einen Plan Sommerfelds mit den zugehörigen Gebäuden und Grundstücken.
Diese weisen einen ellipsenförmigen Grundriss auf, wobei sich in der Mitte der Anger mit Kirche sowie weiteren öffentlichen Gebäuden befindet und ringsherum in zwei gegenüberliegenden Reihen die Gehöfte liegen. Für Sommerfeld hat sich aus dem Jahre 1690 einer der frühesten Dorfgrundrisse erhalten, der dies beeindruckend veranschaulicht. Die frühe Erwähnung Sommerfelds mit 32 Hufen ist insofern bemerkenswert, als mit Baalsdorf (1213: 20 Hufen, 3 Hofstellen) und Probstheida (1213: 30 Hufen) zwei weitere Straßenangerdörfer im Leipziger Osten bereits früh als voll ausgebildet erwähnt werden.19 Sie dürften also um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert entstanden sein und den Landesausbau im östlichen Leipziger Land belegen. Die Nennung von Gehöften oder Hufen in dieser frühen Zeit muss nicht bedeuten, dass die Hofstellen bereits vollständig besetzt waren, wohl aber vorgeplant und der Dorfraum gegen die Flur abgegrenzt. Die jüngsten archäologischen Untersuchungen Dirk Scheidemantels zum Straßendorf Breunsdorf, ebenfalls eine Dorfform der Ostsiedlung, haben nach der Lesart des Archäologen Felix Biermann diese Beobachtung hervorgebracht.20
Das Beispiel Sommerfeld führt somit die Planmäßigkeit der Anlage neuer Siedlungen vor Augen, die sich auch im Falle des Straßenangerdorfs (mit Filialkirche) Althen bestätigt, das gleichermaßen zur Pfarrei Panitzsch gehörte.21
Die Erwähnung eines edelfreien Herren von Schkeuditz als Besitzer schlägt die Brücke zur Panitzscher Urkunde von 1267 und erlaubt völlig neue Rückschlüsse zur Besiedlung des östlichen Leipziger Landes. Die Herren von Schkeuditz waren nämlich mit den Herren von Friedeburg verwandt, ja letztere traten sogar deren Erbe an.22 Sommerfeld ist insofern ein Glücksfall, als der Ort zu einem Zeitpunkt genannt wird, da er sich noch in der Hand der Schkeuditzer befand. Die Zugehörigkeit zum Kirchspiel Panitzsch gestattet es, unter Hinzuziehung weiterer Quellen Parallelentwicklungen auch für die übrigen Orte anzunehmen. Die in der Urkunde von 1267 genannte Gertrud, der ein Teil von Panitzsch zum Leibgedinge gegeben worden war, bildet die Brücke zwischen den Herren von Schkeuditz und von Friedeburg. Die Gemahlin Ulrichs von Friedeburg war eine geborene Frau von Schkeuditz. 1262, nunmehr schon als Witwe, übereignete sie der Marienkapelle im Leipziger Hof ihres verstorbenen Gatten 60 Mark Silbers.23 Der Hof wird 1285 als einstiger Besitz der Herren von Schkeuditz genannt,24 gehörte demnach der Familie, die das Amt des Leipziger Stadtvogts inne hatte. Eine nicht sicher zu datierende Urkunde belegt, dass die Witwe über Besitz in Abtnaundorf (12 Hufen) verfügte, den sie dem Merseburger Benediktiner-Kloster St. Peter übereignete.25 Erneut lässt sich damit ein Ort im Osten des Leipziger Landes erkennen, der zum Besitz der Herren von Friedeburg und damit zuvor wohl der Herren von Schkeuditz zählte. Abtnaundorf ergänzt die Reihe der Orte, die 1270 im Zusammenhang mit Panitzsch genannt werden: Althen, Wolfshain, Schönefeld und Volkmarsdorf.26 Als Naundorf, also „neues Dorf“ kennzeichnet es siedlungsgeschichtlich eine Randlage in der Nähe älterer, wohl slawischer Dörfer. Tatsächlich zwängt sich die Abtnaundorfer Flur zwischen die von Schönefeld und Cleuden.
Zur Bedeutung der Herren von Schkeuditz und deren Verbindung zum nahen Leipzig muss ein Blick auf deren Entwicklung im 12. und 13. Jahrhundert geworfen werden. Seit 1118 sind die Herren von Schkeuditz in Urkunden bezeugt. Dabei traten vor allem in der Umgebung der Erzbischöfe von Mainz sowie der Halberstädter Bischöfe auf, ehe mit Otto von Schkeuditz ein Vertreter der Familie (wenig erfolgreich) Bischof von Halberstadt wurde. Vor 1123 hatte die Familie in Heusdorf (bei Apolda) ein Hauskloster gegründet, dessen Vogtei (weltliche Aufsicht) sie übernahm.27 Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts finden sich die Herren von Schkeuditz im Umfeld der Naumburger Bischöfe sowie der wettinischen Markgrafen von Meißen aber auch der römisch-deutschen Könige. Sie bezeugten bedeutende Rechtsakte mit, wie die Weihe der Zwickauer Marienkirche 1118, 1143 die Bestätigung der Klostergründung in Chemnitz durch König Konrad III. sowie die Gründung des Klosters Zelle 1173 durch König Friedrich I.28 Hervorzuheben ist die Nennung Gottschalks von Schkeuditz im Leipziger Stadtbrief von 1156/70 als Vogt der Stadt.29 Der Vertreter der Familie von Schkeuditz war als markgräflicher Vogt mit einem wichtigen Amt betraut. Der ungewöhnliche Rufname Gottschalk findet seine Parallele in Zweinaundorf, wo das Oberdorf 1335 als „Gotschalges Nuendorf“ erscheint.30 Harald Schieckel nahm an, dass der Leipziger Stadtvogt Gottschalk von Schkeuditz der Ortsgründer war.31 Neuerlich würde man damit im östlichen Leipziger Land Besitz der Familie von Schkeuditz antreffen. Das edelfreie Geschlecht lässt sich vor seinem Aussterben nach 1224 also in enger Bindung an die Wettiner sowie die römisch-deutschen Könige feststellen.
Susanne Baudisch hat sich für Nordwestsachsen intensiv mit dem lokalen Adel und dessen Siedlungsbemühungen auseinandergesetzt.32 Dabei konnte sie feststellen, dass es im 12. Jahrhundert zunächst edelfreie Geschlechter waren, die in kleinem Maßstab die Besiedlung vorantrieben. Häufig ließ sich dabei ein Klientelverhältnis zu den Markgrafen von Meißen, den Magdeburger Erzbischöfen oder den Bischöfen von Merseburg oder Naumburg erkennen. Dabei stellte Susanne Baudisch fest, dass die Parthenaue bis um 1200 ohne Nennung kleiner Herrschaftsträger blieb – was auch mit den dort vorherrschenden Straßenangerdörfern ohne Herrensitz zu tun hat.33
Nach dem bisher Festgestellten, darf angenommen werden, dass die Herren von Schkeuditz diese Lücke ausfüllten, ohne freilich durch die entsprechenden Herkunftsnamen Spuren in der Überlieferung zu hinterlassen. Dass die Familie über Erfahrungen beim Landesausbau verfügte, belegt eine Urkunde des Halberstädter Bischofs Otto von Schkeuditz, der 1123 über den Rodezehnten der slawischen und deutschen Bevölkerung in Unterwiederstedt (bei Hettstedt) verfügt hatte.34 Zu überprüfen ist noch, ob die im 13. Jahrhundert zur Burg Schkeuditz zählenden Dörfer wenigstens zum Teil auf Siedlungsbemühungen der Herren von Schkeuditz zurückgingen35 und welche Verbindung zu den gleichfalls als Siedlungsinitiatoren auftretenden Herren von Wahren bestand.
Für das Engagement der Herren von Schkeuditz östlich von Leipzig seien die Argumente nochmals zusammengefasst: der Besitz Sommerfelds durch einen Herren von Schkeuditz vor 1220, die Verschwägerung mit den Herren von Friedeburg und der damit verbundene Besitzübergang an diese, der für den Stammsitz Schkeuditz sicher gleichermaßen gilt wie für die Dörfer im Osten von Leipzig, deren Umfang sich weitgehend mit dem Kirchspiel Panitzsch deckt, schließlich die Stiftungen Gertruds von Schkeuditz (Marienkapelle auf dem ehemaligen Hof der Herren von Schkeuditz in Leipzig, Abtnaundorf) und der Ortsname Gottschalksnaundorf (Zweinaundorf-Oberdorf).
Dass die Herren von Schkeuditz im Osten Leipzigs oder im Umfeld ihres Stammsitzes im Auftrag oder in Anlehnung an die Merseburger Bischöfe gesiedelt hätten, ist nicht anzunehmen, da sie sich kaum in deren Urkunden nachweisen lassen.36 Die ältere Forschungsmeinung, es handele sich bei den Panitzscher Besitzungen um eine Siedlungskomplex der Herren von Friedeburg in Anlehnung an die Merseburger Bischöfe ist zurückzuweisen, da sich die Familie erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts in der Umgebung der Merseburger Bischöfe nachweisen lässt – zu einer Zeit, da das östliche Leipziger Land bereits besiedelt war.37
Vielmehr ist zu fragen, in welche Interessenssphäre die Herren von Schkeuditz eingebunden waren, die ihr Auftreten im östlichen Leipziger Land zusätzlich abstützen. Die Herren von Schkeuditz bezeugten zumeist Urkunden der wettinischen Markgrafen von Meißen und dürften zu deren engsten Vertrauten gehört haben. Es ist insbesondere auf den Leipziger Stadtbrief (1156/70) zu verweisen, in dem Gottschalk von Schkeuditz erstmals als Stadtvogt erscheint. Diesem folgte 1191 und 1195 Heinrich von Schkeuditz, der 1224 letztmals genannt wird. 38 Sein Titel „advocatus“ kann nur auf das Leipziger Vogtamt bezogen werden, das offenbar in der Familie von Schkeuditz vererbt wurde. Die Übertragung des Vogtamtes durch die wettinischen Leipziger Stadtherren an die Herren von Schkeuditz zeugt von einer besonderen Vertrauensstellung, war doch die Stadt im ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhundert heftig umstritten. Dabei ist nicht nur an die Merseburger Bischöfe zu denken, sondern auch an die Magdeburger Erzbischöfe, die das benachbarte Taucha in jener Zeit intensiv förderten39 und weiter östlich, ausgehend von den Kirchengründungen in Machern und Brandis, mit Hilfe der Herren von Brandis und unterstützt durch die Merseburger Bischöfe, Siedlungsbemühungen unternahmen.40 In Dewitz lässt sich 1212 einmalig ein Ministeriale nachweisen, der nach Susanne Baudisch das Gegengewicht zu den magdeburgischen Besitzungen um Taucha bildete.41 Zwischen den genannten Orten erstreckt sich der Siedlungskomplex von Panitzsch. Folgt man weiterhin der Annahme, dass dieser durch die Herren von Schkeuditz aufgesiedelt wurde, erhält dies eine logische Stütze durch deren Rolle als wettinische Gefolgsleute, die so ein Gegengewicht zum magdeburgischen Taucha bildeten. Dieses befand sich seit 1004 mit dem umliegenden Burgbezirk (Burgward) im Besitz des Erzstifts Magdeburg.42 Zu vermuten ist, dass der große Sprengel der Taucher Moritzkirche mit dem Filial Portitz sowie Cradefeld, Dewitz, Sehlis, Merkwitz, Graßdorf, Plaußig, Seegeritz und Plösitz den Umfang des Burgwards Taucha umreißt.43 Ob Panitzsch ursprünglich ebenfalls zum Sprengel oder Burgward gehörte, muss dahingestellt bleiben.44
Eine später erkennbare Bindung Panitzschs sowie der südlich liegenden Dörfer Althen und Sommerfeld stellt die Pflicht zur Unterhaltung des Steinwegs in Taucha dar.45 Angesichts des unterschiedlichen Alters der Dörfer wird man daraus jedoch kaum auf die Zugehörigkeit zum Burgward Taucha schließen können. Vielmehr stellte dies eine wirtschaftliche Beziehung dar, konnten doch so die Bauern der betreffenden Dörfer ihre Produkte geleitsfrei auf den städtischen Markt bringen. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert förderte der Magdeburger Erzbischof Wichmann, parallel zur Stadterhebung Leipzigs, sein Städtchen Taucha.46 1174 werden indirekt Tauchaer Kaufleute erwähnt,47 der Bau einer Stadtmauer erfolgte 1220. Die wettinischen Markgrafen von Meißen erwehrten sich in dieser Zeit den Ansprüchen verschiedener Landesherren an Elster, Pleiße und Mulde durch die Ansetzung eigener Getreuer edelfreier und ministerialischer Geschlechter. Südlich von Taucha dürften die Herren von Schkeuditz, wie bereits ausgeführt wurde, diese Rolle übernommen haben. Es bleibt einem genaueren Blick auf den Gang der Besiedlung in Panitzsch und Umgebung vorbehalten, festzustellen, wie diese Siedlungsbemühungen zeitlich gelagert waren.
Die Siedlungsentwicklung Panitzschs und der Dörfer im Panitzscher Kirchsprengel
Heinz Quirin hat zur Siedlungsgenese Panitzschs grundsätzliche Überlegungen angestellt, die nun wieder aufgegriffen werden können. Seine Vermutung, dass die abseits vom Ort stehende Panitzscher Kirche eher als die Siedlung entstand, ist zu überprüfen. Allerdings darf die Lage der Kirche48 nicht überbewertet werden – auch die Kirchen Thekla (Cleuden) und Engelsdorf sind abseits vom Ort errichtet worden, um einen erhöhten Punkt ausnutzen zu können.
Gewichtig sind Quirins Äußerungen zur Panitzscher Dorf- und Flurform, die eine gestufte Entwicklung erkennen lassen. Im Osten des Dorfes sowie im regellosen Teil zwischen den beiden Häuserzeilen vermutet Quirin einen slawischen Weiler.49 Die ethnische Zuweisung von Siedlungen wird heute sehr kritisch gesehen. Vielmehr verdeutlichen die Schriftquellen und archäologische Funde ein friedliches Nebeneinander von slawischen und deutschen Siedlern, ja zumeist gemeinsame Siedlungsvorgänge. Allein die Übernahme eines slawischen Ortsnamens, wie im Falle Panitzschs, belegt, dass sich die Kulturen gegenseitig beeinflussten. Die von Heinz Quirin als älter erachteten Grundstücke waren stärker belastet (Abgaben, Frondienste) als die Höfe im übrigen Ort. Eine ursprüngliche Feldflur weist Quirin diesem Ortsteil nicht zu. Jünger sind die geschlossene nördliche Zeile und die südliche Zeile mit Gehöften. Mit diesen beiden Zeilen entstand offenbar die weitausgreifende Gewannflur, die die Praktizierung der Dreifelderwirtschaft sowie den schollenwendenden Pflug voraussetzt. Die kleinen blockartigen Gewanne nahe am Dorf könnten auf eine ältere Flureinteilung hindeuten, die später umgestaltet wurde. Dorf- und Ortsform deuten damit auf eine stufenweise Entstehung hin. Zu bedenken ist, dass der Panitzscher Dorfgrundriss auch der landschaftlichen Lage – Partheniederung im Süden, Höhenzug des Kirchbergs im Norden – geschuldet ist. Klassische Dorfformen wie südlich von Panitzsch lassen sich daher nicht feststellen, doch ist an die Erweiterung einer weilerartigen Ansiedlung durch eine dem Gelände angepasste straßenangerdorfartige Anlage zu denken. Die Grundstücke der nördlichen und südlichen Zeile waren wesentlich niedriger belastet als die im Osten gelegenen. Dies entspricht dem Charakter der Ostsiedlung des 12. Jahrhunderts, als die Siedler zu günstigen Bedingungen angesetzt wurden. Zugleich konstituierte sich die bäuerliche Gemeinde, die aus den hof- und feldbesitzenden Nachbarn bestand und dem Grund- und Gerichtsherrn als Gemeinschaft gegenübertrat. Zur Panitzscher Nachbarschaft zählten im 16. Jahrhundert alle Höfe auf der Nord-, Süd- und Ostseite, d. h. die Besiedlung brachte eine weitgehende rechtliche Integration verschiedener Siedlungsteile mit sich.50
Die relative Chronologie (Ost-Süd-Nord-Bebauung in der Mitte) lässt sich unter Hinzuziehung archäologischer Quellen nur zurückhaltend in einer absolute Chronologie darstellen. Geht man von den archäologischen Befunden aus,51 so bestand bereits im 8./9. Jahrhundert südwestlich vom Ort eine slawische Siedlung. Im heutigen Ort gibt es aus dem 10./11. Jahrhundert auf dem Gelände des „Blauen Engel“ slawische Siedlungsspuren. Im übrigen Dorf dominieren Funde, die erst aus dem 12. bzw. 13. Jahrhundert stammen, wobei insbesondere auf einen Röhrenbrunnen aus dem 13. Jahrhundert im südöstlichen Ortsteil zu verweisen ist. Diese punktuellen archäologischen Funde lassen sich nur schwer mit der auf siedlungskundlicher Grundlage erstellten Chronologie in Einklang bringen. Immerhin ist der Beleg einer frühen slawischen Siedlung, die später wieder einging, bemerkenswert. Die erste Panitzscher Kirche, die sich archäologisch nachweisen lässt, stammt frühestens aus dem späten 11. Jahrhundert, und damit rund ein Jahrhundert nach der Tauchaer Moritzkirche.52 Die relativ geringe Ausstattung der Panitzscher Kirche mit nur zwei Hufen lässt nicht an eine Urkirche denken. Die frühen Befunde aus dem Gelände des „Blauen Engel“ könnten auf eine frühe Ansiedlung im Sinne Quirins hindeuten.
Im 16. Jahrhundert umfasste Panitzsch 34 Gehöfte (besessene Mannen) und fünf Häusler.53 Diese Gesamtzahl entspricht den großen Straßenangerdörfern des Leipziger Ostens. Zu bedenken ist, dass die Zahl der Hofstellen im späten Mittelalter allgemein zurückging, so dass die Zahlen des 16. Jahrhunderts nur einen Anhaltspunkt bieten. Denkbar ist auch, dass sich an Kirche und frühe Siedlung (Blauer Engel) bald weitere Gehöfte anschlossen, was vielleicht sogar zur Aufgabe der südöstlich gelegenen slawischen Siedlung führte. Für die nördliche und südliche Zeile bleibt als Entstehungszeitraum das 12. Jahrhundert, wobei als Schlusspunkt spätestens die Nennung Sommerfelds 1220, die diesen Ort voll ausgebildet zeigt. Die Zusammenschau archäologischer und siedlungskundlicher Quellen muss künftig für Panitzsch noch weiter betrieben werden.
Partheaufwärts liegen mit Borsdorf und Zweenfurth zwei Dörfer, die ebenfalls zum Kirchspiel Panitzsch gehörten. Sie weisen als Sackgassendorf (Borsdorf) bzw. Zeilendorf mit Gassenteil (Zweenfurth) Merkmale stufenweiser Entstehung auf.54 Ihre Ersterwähnung erfolgte mit 1267 bzw. 1264 relativ spät. Es kann allerdings nicht überraschen, dass beide Orte an der Parthe liegen, ihre Ortsform damit auch von den Geländegegebenheiten bestimmt ist. Zweenfurth kam, wie der Name andeutet, eine strategische Bedeutung als Flussübergang zu. Nicht zufällig geschah die Ersterwähnung gelegentlich einer Urkundenausstellung im Ort durch das Leipziger Kloster der Georgennonnen, wobei mit den Burggrafen von Meißen und den Burggrafen von Magdeburg hochrangige adlige Vertreter anwesend waren.55 Folgt man der Parthe weiter flussaufwärts, trifft man auf das Gebiet um Wolfshain56, Albrechtshain, Eicha und Naunhof, das von Uwe Schirmer und Lutz Heydick siedlungsgeschichtlich untersucht wurde.57 Die Orte führen in andere herrschaftliche Zusammenhänge und gehörten nicht zum Panitzscher Kirchspiel. Für dieses bleibt insgesamt der Eindruck, dass die Besiedlung mit kleineren Ortsformen an der Parthe begann und sich spätestens um 1200 auf die links und rechts liegenden Hochflächen erstreckte, wo beinahe idealtypische Siedlungsformen entstanden. Die älteren Siedlungen wurden dabei weiter ausgebaut (Anbau von Zeilen bzw. Gassen). Zweenfurth, Althen und Sommerfeld erhielten Filialkirchen, die der Panitzscher Kirche unterstellt wurden. Nachdem Sommerfeld 1220 bereits in andere Hände gelangt waren, werden 1270/71 als Friedeburgscher Besitz um Panitzsch noch Zweenfurth, Borsdorf, Althen, Wolfshain (halb), Schönefeld und Volkmarsdorf genannt.
Die letzteren drei Orte müssen außerhalb der siedlungsgeschichtlichen Betrachtung bleiben, da sie nicht zum Kirchspiel Panitzsch gehörten und insbesondere im Falle Schönefelds komplizierte Verhältnisse bezüglich der Lehnszugehörigkeit vorliegen.58 Kehrt man zu Panitzsch zurück, so ist festzuhalten, dass Heinz Quirin einen bis in die Neuzeit fortschreitenden Ausbau des Ortes nachweisen konnte.59 Zeugnis dafür sind zum einen die Häusler, die nicht zur Nachbarschaft gehörten sowie der Wüstfall benachbarter Orte.
Heinz Quirin hat dies für das östlich benachbarte Cunnersdorf zeigen können. Nach dessen Wüstfall lassen sich Fluranteile im Besitz Panitzscher Bauern nachweisen.60 Offenbar hatten die Panitzscher wüstliegende Felder an sich gezogen oder es kam zur Übersiedlung Cunnersdorfer Bauern nach Panitzsch, die von hier aus ihre Felder weiter bestellten. Problematisch erscheint die von der älteren Forschung festgestellte Wüstung Wilchwitz zwischen Panitzsch und Sommerfeld im Bereich der „Wildbuschstücken“. Dieser scheinbar 1349/50 singulär belegte Ort „Wilchwicz“61 ist vielmehr aufgrund besitzgeschichtlicher Beobachtungen mit Wilchwitz nordöstlich Altenburg gleichzusetzen.62
Dank neuer Erkenntnisse der Archäologie und der historischen Forschung kann man heute über Heinz Quirins Panitzscher Geschichte hinauskommen, ohne freilich dessen Beobachtungen zur Siedlungsgenese völlig verwerfen zu müssen. Die Ersterwähnungsurkunde Panitzschs von 1267 forderte dazu heraus, den Blick auf landes- und reichsgeschichtliche Ereignisse zu werfen, wenn man bedenkt, dass die massiven Verkäufe und Auseinandersetzungen im Leipziger Land während des sogenannten Interregnums stattfanden. Frühe Nennungen der Herren von Schkeuditz östlich von Leipzig ließen die Vermutung aufkommen, dass diese vor den Herren von Friedeburg hier Besitz hatten und ein wettinisches Gegengewicht zum erzbischöflichmagdeburgischen Besitzkomplex um Taucha darstellten. Diese Vermutung bedarf der weiteren Erhärtung durch schriftliche und archäologische Quellen. Dass sich indes die Herren von Friedeburg erst seit 1243 in der Umgebung der Merseburger Bischöfe finden, zeigt deutlich das aufkeimende Interesse der geistlichen Landesherren am Besitz dieses adligen Geschlechts. Tatsächlich gehörten diese neben den Wettinern zu den Familien, deren Besitz die Merseburger Bischöfe in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts umfangreich auskaufen konnten.
Dies führte aber lediglich zur merseburgischen Lehnsherrschaft über Leipzig sowie über die Dörfer bei Panitzsch. Eine geschlossene Landesherrschaft konnten die Bischöfe nur westlich von Leipzig aufbauen, während das östliche Leipziger Land unter der Botmäßigkeit der Wettiner stand. Die Urkunde von 1267, der Panitzsch seine Ersterwähnung verdankt, zeigt stellvertretend für weitere die bunte Mischung der Herrschaftsverhältnisse rings um Leipzig.
Dieser Orts- und Flurgrundriss von Panitzsch stammt aus dem Jahre 1840.