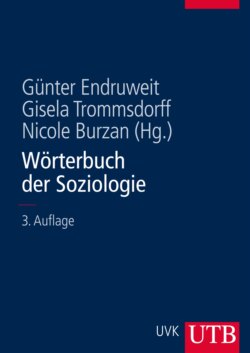Читать книгу Wörterbuch der Soziologie - Группа авторов - Страница 10
Оглавление[76]D
Datenanalyse
Die Datenanalyse (engl. data analysis) umfasst alle Schritte der Aufbereitung und Auswertung empirischer Daten im Hinblick auf eine Fragestellung. Diese kann sich im Schwerpunkt etwa auf die Deskription eines Phänomens, die Überprüfung einer Theorie oder eine Evaluation richten.
Das erkenntnistheoretische und empirische Konzept der Untersuchung sowie die qualitativen/quantitativen Methoden der Datenerhebung (z. B. Befragung, Beobachtung, Inhaltsanalyse von Quellen) beeinflussen dabei erheblich das Spektrum der Auswertungsmöglichkeiten. So können standardisiert erhobene Daten nicht interpretativ ausgewertet werden, und das Messniveau der Merkmale bedingt, welche statistischen Analysen zweckmäßig sind.
In der quantitativen Forschung erfolgt die Datenanalyse typischerweise mit Hilfe von Statistik (je nach Anzahl zugleich berücksichtigter Merkmale uni-, bi- oder multivariate Statistik, deskriptive/ schließende Statistik). So werden – unterstützt durch Analysesoftware (z. B. SPSS, Stata) – große Datenmengen zusammengefasst und vorab aufgestellte Hypothesen überprüft.
Die qualitative Forschung nutzt interpretative/ hermeneutische, daneben kategorisierende Auswertungsmethoden (z. B. Narrationsanalysen, Objektive Hermeneutik, Grounded Theory, dokumentarische Methode), etwa um Sinndeutungen von Akteuren im Kontext struktureller Bedingungen zu rekonstruieren. Sie ist oft eher theorieentwickelnd statt -prüfend ausgerichtet.
Nach der Datenanalyse im engeren Sinne folgt im Forschungsprozess eine umfassende Interpretation im Sinne der Fragestellung sowie eine Einschätzung des Erkenntnisgewinns, ggf. zudem ein Ausblick auf künftige Forschungen oder Empfehlungen bei anwendungsorientierter Forschung.
Literatur
Kühnel, Steffen-M.; Krebs, Dagmar, 2007: Statistik für die Sozialwissenschaften, 5. Aufl., Reinbek. – Müller-Benedict, Volker, 2007: Grundkurs Statistik in den Sozialwissenschaften, 4. Aufl., Wiesbaden. – Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika, 2010: Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, 3. Aufl., München, bes. Kap. 5.
Nicole Burzan
Definition der Situation
(engl. definition of situation) Menschliche Handlungen vollziehen sich i. d. R. in Situationen, d. h. innerhalb raumzeitlicher Ausschnitte der aktuellen Umwelt, die durch Akteure definiert werden und so ihr Handeln anleiten.
Eine der ersten und bis heute maßgebenden soziologischen Konzeptionen der Situationsdefinition ist das sog. Thomas-Theorem, das auf den Zusammenhang der Deutung einer Situation und den daraus resultierenden Folgen aufmerksam macht. »If men define situations as real, they are real in their consequences.« (Thomas/Thomas 1928: 572). Ein gemeingefährlicher Gefängnisinsasse, so ein Beispiel von Thomas, verstand beim Freigang Selbstgespräche von Passanten als Beschimpfungen seiner selbst mit der Konsequenz, diese Mitmenschen zu erschlagen.
Bei der Situationsdefinition geht es um die Frage: »Was geht hier eigentlich vor?« (Goffman 1977: 26). Idealiter werden in Situationsdefinitionen zunächst die gegebenen äußeren und inneren Voraussetzungen (materielle Gegebenheiten, Normen, soziale Beziehungen, Einstellungen, Wünsche, aber auch etwa klimatische Bedingungen) registriert und geordnet (u. a. durch zweck-, oder wertrationale, emotionale oder identitätsbewahrende Ziele oder einem Abgleich von aktuell erfahrenen und früheren Situationsdefinitionen). Hierfür stehen den Akteuren durch Sozialisation sowie Erfahrung gesellschaftliche Deutungsmuster zur Verfügung. Esser beschreibt sie als mentale Modelle typischer Situationen und bezeichnet sie im Anschluss an Goffmans (1977) Rahmentheorie als »frames« (Esser 2001: 261 ff). Sie vereinfachen die Situationslogik und ermöglichen so erst Handlungen. Würden in einer Situation alle verhaltensrelevanten Möglichkeiten berücksichtigt, wären Akteure handlungsunfähig.
Daher sind alltägliche Situationsdefinitionen meist gesellschaftlich vorgegeben, selten individuell entwickelt. Die Anpassung an gesellschaftlich fixierte und oft verbindliche Situationsdefinitionen[77] ermöglicht Kooperation und Ordnung. Individuell relativ eigenständige Situationsdefinitionen können hingegen zu sozialem Wandel führen. Sie setzen i. d. R. Wissen über konventionelle Situationsdefinitionen voraus.
Soziologische Konzeptionen der Situationsdefinition unterstellen häufig, dass Menschen zu hohen Intelligenzleistungen fähig sind. Dies schließt nicht aus, dass tatsächliche Situationsdefinitionen von schlichten, fast unbewussten bis hin zu hochkomplexen, analysierenden reichen.
Literatur
Esser, Hartmut, 2001: Soziologie. Spezielle Grundlagen, Bd. 6: Sinn und Kultur, Frankfurt a. M./New York. – Goffman, Erving, 1977: Rahmenanalyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen, Frankfurt a. M. – Thomas, William I.; Thomas, Dorothy S., 1928: The Child in America. Behaviour Problems and Programs, New York.
Stefan Hradil/Christian Steuerwald
Differenzierung
Differenzierung (engl. differentiation) ist das zentrale Konzept, um die Struktur sowie den Prozess der evolutionären Abfolge verschiedener Gesellschaften zu erfassen. Es hat eine lange Tradition und Kontinuität in der Geschichte der Soziologie.
Linien differenzierungstheoretischen Denkens
Drei Quellen und Linien differenzierungstheoretischen Denkens lassen sich identifizieren (Tyrell 2008: 107 ff.): a) Die biologienahe Tradition lässt sich von der Organismusanalogie inspirieren. Es wird von einem Ganzen ausgegangen, das sich aufgliedert und in der Teilung die Einheit wahrt; b) Eine zweite Variante stammt aus der Wirtschaftswissenschaft und arbeitet mit dem Begriff der Arbeitsteilung. Mit zunehmender Populationsdichte ergibt sich ein Zwang, ehemals fusionierte Tätigkeiten zu teilen, um dem Konkurrenzdruck durch Spezialisierung zu entgehen. Das Arbeitsteilungsparadigma bleibt sehr stark an die Rollenebene gebunden und erfasst weniger die Differenzierung auf weiteren Aggregatebenen von Ordnungen oder Systemen; c) Schließlich gibt es eine kulturwissenschaftliche Traditionslinie, in der die ideelle Differenzierung verschiedener Kultursphären im Mittelpunkt steht: Religion, Kunst, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft. Diese und andere Bereiche verdanken sich unterschiedlichen sinnspezifischen Orientierungen, die sich nicht mehr ohne Weiteres, wie in den beiden anderen sogenannten »Dekompositionsparadigmen«, miteinander vereinbaren lassen. Es geht hier nicht um die biologische oder ökonomische Teilung eines Ganzen, sondern die einzelnen Kultursphären und die ihnen korrespondierenden Gebilde und Strukturen beruhen auf ideellen Eigengesetzlichkeiten (Max Weber) oder Codes (Niklas Luhmann), die nicht mehr im Sinne der Teil-Ganzes-Vorstellung integrierbar sind.
Diese drei Quellen und Traditionslinien differenzierungstheoretischen Denkens, biologisch, ökonomisch und kulturwissenschaftlich, werden schwerpunktmäßig von unterschiedlichen Autoren entwickelt. Bei Herbert Spencer, Emile Durkheim und noch bei Georg Simmel dominiert die biologische Ganzheits- und die ökonomische Arbeitsteilungsvorstellung. Auch bei Talcott Parsons steht das Ganzes-Teil-Modell noch im Vordergrund, allerdings erweitert um eine ideelle Dimension. Niklas Luhmanns konsequent systemtheoretisch entwickeltes Differenzierungsverständnis betont vor allem die Sinn- oder Codedimension, die freilich bei ihm in einer gewissen Spannung zur nach wie vor vorhandenen dekompositionstheoretischen Denkfigur steht. Von Durkheim über Parsons bis hin zu Luhmann wird die Thematik mittels des methodologischen Kollektivismus entfaltet. Max Weber folgt dagegen dem methodologischen Individualismus. Gemäß seiner verstehenden Soziologie interessiert er sich dafür, wie aus der sinnhaften Orientierung der Akteure soziale Ordnungen entstehen, die einer je spezifischen kulturellen Eigendynamik folgen.
An diese Klassiker der Differenzierungstheorie wird auf verschiedene Weise in der neueren Diskussion angeknüpft. In den 1980er Jahren gab es in den USA den Versuch der sogenannten Neofunktionalisten um Jeffrey Alexander (Alexander/Colomy 1990), Parsons kritisch in Richtung einer handlungstheoretischen und historischen Soziologie weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz ist jedoch zum Erliegen gekommen und hat keine nachhaltige Theorieentwicklung angestoßen. In Deutschland ist dagegen die differenzierungstheoretische Diskussion bis heute virulent geblieben (Schwinn et al. 2011). Nicht Parsons, sondern Luhmann liefert hier die zentrale Bezugstheorie.[78] Eine Reihe seiner Schüler betreibt hierbei eine orthodoxe Interpretation, weniger die Weiterentwicklung seines Werkes. In Absetzung davon sind aus der Gründung des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung einige Versuche entstanden, das Luhmann’sche Differenzierungsverständnis handlungstheoretisch zu korrigieren und zu erweitern (Mayntz et al. 1988; Schimank 2007). In Anknüpfung an Max Weber werden schließlich Anstrengungen unternommen, das Differenzierungsthema handlungstheoretisch und historisch detaillierter zu entwickeln (Schwinn 2001).
Differenzierungsprozesse in modernen Gesellschaften
Das Differenzierungsmodell wird vor allem für die moderne Gesellschaft entwickelt. Als Prozesskonzept beansprucht es, auch alle vormodernen Strukturmuster und ihre evolutionäre Abfolge zu erfassen; dies geschieht aber mehr im Hinblick auf eine Rekonstruktion des historischen Ablaufs auf die moderne Struktur hin. Die evolutionären Vorläufer, etwa die segmentäre und stratifikatorische Differenzierung, dienen als historische Kontrastfolien. Entsprechend hat das Konzept in der Geschichtswissenschaft nur eine spärliche Rezeption gefunden. Differenzierung meint die Entflechtung traditioneller Strukturen, in denen heterogene Aufgaben fusioniert und zusammengebunden sind. Durkheim und Parsons verstehen diesen Vorgang als eine Arbeitsteilung, in der eine funktionale, diffuse Einheit in Teile dekomponiert und im Austausch zwischen ihnen integriert wird. Ist es bei Durkheim die voranschreitende Spezialisierung auf der Rollenebene von Berufen, so ist es bei Parsons die funktionale Differenzierung auf der Systemebene, die als zentral herausgestellt wird. Nach Parsons müssen vier funktionale Erfordernisse gesellschaftlicher Reproduktion erfüllt werden (AGIL-Schema), die im Laufe der sozialen Evolution hin zur modernen Struktur immer stärker entflochten werden. Funktionale Spezialisierung betont die Vorteile der Leistungssteigerung, die als ein wesentlicher Motor der Differenzierungsdynamik angenommen wird.
Dieses Dekompositions- und Arbeitsteilungsmodell, wie generell der Ausdruck »funktionale Differenzierung«, findet sich im Werk von Max Weber nicht. Hier läuft die Differenzierungsthematik unter dem Rationalitätsbegriff. Anders als bei Parsons, ist dies kein universeller evolutionärer Prozess, sondern charakteristisch für die Sondergestalt der okzidentalen Entwicklung, die durch eine spezifische Rationalisierung aller Lebensbereiche gekennzeichnet ist. Rationalisierung als Differenzierung bedeutet die Entwicklung von immer schärfer auseinandertretenden Sphären des Lebens, die von ihren eigenen Sinnund Sachlogiken geleitet werden. Dieser Prozess vollzieht sich auf den beiden Ebenen der Wert- und der Institutionendifferenzierung. Die verschiedenen institutionalisierten Sinn- und Leitkriterien stehen untereinander in spannungs- und konfliktreichen Beziehungen. Aus solchen Konfigurationen bestimmt sich die Dynamik einer Sozial- und Kulturordnung. Weber identifiziert die differenzierten Bereiche nicht über die Frage nach den Bestandsbedingungen sozialer Systeme, sondern durch seine historischen, insbesondere religionssoziologischen Untersuchungen stößt er auf unterschiedliche Möglichkeiten, dem Handeln einen differierenden Sinn zu geben und soziale Beziehungen und Ordnungen danach auszurichten.
Trotz der grundlagentheoretischen Differenz (Handlungs- versus Systemtheorie) weist Luhmann in Bezug auf verschiedene Aspekte eine größere Nähe zu Weber als zu seinem Vorgänger Parsons auf. Die Funktionen lassen sich nicht nach einem abstrakten Schema allgemein, sondern nur historisch bestimmen, und der Durchbruch zum modernen Ordnungsmuster vollzieht sich nicht nach einer evolutionären Zwangsläufigkeit, sondern ist historisch eher unwahrscheinlich und einmalig. Schließlich begreift Luhmann Differenzierung nicht nach dem Modell der Arbeitsteilung, sondern das Auseinandertreten von Sinnperspektiven ist primär. Während Parsons aus der privilegierten Stellung übergreifender Werte und aus dem einheitsverbürgenden AGIL-Schema jedem Teilsystem seinen angemessenen Platz im Ganzen anweisen konnte, ist es nach Luhmann nicht möglich, die funktional differenzierte Gesellschaft von einem privilegierten Wert oder einem Zentrum aus zu integrieren oder über ein theoretisch-allgemeines Schema notwendige Funktionen und ihre Beziehungen festzulegen. Die Differenzierungslogik wird hier auf die Spitze getrieben. Es dominiert ein Relativismus teilsystemspezifischer Perspektiven. Von der Wirtschaft aus stellt sich die Gesellschaft als kapitalistische dar und von der Politik aus als Demokratie, aus der Perspektive des Rechts als Rechtsstaat und aus der der Wissenschaft [79]als Wissensgesellschaft usw. Jede dieser Beschreibungen hat eine eingeschränkte Gültigkeit. In einer solchen polyperspektivischen und multizentrischen Gesellschaft erfolgen alle Aussagen und Operationen von einem bestimmten Systemgesichtspunkt aus, für den alles andere zur Umwelt gehört. Zweifel und Kritik werden geäußert, ob es angesichts des teilsystemischen Radikalismus noch sinnvoll ist, von einem Gesellschaftssystem zu sprechen.
Theoretische und thematische Bezüge
Die Differenzierungstheorie ist unverzichtbar für das Verständnis der historischen Entstehung und der Grundstruktur moderner Gesellschaften. Viele Aspekte, Probleme und Themen, die in der Soziologie bearbeitet werden, finden in ihr eine theoretische Klammer. So sind die speziellen Soziologien, wie z. B. die Wirtschafts-, Rechts-, Religions-, Familiensoziologie oder die Politische Soziologie, auf den allgemeinen Rahmen der Differenzierungstheorie angewiesen, der gleichsam ein soziales Koordinatensystem aufspannt, mittels dessen die Teilsoziologien verortet und Zusammenhänge hergestellt werden können. Ein Thema mit einer langen Tradition sind Individualisierungsprozesse. Mit der Differenzierung verschiedener Ordnungen oder Teilsysteme verändert sich das Person-Gesellschaftsverhältnis. Das moderne Ordnungsarrangement erzwingt vom Einzelnen eine gesteigerte Selbstthematisierung und Eigeninitiative, da es durch keinen sozialen Kontext mehr gänzlich umfasst und definiert wird. Und es ermöglicht ein individuell geführtes Leben, weil die nötigen Institutionen und die mit ihnen verbundenen Optionen und Leistungen zur Verfügung stehen. Die Kehrseite sind Entfremdung und Desintegration.
Neben vielen anderen Themen, wie Säkularisierung oder Organisationswachstum, hat die Differenzierungstheorie gerade in den letzten Jahrzehnten einen Einsatz als zeitdiagnostisches Instrumentarium gefunden. Der Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaften wurde mit ihrer mangelhaften Differenzierung erklärt. Die Überinstitutionalisierung der politischen Ordnung setzte der Freisetzung bereichsspezifischer, eigenständiger Rationalitäten enge Grenzen. In Konkurrenz mit dem westlichen Ordnungsmodell war der sozialistische Weg in die Moderne unterlegen, da wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wissenschaftliche Autonomie und politische Freiheiten mit dem Machtmonopol der Partei nicht vereinbar waren. Sind die kommunistischen Staaten an ihrer Überintegration gescheitert, so werden für den westlichen Typ zunehmend die Folgeprobleme der mit der Differenzierung verbundenen Unterintegration thematisiert. War noch in den 1960er und 1970er Jahren ein enormer Steuerungs- und Planungsoptimismus verbreitet, gewinnt in der Folgezeit bis heute die Einschätzung einer schwer kontrollierbaren, eigendynamischen Entwicklung des modernen differenzierten Ordnungsarrangements die Oberhand. Am prominentesten ist Ulrich Becks Diagnose einer »Risikogesellschaft«, die die ökologischen Probleme einer »organisierten Unverantwortlichkeit« zuschreibt. Moderne Gesellschaften sind auf eine Steigerung der Binnenrationalität der differenzierten Institutionen hin angelegt, nicht aber auf eine Rationalisierung und Integration des Zusammenspiels der Einzelrationalitäten. Die Forderung einer komplexen Modernisierung und reflexiven Rationalisierung sei nur mit einem neuen Differenzierungszuschnitt der verschiedenen institutionellen Kompetenzen verwirklichbar.
Ein weiteres Themenfeld, das sehr gut mit der Differenzierungstheorie erschließbar ist und einen theoretischen Zugang im Kontrast zu den vielen konzeptarmen Arbeiten ermöglicht, ist die Globalisierung. Seine historische Entstehung ist an spezifische Bedingungen gebunden, die Ausbreitung der differenzierten Ordnungsform verdankt sich dagegen einem universellen Potenzial. Die Sinn- und Sachlogiken der einzelnen Sphären und Teilsysteme machen an nationalstaatlichen Grenzen nicht Halt: Ökonomische Chancen werden überall gesucht, tendieren zu einem Weltmarkt hin; genauso ist wissenschaftliche Wahrheit eine universelle Errungenschaft. Offen bleibt, wie man das Fortbestehen und das Neuentstehen verschiedener regionaler und kulturspezifischer Ordnungsformen erklärt. Während weltgesellschaftliche Ansätze auf globaler Ebene nur ein Differenzierungsmuster am Werk sehen, verfolgt die Multiple-Modernities-Perspektive die Vielfalt differenzierter Ordnungsmuster.
Diese neueren Entwicklungen und Diskussionen haben theoretische und konzeptionelle Fragen aufgeworfen, auf die es bei den Klassikern keine Antworten gibt: Wenn das Differenzierungsprinzip alternativlos für moderne Gesellschaften ist, wie lässt sich seine ungebremste Eigendynamik steuern? Gibt es die Differenzierungsform moderner Gesellschaft[80] nur im Singular oder auch im Plural? Wie sind die beiden Strukturprinzipien der Differenzierung und der sozialen Ungleichheit ins Verhältnis zu setzen (Schwinn 2007)? Nach wie vor nicht geklärt ist, nach welchen Kriterien man einen ausdifferenzierten Bereich bestimmt, wie viele Bereiche es gibt und ob man zwischen primären und sekundären Bereichen unterscheiden muss.
Literatur
Alexander, Jeffrey C.; Colomy, Paul (eds.), 1990: Differentiation Theory and Social Chance, New York. – Durkheim, Emile, 1977: Über soziale Arbeitsteilung, Frankfurt a. M. (1893). – Luhmann, Niklas, 1997: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. – Mayntz, Renate et al., 1988: Differenzierung und Verselbständigung, Frankfurt a. M./New York. – Parsons, Talcott, 1971: Das System moderner Gesellschaften, München. – Schimank, Uwe, 2007: Theorien gesellschaftlicher Differenzierung, 3. Aufl., Wiesbaden. – Schwinn, Thomas, 2001: Differenzierung ohne Gesellschaft. Umstellung eines soziologischen Konzepts, Weilerswist. – Schwinn, Thomas, 2007: Soziale Ungleichheit, Bielefeld. – Schwinn, Thomas et al. (Hg.), 2011: Soziale Differenzierung. Handlungstheoretische Zugänge in der Diskussion, Wiesbaden. – Tyrell, Hartmann, 2008: Soziale und gesellschaftliche Differenzierung, Wiesbaden. – Weber, Max, 1978: Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung; in: Ders.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen (1920).
Thomas Schwinn
Diskriminierung
Diskriminierung (engl. discrimination) bedeutet die wahrgenommene ungerechtfertigte Schlechterbehandlung von Mitgliedern einer sozialen Gruppe oder einer sozialen Kategorie allein auf der Basis ihrer Gruppen- bzw. Kategoriemitgliedschaft (Mummendey/Otten 2001). Daher wird oft auch von sozialer Diskriminierung gesprochen, um den Aspekt der Gruppe oder Kategorie zu betonen und von individueller Schlechterbehandlung abzugrenzen, wie sie in frühen Definitionen beispielsweise von Allport (1954) noch vorkommt. Der Begriff Diskriminierung ist zunächst subjektiv und wird aus einer Opferperspektive definiert. Wahrnehmung von Diskriminierung muss zwischen Opfern, Tätern und nicht direkt betroffenen Gruppen ausgehandelt werden, da mitunter große Perspektivendivergenzen (d. h. unterschiedliche Ansichten über die Rechtmäßigkeit eines Verhaltens) zwischen den jeweiligen Positionen bestehen. Nach der Überwindung dieser Perspektivendivergenzen handelt es sich entweder um einen legitimen kategorialen Unterschied, d. h. um Differenzierung, oder um eine Form von übereinstimmend als negativ anerkannter Schlechterbehandlung. Diskriminierung muss von einer Reihe anderer verwandter Konzepte unterschieden werden (Jonas/ Beelmann 2009), z. B. Vorurteilen. Der Begriff weist aber andererseits auch Verbindungen zu thematisch bezogenen Konzepten auf, z. B. Toleranz als Gegenmaßnahme zu Diskriminierung, oder gesellschaftliche Diversität als Kontext von diskriminierendem Verhalten. Obwohl einerseits Menschen versuchen, bloß nicht als diskriminierend zu erscheinen, wie Forschungen aus den USA zeigen (Monin/ Miller 2001), nehmen Diskriminierungsphänomene in der Gesellschaft kaum spürbar ab. Diskriminierung wird zumindest in unserem Rechtssystem nunmehr auch höchstrichterlich sanktioniert (z. B. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland), aber auch diese Instrumente scheinen angesichts vielfältiger gegenteiliger Beispiele zunächst wirkungslos. Diskriminierung kann möglicherweise auch nicht vollständig vermieden werden, da der Diskriminierung basale Kategorisierungs- und Differenzierungsprozesse menschlicher Wahrnehmung zu Grunde liegen, die an sich wünschenswerte Funktionen besitzen. Ohne den Rückgriff auf bestehende Kategorien oder die Konstruktion neuer Kategorien, also der Differenzierung von Information, wäre eine Verarbeitung komplexer sozialer Kontexte kaum möglich.
Formen und Konsequenzen
Unter Schlechterbehandlung wird eine große Bandbreite von Verhaltensweisen verstanden, die von Ausgrenzung, über den Entzug von Ressourcen, bis hin zur Zufügung von psychischem oder physischem Schaden gehen können. Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die Opfer von Diskriminierung werden, mit einer Vielzahl von negativen Konsequenzen umgehen müssen. Diese gehen von Verlust von individuellen, Bildungs-, oder beruflichen Chancen bis hin zu schweren körperlichen Schäden, z. B. Depression oder Herz-Kreislaufkrankheiten (Hansen 2009).
[81]Normative Sanktionierung
Diskriminierung ist insbesondere von umgangssprachlichem Wortverständnis abzugrenzen. Unter Diskriminierung versteht man alltagssprachlich häufig einfach eine illegitime oder nicht begründete schlechte Einschätzung oder schlechte Behandlung von Menschen. Dabei wird im Unterschied zum wissenschaftlichen Terminus die erwähnte Perspektivendivergenz vernachlässigt. Diese relationale Definition von Diskriminierung bedeutet jedoch nicht, dass Diskriminierung nicht auch durch normative Grundlagen bestimmt sein kann. Der Übergang von einer relationalen Definition von Diskriminierung zu einem »objektiven« Konsens der Mehrheitsgesellschaft ist ein Prozess der zunehmenden Akzeptanz von illegitimen sozialen Relationen als Diskriminierung. In der Gegenrichtung ist auch ein Wechsel von einer normativen hin zu einer relationalen Definition denkbar. Gerade abstrakte normative Definitionen von Diskriminierung verlieren schnell ihren Konsens-Charakter, wenn es um die konkrete Ausgestaltung geht. In der Folge sind dann wieder konkrete relationale Aushandlungen darüber, was Diskriminierung darstellt und was nicht, notwendig.
Zeitliche Dimension
Ein wichtiger Aspekt in der Auseinandersetzung mit der relationalen Definition von Diskriminierung ist die zeitliche Dimension. Individuelle Opfer können sich unrechtmäßig zu Diskriminierungsopfern machen und damit illegitim den Begriff ausnützen. Die für Diskriminierung notwendige Schlechterbehandlung muss aufgrund der Gruppenmitgliedschaft ex ante geschehen sein. Häufig wird jedoch eine Gruppe der Opfer ex post konstruiert, um der individuellen Position mehr Gewicht zu verleihen und zu einer Legitimitätsgrundlage zu verhelfen. Dem gegenübergestellt ist es jedoch auch denkbar, dass mehrere Individuen das gemeinsame Merkmal (der Gruppe oder Kategorie) als den Grund für ihre illegitime Schlechterbehandlung erst im Nachhinein erkennen. Individuelle Opfer können so gruppenbasierte Schlechterbehandlung erst ex post identifizieren. Beispiele hierfür sind Schlechterbehandlungen auf der Basis von nicht sichtbaren Merkmalen, z. B. Krankheiten, über die man sich auch nicht offen austauscht. In diesem Falle greift aber die relationale Definition von Diskriminierung wieder, die individuellen Opfer konstituieren tatsächlich eine soziale Gruppe oder Kategorie, auf deren Basis die Schlechterbehandlung stattfindet. In so einem Fall ist auch ein Konflikt mit der Täter- oder Mehrheitsposition zu erwarten, die diese Auffassung zunächst nicht teilen mögen wird.
Literatur
Allport, Gordon W., 1954: The nature of prejudice, Reading, MA. – Hansen, Nina, 2009: Die Verarbeitung von Diskriminierung; in: Beelmann, Andreas; Jonas, Kai J. (Hg.): Diskriminierung und Toleranz, Wiesbaden, 155–170. – Jonas, Kai J.; Beelmann, Andreas, 2009: Begriffe und Anwendungsperspektiven; in: Beelmann, Andreas; Jonas, Kai J. (Hg.): Diskriminierung und Toleranz, Wiesbaden, 19–42. – Monin, Benoît; Miller, Dale T., 2001: Moral credentials and the expression of prejudice; in: Journal of Personality and Social Psychology 81, 33–43. – Mummendey, Amélie; Otten, Sabine, 2001: Aversive Discrimination; in: Brown, Rupert; Gaertner, Samuel L. (Eds.): Blackwell handbook of social psychology. Intergroup processes, Malden, MA, 112–132.
Kai J. Jonas
Dunkelziffer
Die Dunkelziffer (richtig eigentlich Dunkelzahl, engl. dark number, auch undetected/unreported cases, dark figure) ist traditionell in der Kriminalsoziologie die Anzahl der von der amtlichen Statistik nicht erfassten Straftaten. Systematisch muss man in der Statistik darunter aber jede Differenz zwischen den wirklich stattgefundenen Ereignissen und den in einer i. d. R. amtlichen Statistik erfassten verstehen. Deshalb gibt es Dunkelziffern auch z. B. in der Gesundheits- (etwa Seuchen), Außenhandels-(wirklicher gegenüber von den Firmen nach Steuerüberlegungen gemeldetem Wert von Exporten), Arbeitslosen-, Einkommens- und sonstigen Statistik.
Für den Forscher beginnt die Dunkelfeldproblematik schon, wenn er für eine Untersuchung eine Stichprobe ziehen will. Nimmt er als Grundgesamtheit die statistische Angabe, kann die Dunkelziffer nicht nur bewirken, dass die Stichprobe zu klein wird; wenn das Dunkelfeld nicht dieselbe Struktur hat wie die Gesamtheit (sondern z. B. überwiegend schwerere Fälle erfasst), kann die Stichprobe sogar inhaltlich falsch sein. Dann kommt es nicht nur zu[82] falschen Wirklichkeitsbeschreibungen, sondern auch zu unbrauchbaren Praxisempfehlungen.
Die erste Frage ist bei der Dunkelfeldproblematik stets: Wie verlässlich ist die vorliegende Statistik? Eine Faustregel sagt: Je mehr eine Statistikstelle selber Daten unmittelbar erhebt, desto geringer ist die Dunkelziffer; die Dunkelziffer ist desto größer, je mehr negative Folgen mit der Datenangabe verbunden sein können (z. B. Besteuerung bei Einkommensangabe, Quarantäne bei Seuchenmeldung) und desto kleiner, je mehr positive Folgen damit verbunden sind (z. B. mehr Planstellen bei hoher Kriminalitätsbelastung in einem Polizeibezirk oder Arbeitslosengeld bei Arbeitslosmeldung trotz Einkommens aus Schwarzarbeit; hier kann es sogar zu einer »negativen Dunkelziffer« kommen, wenn die Statistik mehr Fälle meldet, als in der Wirklichkeit vorhanden sind). Intersystemische Statistikvergleiche sind wissenschaftlich nur brauchbar, wenn sie ganz genau das Erhebungsverfahren angeben.
Zur Erforschung der Dunkelziffer bedient man sich meistens der Befragung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe, deren Ergebnisse auf die Population des Erhebungsgebiets hochgerechnet und mit den Statistikdaten (desselben Gebiets und Zeitraums) verglichen werden.
Literatur
Leder, Hans-Claus, 1998: Dunkelfeld, Frankfurt a. M. – Schwind, Hans-Dieter, 2009: Kriminologie, 19. Aufl., Heidelberg.
Günter Endruweit