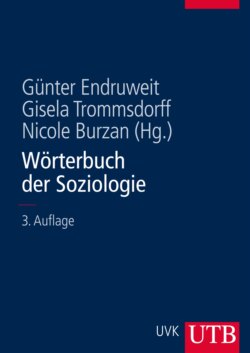Читать книгу Wörterbuch der Soziologie - Группа авторов - Страница 8
Оглавление[45]B
Bedürfnis
Ein Bedürfnis (engl. need) ist zunächst das Gefühl eines Menschen, einen Mangel zu haben, und der Wunsch, diesen Mangel zu beheben. Das ist ein psychologischer Bedürfnisbegriff. Zum soziologischen wird er, wenn der Mangel von den Menschen in einer sozialen Gruppierung, z. B. einer Schicht oder einer Berufs- oder Altersgruppe, empfunden wird und die Behebung auf gesellschaftliche Weise stattfinden soll oder muss, z. B. durch Gesetzgebung oder Subvention. Ein soziologischer Bedürfnisbegriff könnte also lauten: Ein Bedürfnis ist ein sozialer Katalysator, bei dem die Menschen in einer sozialen Gruppierung einen Mangel empfinden und den Wunsch haben, den Mangel auf gesellschaftliche Weise zu beheben. Daneben gibt es noch andere Bedürfnisbegriffe, z. B. wirtschaftswissenschaftliche oder medizinische.
Als sozialer Katalysator steuern Bedürfnisse das Handeln des Menschen. Beispielsweise wird ein Machthungriger für eine Wahl in eine Machtposition kandidieren, oder eine freiheitliche soziale Bewegung wird den Aufstand gegen einen Diktator wagen. Eine frühe, in der Forschung oft benutzte Theorie, die Theorie der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow, teilt die Bedürfnisse in fünf Gruppen ein: 1) physiologische Bedürfnisse (Unterkunft, Schlaf, Nahrung), 2) Sicherheit (Ordnung des täglichen Lebens), 3) Zugehörigkeit zu anderen Menschen, 4) Selbstachtung und soziale Anerkennung, 5) Selbstverwirklichung (die Reihe wurde 1970 noch erweitert; in den Sozialwissenschaften wurde bisher aber meistens das ursprüngliche Fünferschema verwendet). Diese Theorie nimmt an, dass jedes Bedürfnis erst dann auftauche bzw. verwirklicht werde, wenn die jeweils vorherigen im Wesentlichen erfüllt sind. Empirisch ist diese Theorie manchmal bestätigt worden, manchmal nicht. Gleiches zeigten Untersuchungen zur Theorie von Ronald lnglehart, dass jedenfalls in entwickelten lndustriegesellschaften die zuvor herrschenden materiellen Bedürfnisse zunehmend von Immateriellen abgelöst würden. Eine andere Unterscheidung trennt primäre (naturgegebene, z. B. Triebe, lnstinkte) von sekundären (gelernten) Bedürfnissen. Das führt zu der Frage, ob Bedürfnisse auch,, geweckt« werden können, etwa durch Werbung oder soziale Vorbilder. Beispiele (etwa Hula-Hoop oder Tamagotchi) zeigen bisher, dass das nur vorübergehend möglich ist. Anders ist es bei neuen Mitteln zur Befriedigung eines alten Bedürfnisses (z. B. neue Kommunikationsmittel). Politisch-praktisch wirksam wurde der Begriff der Grundbedürfnisse in der 2. Hälfte des 19. Jhs. Formuliert wurde er 1976 vom lnternationalen Arbeitsamt (ILO) in Genf. Dabei wurden private Konsumbedürfnisse (Unterkunft, Nahrung, Kleidung usw.) von sozialer lnfrastruktur (sauberes Trinkwasser, Abwasser- und Müllentsorgung, Gesundheitsdienst, öff. Verkehrsmittel, Ausbildung) unterschieden. Dieses Konzept sollte die Primärziele für nationale und internationale Entwicklungsmaßnahmen bestimmen helfen. Als empirisch gesichert kann gelten, dass die Bedürfnisse sich nach Zahl und Rang von einer Kultur zur anderen unterscheiden, dass aber auch innerhalb einer Kultur sich Subkulturen in ihren Bedürfnissen unterscheiden (z. B. zwischen Künstlern und lnvestmentbankern oder zwischen Jugendlichen und Rentnern). Damit sind Bedürfnisse großenteils die dynamische Seite der Wertordnung.
Literatur
Hondrich, Karl Otto; Vollmer, Randolph (Hg), 1983: Bedürfnisse im Wandel, Wiesbaden. – lnglehart, Ronald F., 1977: The Silent Revolution, Princeton (dt. 1982). – Maslow, Abraham H., 1954: Motivation and Personality, New York (dt. 1977/1981). – UNESCO, 1978: Study in Depth on the Concept of Basic Human Needs in Relation to Various Ways of Life and its Possible lmplications for the Action of the Organization, Paris.
Günter Endruweit
Befragung
Die Befragung (engl. interview) ist ein Datenerhebungsinstrument der empirischen Forschung neben der Beobachtung und der Inhaltsanalyse. Sie wird in der quantitativen Forschung in (teil-)standardisierter Form, in der qualitativen Forschung in nicht standardisierter Form angewandt.
[46]Standardisierte Befragungen in der quantitativen Forschung
In der quantitativen Forschung galt die Befragung lange als Königsweg der Datenbeschaffung und wird nach wie vor am häufigsten verwendet. Insbesondere bei der Untersuchung von Einstellungen ist sie oft das Instrument der Wahl. Große Längsschnittbefragungen in Deutschland, die mehrere Themen abdecken, sind z. B. der Mikrozensus, die Allgemeine Bevölkerungsumfrage (ALLBUS) und das Sozioökonomische Panel (SOEP). Meist handelt es sich um Einzel-(nicht Gruppen-)Befragungen möglichst vieler Personen. Standardisierung bedeutet, dass der Wortlaut der Fragen und der Antwortmöglichkeiten sowie die Reihenfolge feststehen (die zutreffende Antwort wird angekreuzt). Dies fördert die Vergleichbarkeit der Daten und mindert zudem den Aufwand für die Befragten und für den auswertenden Forscher.
Formen der standardisierten Befragung
ppersönlich-mündlich
ttelefonisch
sschriftlich (Papierform/Online)
Befragungen können persönlich-mündlich, telefonisch oder schriftlich (in Papierform oder als Online-Befragung) durchgeführt werden; oft erfolgt die Befragung dabei computerunterstützt (z. B. werden die Antworten direkt in den Computer eingegeben, was späteren Übertragungsfehlern vorbeugt und die Filterführung vereinfacht). Jede Form hat Vor- und Nachteile, der Forscher entscheidet je nach Fragestellung und Praktikabilität.
So ist bei der persönlich-mündlichen Befragung die Ausschöpfung relativ groß, bei hoher Situationskontrolle sind auch längere Interviews möglich. Dem stehen eine mögliche Verzerrung durch den Interviewereinfluss (ggf. antwortet die ältere Frau einer anderen älteren Frau anders als einem jungen Mann) sowie ein vergleichsweise hoher Kosten- und Zeitaufwand gegenüber.
Bei der schriftlichen Befragung entfällt der Interviewereinfluss, der Anonymitätsgrad steigt, die Kosten sind geringer. Jedoch fehlt auch die Situationskontrolle (z. B. Kontrolle der Anwesenheit anderer und der Ernsthaftigkeit der Antworten), und die Fragebögen müssen in noch höherem Maße selbsterklärend sein. Das größte Problem der schriftlichen Befragung ist die geringe Ausschöpfung (insbesondere in Papierform), selbst nach Erinnerungsschreiben. In der Online-Variante, in der die Befragten nicht persönlich angeschrieben werden, sondern einem Link zum Fragebogen auf einer Internetseite folgen, ist oft unklar, von welcher Grundgesamtheit der Forscher ausgehen kann, so dass die Repräsentativität der Befunde in Frage steht.
Die Beurteilung der telefonischen Befragung liegt zum Teil in der Mitte, z. B. Aufwand und Kosten, die Ausschöpfung oder auch den Interviewereinfluss betreffend (der Befragte hört, aber sieht den Interviewer nicht). Zu beachten ist, dass visuelle Unterstützungen hier nicht ohne weiteres einsetzbar sind, z. B. Karten bei langen Listen von Antwortmöglichkeiten. Der Anteil der telefonischen sowie der Online-Befragungen hat im Zeitverlauf zugenommen, die Sozialforschung konkurriert hier mit der Marktforschung um Zielgruppen.
Verzerrungsgefahren
Verzerrungsquellen in der standardisierten Befragung:
Befragungssituation
Befragtenmerkmale
Fragebogen: Formulierungen, Reihenfolge, Ge staltung
Neben Verzerrungsgefahren (die die Gütekriterien Zuverlässigkeit und Gültigkeit beeinträchtigen), die von der Befragungssituation ausgehen, gibt es auch solche, die sich entweder auf Merkmale des Befragten oder auf den Fragebogen beziehen. Zu den Befragtenmerkmalen, die die »richtige« Antwort gefährden, gehören etwa die Tendenz zu sozialer Erwünschtheit (man neigt z. B. dazu, eher zu wenig als zu viel Zeit für Fernsehen anzugeben) oder zu Response-Sets, also Antworttendenzen, die unabhängig vom Inhalt der Frage sind (z. B. in Einstellungsskalen keine Extremkategorien ankreuzen).
Solche Reaktionen sind eng verknüpft mit den Formulierungen und ihrer Reihenfolge im Fragebogen sowie ggf. dessen visueller Gestaltung. Ziel ist, dass die Fragen und Antwortmöglichkeiten von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden. Es ist z. B. zu beachten, dass die Formulierungen einfach und eindeutig sein sollten (was in der Umsetzung nicht so banal ist, wie es sich anhört), dass sie Unterstellungen und soziale Erwünschtheit vermeiden [47](z. B. wäre die Formulierung: »Glauben Sie noch an …« zu vermeiden). Reihenfolgeeffekte sind in Tests nachgewiesen worden sowohl für einzelne Fragen (und Antwortkategorien) als auch für die gesamte Anlage des Fragebogens (sind die Eingangsfragen z. B. interessant und leicht zu beantworten?).
Richtet sich die Befragung an eine bestimmte Zielgruppe, sind zudem deren Spezifika zu berücksichtigen, wenn z. B. Kinder, Menschen mittleren Alters oder Ältere befragt werden. Besondere Anforderungen stellen Längsschnittuntersuchungen (haben z. B. Fragen nach dem Geschmack nach zehn Jahren noch die gleiche Bedeutung?) und internationale Vergleichsstudien (die sorgfältige Übersetzungen erfordern). Ein Pretest mit wenigen Befragten kann Verzerrungen durch den Fragebogen teilweise erkennen, ein »perfekter« Fragebogen ist jedoch kaum realistisch. Die Methodenforschung untersucht kontinuierlich Verzerrungsgefahren und Möglichkeiten ihrer Vermeidung.
Schließlich ist darauf aufmerksam zu machen, dass eine Untersuchung nicht mit der Fragebogenerstellung beginnen darf. Ein systematischer Bezug zu Hypothesen und ihrer Operationalisierung ist notwendig, um die Forschungsfrage nicht aus dem Auge zu verlieren und um in der Auswertungsphase keinen statistischen Datenfriedhof zu erzeugen.
Nicht standardisierte Befragungen in der qualitativen Forschung
Für Befragungen in der qualitativen Forschung hat sich die englische Bezeichnung Interviews durchgesetzt. Qualitative Interviews werden zumeist einmalig, mit einem Interviewpartner und face-to-face durchgeführt, d. h. Interviewer/in und Befragte/r begegnen sich persönlich und führen ein Gespräch. Davon wird eine Tonaufnahme, manchmal auch eine Bild- und Tonaufnahme angefertigt, die wortgetreu, teilweise auch parasprachliche Äußerungen berücksichtigend, verschriftet und dann ausgewertet wird. Die Dauer von Interviews variiert stark, vor allem wegen der unterschiedlichen Erzählbereitschaft von Befragten; 60 bis 90 Minuten sind eine gängige Länge.
Als Erhebungsinstrument ist das qualitative Interview – im Gegensatz zur quantitativen Befragung – alltäglichen Gesprächssituationen nachmodelliert und macht sich deren grundlegende Eigenschaften, wie z. B. die Orientierung am Kenntnisstand und am Informationsinteresse des Gegenübers, zunutze. Der/die Befragte kann in qualitativen Interviews auf die offen gestellten Fragen frei formulierend und ausführlich antworten, kann Themen nach eigenem Ermessen ansteuern und verknüpfen, kann auch Fragen an die Interviewerin richten und über die gestellten Fragen selbst sprechen. Das Gesprächsverhalten des Interviewers hingegen ist im Gegensatz zu alltäglichen Gesprächen sehr auf das möglichst offene, möglichst wenig steuernde Fragenstellen hin vereinseitigt, um die Einflussnahme auf die Darstellung des Befragten zu minimieren.
Diese Erhebungsform setzt zwei zentrale Anforderungen einer qualitativen Sozialforschung um: »Offenheit« – was bedeutet, dass zuerst die Bedeutungsstrukturierung des Befragten möglichst vollständig erhoben und rekonstruiert wird, bevor dann eine theoretische Strukturierung in wissenschaftlicher Perspektive erfolgt – und »Kommunikation« – was bedeutet, dass zur Erhebung von bedeutungsstrukturierten Daten eine Kommunikationsbeziehung eingegangen werden muss, die den Kommunikationsregeln des Interviewpartners und nicht denen der wissenschaftlichen Forschung folgt (Hoffmann-Riem 1980, 343 f. und 346 f.).
Formen qualitativer Interviews
Die meistverwendeten Formen qualitativer Interviews:
Leitfadeninterview bzw. leitfadengestütztes Inter view
Narratives Interview
Experteninterview
Die verschiedenen Formen qualitativer Interviews können nach der Interviewführung, nach ihrem Gegenstand und teilweise auch nach bestimmten, dem Befragten zugeschriebenen Merkmalen unterschieden werden: Beim Leitfadeninterview handelt es sich um eine Interviewführung, die tendenziell stärker durch den Interviewer strukturiert wird. Er agiert anhand eines vorab entworfenen Fragenleitfadens, soll sich dabei allerdings an den Themensetzungen und -verknüpfungen des Befragten orientieren und den Leitfaden flexibel einsetzen. Inhalt sind hierbei sowohl Fragen nach Handlungen und Erleben als auch zu Einstellungen und Deutungen. Zu beachten ist, dass die Forschungsfragen nicht umstandslos [48]in Leitfadenfragen umgesetzt werden können und dass die Fragen in alltagssprachlichen und nicht in wissenschaftlichen Begriffen formuliert sein müssen (also nicht: »Wann fällt Ihnen Ihr Doing Gender auf?« »In welchen Situationen ist Ihnen Ihr Habitus hinderlich?« »Welche Rolle spielt Bildungspanik bei Ihren Entscheidungen?«).
Das narrative Interview ist eine Interviewform, in der die Befragte auf eine initiale Frage ohne Unterbrechungen antworten und das von ihr Erlebte vollständig ausformulieren kann. Gegenstand ist ein vergangener oder bis heute andauernder Handlungsprozess, an dem die Befragte selbst beteiligt war; am häufigsten werden narrative Interviews zur Erhebung von Biographien eingesetzt.
Bei Experteninterviews handelt es sich zumeist um Leitfadeninterviews, bei denen dem Befragten ein besonderer Status zugeschrieben wird, nämlich Träger von »Expertenwissen« zu sein. Darunter wird meist Wissen über institutionalisierte Interaktionsbeziehungen oder über dritte Akteure verstanden (z. B. Richter, die über die Interaktion zwischen Strafverteidigern und Staatsanwälten und deren Einflüsse auf die Urteilsfindung befragt werden).
Auswertung qualitativer Interviews
Die so erhobenen Daten zeichnen sich durch eine geringe formale Vergleichbarkeit aus; dies erfordert eine kaum standardisierbare Auswertung der einzelnen Interviews. Die Auswertung beginnt mit einer Analyse des Interaktionsgeschehens, insbesondere beim Interviewbeginn, mit besonderem Augenmerk auf die Selbstdarstellung des Befragten. Nach einer Sequenzierung in Sinneinheiten bzw. einem Nachzeichnen des thematischen Verlaufs bei Leitfadeninterviews bewegt sich die Analyse am Textverlauf entlang. Es werden hierbei nicht allein die oberflächlichen Aussagen extrahiert (»hat sich für Karriere entschieden«, »ist mobil«, »hat aus Liebe geheiratet«), sondern anhand einer Analyse der formalen, sprachlichen und thematischen Besonderheiten werden die prägenden Deutungs- und Wahrnehmungsstrukturen und Handlungsverläufe des erhobenen Falls rekonstruiert; gerade auch im Widerspruch zur Selbstpräsentation. Wie bei quantitativen Befragungen gibt es auch in qualitativen Interviews Antworttendenzen, die sich an der sozialen Erwünschtheit orientieren; im Gegensatz zur quantitativen Erhebung erhält man jedoch in einem gelungenen qualitativen Interview ausreichend viele Kontextinformationen, um widersprüchliche Aussagen und die Handlungswirksamkeit von postulierten Einstellungen erkennen zu können. Dies verweist aber darauf, dass ein Interview vollständig, also als Fall, interpretiert werden muss. Das – bisweilen praktizierte – Herauspicken von einzelnen Passagen reicht von der Auswertungstiefe her nicht aus. Für das narrative Interview wurden unterschiedliche narrationsanalytische Auswertungsverfahren entwickelt. Grundsätzlich finden bei der Interviewanalyse die eingeführten qualitativen Auswertungsverfahren wie z. B. die Objektive Hermeneutik oder die Dokumentarische Methode der Interpretation Anwendung.
Literatur
Zur standardisierten Befragung: Diekmann, Andreas, 2007: Empirische Sozialforschung, 4. Aufl., Reinbek. – Beiträge in der Zeitschrift »Methoden-Daten-Analysen. Zeitschrift für empirische Sozialforschung«, ab 2007 (s. a. die Publikationen unter www.gesis.org).
Zu qualitativen Interviews: Bogner, Alexander et al. (Hg.), 2009: Experteninterviews, 3. Aufl., Wiesbaden – Hoffmann-Riem, Christa, 1980: Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie – der Datengewinn; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 32, 339–372. – Küsters, Ivonne, 2009: Narrative Interviews, 2. Aufl., Wiesbaden. – Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika, 2009: Qualitative Sozialforschung, 2. Aufl., München, 91–159.
Nicole Burzan/Ivonne Küsters
Beobachtung
Die Beobachtung (engl. observation) ist Grundlage empirischer Forschung, da wissenschaftliche Erkenntnisprozesse allgemein auf sinnlichen Erfahrungen der Wahrnehmung und Beobachtung beruhen (Bortz/Döring, Kap. 4). Im engeren Sinne ist die Beobachtung eine empirische Methode der Untersuchung von Verhalten in den Human- und Sozialwissenschaften. Im Vergleich zu sprachbasierten Verfahren (z. B. Befragung) wird bei Methoden der Beobachtung eher der Anspruch betont, dass sie einen unmittelbaren, weitgehend unverfälschten Zugang zu menschlichem Verhalten liefern. In der experimentell orientierten Psychologie liegt dabei ein Schwerpunkt auf der Beobachtung unter standardisierten Bedingungen, um eine größtmögliche Kontrolle [49]von Störvariablen zu gewährleisten. Da aus soziologischer Perspektive die Beobachtung eine geeignete methodische Zugangsweise zur Prüfung theoretischer Fragen hinsichtlich der Herstellung sozialer Wirklichkeit in alltäglichen Interaktionen ist, steht die Beobachtung in natürlichen Verhaltenskontexten im Mittelpunkt (z. B. teilnehmende Beobachtung). Zur ergänzenden Dokumentation werden hierzu auch visuelle Medien (Foto, Video) herangezogen, die z. B. mittels Bildanalyse untersucht werden (Flick, Kap. 17–21). Beobachtung ist ein Sammelbegriff für eine Reihe teilweise sehr unterschiedlicher Datenerhebungstechniken (z. B. Beobachtung sprachlichen und nicht-sprachlichen Verhaltens, Beobachtung kultureller Zeichen wie Kleidung). Davon abhängig variieren das methodische Vorgehen und damit einhergehende Probleme der Reaktivität (vgl. nicht-reaktive Verfahren).
Formen der Verhaltensbeobachtung
In Abgrenzung zur Alltagsbeobachtung bezieht sich systematische Beobachtung auf spezifische Fragestellungen und erfolgt daher zielgerichtet und geplant. Dies beinhaltet eine systematische Aufzeichnung der Daten sowie die Sicherstellung von Reliabilität und Validität (Hoyle et al.). Ferner wird eine Differenzierung zwischen systematischer und freier Beobachtung, die nicht hypothesengeleitet erfolgt, vorgenommen (Greve/Wentura). Der Beobachtung durch trainierte externe Beobachter (Fremdbeobachtung) steht die systematische Beobachtung und Protokollierung des eigenen Verhaltens gegenüber (Selbstbeobachtung), die z. B. in der psychologischen Diagnostik Anwendung findet (z. B. Tagebuchmethode) (Bodemann).
Methoden der Beobachtung lassen sich hinsichtlich ihres Standardisierungsgrades einteilen. Die Kontrolle über die Durchführungsbedingungen ist hoch in künstlich erzeugten Situationen, in der durch Stimuli gezielt ein bestimmtes Verhalten evoziert wird (z. B. emotionale Reaktion auf Musik). Je nachdem, ob Beobachtung im natürlichen Verhaltenskontext erfolgt oder in einem Labor, ist der Ort der Beobachtung ein weiteres Unterscheidungskriterium (Feld-/natürliche vs. Laborbeobachtung). Ebenso ist zu berücksichtigen, inwieweit die untersuchten Personen wissen, dass sie Gegenstand wissenschaftlicher Beobachtung sind oder der Beobachter verdeckt agiert (offene vs. verdeckte Beobachtung). Bei der teilnehmenden Beobachtung ist der Beobachter in der Situation selbst anwesend, um eine bestimmte Rolle im sozialen Geschehen zu übernehmen oder gezielt mit den untersuchten Personen zu interagieren. Bei der nicht teilnehmenden Beobachtung hingegen ist der Beobachter nicht präsent (teilnehmende vs. nicht teilnehmende Beobachtung).
Die Auswertung des beobachteten Verhaltens kann unmittelbar oder technisch vermittelt erfolgen. Die Auswertung aufgezeichneter Beobachtungsdaten (z. B. Ton-/Videoaufnahmen, Transkripte) bietet Vorteile gegenüber einer unmittelbaren Kodierung in der aktuellen Situation. Aufzeichnungen erlauben die wiederholte Betrachtung der Beobachtungsepisoden und tragen zur Reduzierung von Beobachtungsfehlern bei. Verschiedene Verhaltensaspekte können getrennt und nacheinander ausgewertet werden. Dies erlaubt zu prüfen, wie hoch die Beurteilerübereinstimmung ist. Digitale Videoaufnahmen erleichtern heute übliche computergestützte Auswertungen mit Programmen, die komplexe Auswertungsprozeduren (z. B. Sequenzanalyse) vereinfachen (Bakeman/Quera). Bei allen Auswertungsmethoden erfolgt eine Informationsreduktion. Diese Reduktion hängt davon ab, welche Aspekte des Verhaltens im Zeitverlauf erfasst werden sollen (z. B. sprachliches oder nicht sprachliches Verhalten) (Greve/Wentura).
Beobachtungs- und Beschreibungssysteme
Grundlage einer systematischen Beobachtung ist die Festlegung für die Fragestellung relevanter Beobachtungseinheiten. »Als Beobachtungseinheit wird derjenige Bestandteil in einem Verhaltensablauf bezeichnet, der dem Untersucher als kleinstes, nicht reduzierbares Ereignis zur Analyse des Verhaltens notwendig erscheint« (Cranach/Frenz: 286). Je nach theoretischem Interesse unterscheiden sich die gewählten Beobachtungseinheiten. In der Soziologie und Sozialpsychologie ist die Untersuchung von sozialen Interaktionen von Interesse (z. B. Kooperation in Gruppen), die Persönlichkeitspsychologie interessiert sich für individuelle Unterschiede in Verhaltensmustern (z. B. Wirkung von Stress auf Essverhalten), während in der Entwicklungspsychologie Veränderung und Stabilität von Verhalten im Mittelpunkt stehen (z. B. in Eltern-Kind-Interaktionen). Beobachtungseinheiten können qualitativer und quantitativer [50]Natur sein und hinsichtlich der zeitlichen Auflösung variieren. In Studien zur emotionalen Entwicklung wurde festgestellt, dass kulturelle Unterschiede bestehen, wie Mütter auf negative Emotionen ihrer Kinder reagieren (d. h. Sensitivität; Trommsdorff). Emotionen lassen sich hinsichtlich qualitativer (z. B. positiv, negativ) und quantitativer Merkmale (z. B. Intensität, Häufigkeit, Dauer) unterscheiden. Ebenso kann Sensitivität als eine qualitativ variierende Einheit (d. h. Formen der Sensitivität unterscheiden sich zwischen Kulturen) verstanden werden, deren Ausprägungen sich auf individueller Ebene einschätzen lässt. Bezieht sich die Erfassung von Sensitivität auf eine Interaktionssequenz mit einer Dauer von mehreren Minuten, lassen sich Verhaltensmerkmale auf der Mikroebene heranziehen (z. B. Position der Augenbrauen, Mundwinkel), um die Intensität des emotionalen Ausdrucks zu beurteilen (mikro- vs. makroanalytische Beobachtung). Beobachtungseinheiten variieren, je nachdem, ob sie natürliche Verhaltenseinheiten (z. B. weinen) oder komplexe soziale Handlungen (z. B. Aufmerksamkeit suchen) abbilden (Bakeman/Quera).
Bei der Verhaltensbeobachtung nimmt ein Beobachter stets Zuschreibungen vor und erschließt Beobachtungseinheiten aufgrund des wahrgenommen Verhaltens (Cranach/Frenz). Bei der Beobachtung von Begrüßungsritualen werden Beobachter mit hoher Übereinstimmung, zumindest in einer bestimmten Kultur, Förmlichkeit und Höflichkeit beurteilen können. Kann eine hohe intersubjektive Übereinstimmung nicht gelingen (z. B. Kulturvergleich), ist es unerlässlich, direkt wahrnehmbare Beobachtungseinheiten (z. B. Körperkontakt) zu wählen.
Beobachtungen werden in Form von Beschreibungssystemen festgehalten. Aufzeichnungen in schriftlicher Form, die sich der Alltagssprache bedienen, umfassen Selbst- und Fremdbeobachtung (z. B. Tagebuch) oder Verlaufsprotokolle. Dies sind unsystematische Ereignisprotokolle, die einer weiteren inhaltsanalytischen Auswertung bedürfen. Index-Systeme beinhalten eine Aufzeichnung von Verhaltensmerkmalen, z. B. ethologische Verhaltensprotokolle, in denen bestimmte in einer Situation auftretende Verhaltensweisen oder Merkmale, die einen übergeordneten Aspekt (z. B. Verhaltensmuster) repräsentieren, registriert werden (Faßnacht). Ziel eines Kategoriensystems ist es, das beobachtete Verhalten möglichst erschöpfend zu beschreiben und anhand definierter Kategorien zu klassifizieren. Ein Kategoriensystem bestimmt Struktur und Regeln, die für eine systematische Zuordnung der beobachteten Verhaltenseinheiten zu einzelnen Kategorien erforderlich sind. Einzelkategorien müssen inhaltlich und definitorisch voneinander abgrenzbar sein, um eine eindeutige, exklusive Zuordnung der untersuchten Beobachtungseinheiten zu den Kategorien zu gewährleisten. Die Erstellung eines Kategoriensystems ist somit eine Voraussetzung für die spätere Übersetzung beobachteter Verhaltenseinheiten in numerische Variablen zwecks statistischer Datenverarbeitung. Mit diesem Schritt kann Beobachtung als eine Form der Messung im wissenschaftlichen Sinne verstanden werden (Greve/Wentura).
Eine Alternative zu nominalen Klassifikationssystemen stellen dimensionale Systeme dar, bei denen Ratingskalen zur Anwendung kommen. Die Verwendung von Ratingskalen anstelle kategorialer Maße kann die Erfassung sozial komplexer Verhaltensweisen erleichtern und Informationen liefern, die bei der Verwendung rein verhaltensbasierter Kategorien verborgen bleiben. Ein kulturinformierter Beobachter, der auf einer Skala die Qualität einer Mutter-Kinder-Interaktion beurteilt, berücksichtigt möglicherweise kulturelle Besonderheiten, die durch eine Erfassung von Häufigkeit und Dauer rein verhaltensbezogener Beobachtungseinheiten (z. B. Körperkontakt) nicht abgebildet würden. Im Vergleich zu nominalen Kategoriensystemen sind Ratingskalen weniger zeitintensiv und können vergleichbar zuverlässige Ergebnisse liefern (Bakeman/Quera). Ein weiteres Beispiel ist die Sequenzanalyse, die es ermöglicht, Verhaltensmuster zu identifizieren und strukturelle Zusammenhänge im zeitlichen Verlauf zu untersuchen. Voraussetzung ist das Vorliegen zeitlich fortlaufend erhobener Daten zu mehreren Messzeitpunkten (Bakeman/Quera).
Objektivität der Verhaltensbeobachtung
Einschränkungen der Zuverlässigkeit und Objektivität können aufgrund von Urteilsverzerrungen seitens der Beobachter und durch die Tatsache der Beobachtung selbst entstehen. Da Beobachtung auf der individuellen Wahrnehmungsleistung der einzelnen Beobachter basiert, ist die Herstellung einer hohen Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beobachtern (Interrater-Reliabilität) eine Voraussetzung, um die Objektivität einer Beobachtung zu gewährleisten. Unterschiedliche Quellen für Beobachtungsfehler[51] sind bei der Auswertung zu berücksichtigen. Bei der Verwendung globaler Ratingskalen besteht die Gefahr, dass bei der Kodierung extreme Werte vermieden werden (zentrale Tendenz), die Beurteilung durch den Gesamteindruck oder besonders saliente Verhaltensmerkmale überlagert wird (Halo-Effekt) oder Erwartungshaltungen des Beobachters die Urteilsbildung beeinflussen. Auch können Personenmerkmale des Beobachters (z. B. Geschlecht, Alter) zu Urteilsverzerrungen führen. Neben Auswahl und Training der Beobachter ist die Kontrolle der Auswertung unerlässlich, um Verzerrungen infolge von Beobachtungsfehlern entgegenzuwirken (Greve/Wentura). Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Kodierung werden sichergestellt, indem die Übereinstimmung zwischen unabhängigen Beobachtern ermittelt wird oder ein Abgleich der Auswertung mit einem zuvor etablierten Expertenrating erfolgt. Zur Prüfung der Interrater-Reliabilität wird z. B. Cohens Kappa als statistisches Maß verwendet (Bakeman/Quera). Eine Alternative für die Prüfung der Interrater-Reliabilität bei qualitativen Verfahren, die mit weniger Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Beobachter, Skalenniveau, Stichprobengröße und fehlender Werte verbunden ist, stellt Krippendorffs Alpha dar (Hayes/ Krippendorff).
Grundsätzlich können Beobachtungsfehler jedoch auch durch die untersuchten Personen verursacht werden. Insbesondere Beobachtung ist anfällig für Probleme der Reaktivität, wenn die untersuchten Personen ihr Verhalten aufgrund ihres Wissens über die Untersuchungsabsicht verändern (Versuchspersoneneffekt). Bei teilnehmender Beobachtung über einen längeren Zeitraum (z. B. Feldforschung), wenn Beobachter und untersuchte Personen direkt miteinander interagieren, ist nicht auszuschließen, dass die Messung anhaltende Änderungen im Verhalten zur Folge hat (z. B. um Erwartungen des Beobachters zu erfüllen; Hawthorne-Effekt; Greve/Wentura).
Methoden der Beobachtung stellen besondere Herausforderungen an Planung und Durchführung der Datenerhebung (z. B. Reaktivität) und -auswertung (z. B. Entwicklung eines Kategoriensystems, Training der Beobachter). Methoden der Beobachtung sind jedoch eine wichtige Alternative für die Erfassung von Verhalten, wenn die Verwendung anderer Verfahren (z. B. Befragung) schwierig ist (z. B. komplexe soziale Interaktionen in Gruppen) oder untersuchte Personen nicht über ihr Verhalten Auskunft geben können (z. B. Kleinkinder) (Greve/ Wentura; Schnell et al., Kap. 7). Generell empfiehlt es sich, unterschiedliche Datenquellen (z. B. Befragungen wie Selbst- und Fremdbericht) mit Methoden der Beobachtung zu kombinieren (Triangulation; Schnell et al., Kap. 7).
Literatur
Bakeman, Roger; Quera, Vincenç, 2011: Sequential analysis and observational methods for the behavioral sciences, New York. – Bodemann, Guy, 2006: Beobachtungsmethoden; in: Petermann, Franz; Eid, Michael (Hg.): Handbuch der psychologischen Diagnostik, Göttingen, 151–159. – Bortz, Jürgen; Döring, Nicola, 2009: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, Heidelberg. – Cranach, Mario von; Frenz, Hans-Georg, 1969: Systematische Beobachtung; in: Graumann, Carl Friedrich (Hg.): Handbuch der Psychologie, Band 7, Sozialpsychologie, Göttingen, 269–331. – Faßnacht, Gerhard, 1995: Systematische Verhaltensbeobachtung: Eine Einführung in die Methodologie und Praxis, München. – Flick, Uwe, 2007: Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung, Reinbek. – Greve, Werner; Wentura, Dirk, 1997: Wissenschaftliche Beobachtung: Eine Einführung, Weinheim. – Hayes, Andrew F.; Krippendorff, Klaus, 2007: Answering the call for a standard reliability measure for coding data; in: Communication Methods and Measures, 1, 77–89. – Hoyle, Rick H. et al., 2009: Research methods in social relations, Belmont Drive, CA. – Schnell, Rainer et al., 2011: Methoden der empirischen Sozialforschung, München. – Trommsdorff, Gisela, 2007: Entwicklung im kulturellen Kontext; in Trommsdorff, Gisela; Kornadt, Hans-Joachim (Hg.): Enzyklopädie der Psychologie: Themenbereich C, Serie VII, Bd. 2: Kulturelle Determinanten des Erlebens und Verhaltens, Göttingen, 435–519.
Tobias Heikamp
Berufssoziologie
Gegenstand
In der Berufssoziologie (engl. occupational sociology/sociology of occupations) bzw. in berufssoziologischen Analysen geht es um die Bedeutung des Berufs für Individuen, Organisationen und gesellschaftliche Teilbereiche und genauer: um eine soziologische Beschreibung dieser Verhältnisse. In der mittelalterlichen Gesellschaft war der Beruf nicht nur ein Teil des Lebens, sondern er bestimmte die[52] Existenz des ›ganzen Hauses‹ sowie das ›ganze Leben‹ der in ihm arbeitenden und wohnenden Personen. Der Beruf fungierte als Leitgesichtspunkt für die ganze Lebensführung und war der bestimmende Orientierungsrahmen für betriebliche Organisationen. Diese umfassende Stellung hat er in der modernen Gesellschaft freilich längst eingebüßt, was gleichwohl nicht heißt, dass er bedeutungslos geworden wäre, worauf schon Helmut Schelsky (1960/1965) in seinem einflussreichen Aufsatz »Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft« hingewiesen hat. Obwohl Schelsky sehr wohl die Gefahr sieht, dass der »in seiner Lebensbedeutung reduzierte Beruf nur als Mittel und Zweck für die Lebenserfüllung in anderen Lebensbereichen angesehen« und damit zum »bloßen Job« werden könnte (240), betont er, dass auch in dieser teilhaften Bedeutung, die der Beruf jetzt noch für das menschliche Leben hat, »die Berufstätigkeit immer noch der wichtigste Faktor für die soziale Bestimmung des menschlichen Lebens in unserer Kultur« ist (240) und dass die Menschen »im Wesentlichen nach ihren Berufen sozial eingeordnet« werden (S. 241). Der Beruf ermögliche nämlich den Menschen nach wie vor den Großteil ihrer Sozialkontakte und strukturiert ihren Alltag und ihren Lebenslauf; er bestimmt ihre Einkommens- und ihre Vermögensverhältnisse und damit auch ihren sozialen Status und ihr soziales Prestige; und schließlich prägt er ihre Selbst- und Fremdeinschätzung, also das Bild, das sie von sich beziehungsweise andere von ihnen haben. Und, so kann man hinzufügen, auch Organisationen sind natürlich immer noch zwingend auf das berufliche Wissen ihrer Mitarbeiter angewiesen.
Hiermit ist bereits ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Arbeit und Beruf angedeutet. Der Arbeitsbegriff ist sehr weit gefasst: nicht nur Arbeiter arbeiten, sondern auch Angestellte, Beamte und Selbstständige, und die Gesellschaft mit ihren Teilbereichen und Organisationen ist auf diese Arbeit angewiesen. Der Berufsbegriff setzt dagegen spezifischer an und bezeichnet darüber hinaus die jeweilige Form der Arbeit. Als zusätzliches Moment kommt beim Beruf zum einen immer auch die Form der Ausbildung/Qualifizierung für die (berufliche) Arbeit hinzu und zum anderen kann man von Berufen erst sprechen, wenn sich »Arbeit in ausdifferenzierter Rollenstruktur (…) konstituiert« (Luckmann, Sprondel 1972, 13). Berufe lassen sich so gesehen als »die soziale Organisation der Arbeit« (ebd.: 17) beschreiben oder anders: als berufliche Organisation des Arbeitens, d. h. als Berufsform. Und genau diese »Berufsform von Arbeiten in ihren vielfältigen Aspekten ist der Gegenstand der ›Berufssoziologie‹« (Daheim 2001, 22).
Geschichte des Berufsbegriffs
Die Geschichte des Berufsbegriffs hat ihren Ursprung in der Theologie. Gemeinhin gilt Martin Luther mit seiner Übersetzung des griechischen Wortes für Arbeit als Wegbereiter der reformatorischen Lehre vom Beruf – es geht jetzt um die Berufung zur Arbeit, die das alte Verständnis der Arbeit als Buße ergänzt. In enger Beziehung zur besonderen Form der Ehre fungiert der Beruf im Weiteren in der geburtsständischen Gesellschaft für lange Zeit als ein zugeschriebener sozialer Status. Und erst unter den rationalistischen Einflüssen der Aufklärung im 18. Jh. ist die Berufsidee dann zunehmend säkularisiert worden. In der Vorstellung des deutschen Idealismus erfolgt die Berufung zu einem Beruf nicht mehr durch Gott, sondern determiniert sich durch Eignung und Neigung des Menschen, womit gleichsam ein Weg der sozialen Positionierung von Herkunft zum Aufstieg über den Beruf auf Grund von Anlage, Talent und Begabung durch freie Berufswahl eingeleitet wurde.
Die hier nur in aller Kürze angedeutete Geschichte des Übergangs von einem religiösen zu einem weltlichen Berufsbegriff nachgezeichnet zu haben, ist zunächst einmal das Verdienst des Soziologen Max Weber, der damit zudem das Berufsthema an theoretisch zentraler Stelle der neuen Disziplin Soziologie in Deutschland positioniert hat. In seiner Protestantismusstudie etwa fragt Weber nach den aus der modernen Berufsethik resultierenden Folgen für die kapitalistische Ökonomie und bestimmt das Berufsmenschentum und dessen Ausformungen als Fach- und Geschäftsmenschentum als grundlegendes Erklärungsmuster für den modernen Kapitalismus. Und in seiner Herrschaftssoziologie bestimmt er darüber hinausgehend auf der Grundlage des Fachmenschentums die Legitimation über Kompetenzen gleichsam als das Merkmal der modernen Gesellschaft – welche die Legitimation über Herkunft früherer Gesellschaftsformationen ersetzt – und versucht auf dieser Grundlage den modernen Staat, das Berufsbeamtentum und die bürokratische Organisationsform zu bestimmen.
[53]Berufssoziologie als Disziplin
Damit hat die Soziologie schon in ihrer Begründungsphase der Theorie und Geschichte des Berufs große Aufmerksamkeit gewidmet. Insbesondere in den Arbeiten von Max Weber und Émile Durkheim, die sicherlich noch nicht als Berufssoziologen bezeichnet werden können, finden sich bereits grundlegende, einen Anfang markierende Überlegungen zu einer Soziologie des Berufs. So hat etwa Durkheim (1996, 41 ff.) die Berufsgruppe als Vermittlungsglied zwischen den Individuen und der Gesellschaft herausgestellt, und Weber (1985, 80) hat mit seiner Bestimmung des Berufs als »jene Spezifizierung, Spezialisierung und Kombination von Leistungen einer Person (…), welche für sie Grundlage einer kontinuierlichen Versorgungs- oder Erwerbschance ist« sozusagen das Zeitalter der modernen Berufskonzeption eingeleitet.
Im Weiteren ist dann insbesondere die Bedeutung von Talcott Parsons herauszustellen. Dieser war zwar wie Durkheim und Weber kein Berufssoziologe im engeren Sinne, hat aber gleichwohl mit der umfangreichen Thematisierung des Berufs- und Professionenkomplexes in seinem Werk für viele Jahre die berufssoziologischen Diskussionen bestimmt. Parsons verbindet dabei die Analysen von Durkheim zur beruflichen Rollendifferenzierung und von Weber zur Differenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche und arbeitet die Berufsrollen als Bestandteil der jeweiligen gesellschaftlichen Teilsysteme heraus. Diese Systeme sind auf eine fortschreitende Ausdifferenzierung von bestimmten Leistungen angewiesen, sie etablieren dazu passende berufliche Positionen, die sie sozialen Akteuren zuweisen, damit diese ihrer beruflichen Rolle erwartungsgemäß spezialisierte Leistungen erbringen.
Als eigenständiges Fach kann sich die Berufssoziologie erst nach dem Zweiten Weltkrieg etablieren; es kommen erste lehrbuchartige Monographien auf den Markt, die das Wissen der Disziplin systematisieren. In den folgenden Jahren werden dann verstärkt Monographien und Sammelbände zur Berufsproblematik mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen publiziert. In der Berufssoziologie geht es dann anders als etwa in der Berufspädagogik zum einen um die Ausarbeitung von nicht auf den Bildungsaspekt beschränkten Berufstheorien, die sowohl die Bedeutung der beruflichen Arbeit für Personen als auch die gesellschaftliche Funktion des Berufs untersuchen (s. etwa Beck et al. 1980). Und zum anderen geht es um empirische und theoretische Berufsanalysen, die sich nicht nur auf die Tätigkeiten auf der Ebene der Facharbeiter und Fachangestellten beschränken, die zumeist im dualen System ausgebildet werden, sondern auch noch den Bereich der hochqualifizierten akademischen Berufe wie Professionen und Wissensarbeit, aber auch solche neuen Arbeitsformen wie die des Arbeitskraftunternehmers (Voß, Pongratz 1998) einbeziehen.
Gleichwohl wird in der Soziologie auch dem Berufsbildungsthema wieder verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt, was man insbesondere im Rahmen der Diskussionen um die moderne Wissensgesellschaft beobachten kann. Soziologisch sind an dem Thema Berufsbildung insbesondere zwei Themenkomplexe interessant, die jeweils Verknüpfungen zu anderen soziologischen Teildisziplinen erfordern. In Verbindung mit der Organisationssoziologie kann etwa untersucht werden, in welcher Art und Weise betriebliche Organisationen die im Beruf enthaltenen Kompetenzbündel zur Steigerung ihres Betriebskapitals nutzen. In den aktuellen Debatten über lernende und wissende Organisationen wird z. B. danach gefragt, wie das individuelle in den Köpfen der Mitarbeiter ›versteckte‹ Wissen in das kollektive Wissen der Organisationen inkorporiert werden kann. Und in Verbindung mit der soziologischen Ungleichheitsforschung wird nach der Bedeutung gefragt, die dem beruflichen Wissen im Ungleichheitsgefüge der modernen Gesellschaft zukommt.
Obwohl also dem Berufsthema immer noch eine große Bedeutung zugeschrieben werden muss, mag es überraschen, dass es – zumindest in Deutschland – die Berufssoziologie als eigenständige Teildisziplin der Soziologie eigentlich gar nicht mehr gibt. So beheimatet etwa die Deutsche Gesellschaft für Soziologie keine Sektion Berufssoziologie mehr, wohl aber die Sektionen Arbeits- und Industriesoziologie, Organisationssoziologie, Professionssoziologie sowie Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse, die sich sozusagen das Berufsthema teilen. Exemplarisch seien hier nun zwei Aspekte des Berufsthemas, die Ungleichheitsdebatte und der Bereich der hochqualifizierten Berufe, angesprochen.
[54]Beruf und soziale Ungleichheit
Im Rahmen von Klassen- und Schicht-Konzepten war die Ungleichheitsforschung bis in die siebziger Jahre hinein weitgehend berufszentriert, der Beruf wurde als der zentrale Bestimmungsfaktor sozialer Ungleichheit und als der beste einzelne Indikator der Sozialstruktur einer Gesellschaft (Blau/Duncan 1967) interpretiert. Dabei wird die Existenz und Struktur sozialer Ungleichheit im Wesentlichen durch ökonomische Ursachen erklärt. Obwohl seit den siebziger Jahren in zunehmenden Maße andere Ungleichheiten ins Bewusstsein gerückt sind, konnte man den Beruf noch viele Jahre lang (in Abkehr von Herkunft) als ein zentrales Medium der sozialen Differenzierung in der modernen Gesellschaft bestimmen. In der gegenwärtigen Soziologie wird jedoch mehr und mehr davon ausgegangen, dass dem Beruf diese Zentralstellung nicht mehr zugeschrieben werden kann.
Die ehemals herausragende Bedeutung des Berufs ist vor allem in Zusammenhang mit konstatierten Entschichtungstendenzen der Gesellschaft in Frage gestellt worden. Neben der vertikalen Ungleichheit entlang der Berufshierarchie richtet sich das Augenmerk nun verstärkt auf horizontale Ungleichheiten wie Geschlecht, Kohorte, Region, Alter, Nation etc. Dieser Perspektive folgend sind die subjektiven Lebensweisen der Menschen nicht mehr im Wesentlichen Konsequenzen des Berufs; dieser ist nur noch eines unter vielen ungleichheitsrelevanten Kriterien in modernen hoch individualisierten Gesellschaften. Allerdings ist das nicht unbestritten, so wird dagegen argumentiert, dass – besonders durch die Verschiebung und Entwertung anderer sinnintegrierender Instanzen und Beziehungen wie Religion, Ehe und Familie bedingt – der Beruf eine zunehmend identitätsrelevante Bedeutung erhält. Auch wird ins Feld geführt, dass soziale Ungleichheiten und Lebenschancen in erheblichem Ausmaß von traditionellen Schichtkriterien wie Berufsposition und Bildungsniveau abhängen.
Sicherlich ist der Beruf nur einer unter vielen Bestimmungsfaktoren für die Positionierung von Personen im sozialen Raum, dennoch kommt ihm etwa im Zusammenhang mit Organisationen immer noch eine bedeutende Rolle zu. Die Organisationsmitgliedschaft erfordert den Beruf als qualifizierte Erwerbsarbeit, wie Max Weber ihn definiert hat: Man ist ausgebildet für eine Tätigkeit in der Organisation und wird dafür von dieser bezahlt. Für die andere Seite der sozialen Positionierungsfunktion von Organisationen, der Partizipation des Publikums an organisationsspezifischen Entscheidungen, muss in der Regel Geld gezahlt werden, für dessen Erwerb der ausgeübte Beruf eine wesentliche Rolle spielt. In diesem Sinne ist der Beruf eine der Voraussetzungen für die Teilhabe an Gesellschaft, die über Organisationen vermittelt wird.
Professionen und Wissensberufe
Wer heute über die Form der qualifizierten Erwerbsarbeit nachdenkt, der bleibt nicht mehr bei der klassischen Steigerungsformel »Arbeit, Beruf, Profession« (Hartmann 1968) stehen, sondern unterscheidet im Bereich der hochqualifizierten akademischen Tätigkeiten professionelle Arbeit und die sogenannten Wissensberufe wie Experten, Ratgeber und Berater. Der Begriff der Wissensberufe ist ein Steigerungsbegriff, in der modernen Wissensgesellschaft tendiert immer mehr Arbeit zur Wissensarbeit. Demgegenüber haben wir es beim Begriff der Professionen mit einem exklusiven Begriff zu tun, Professionen können immer nur sehr wenige Berufe sein (s. a. das Stichwort »Professionalisierung«).
Professionen sind in der Moderne akademische Berufsgruppen, die lebenspraktische Probleme von Klienten im Kontext einzelner gesellschaftlicher Teilbereiche wie dem Gesundheits-, dem Rechts-, dem Religions- und dem Erziehungssystem in Interaktionssituationen mit Klienten stellvertretend deuten, verwalten und bearbeiten. Die Professionellen wie Ärzte, Rechtsanwälte, Seelsorger und Lehrer fungieren dabei als verberuflichte Leistungsrollen dieser Sozialsysteme, denen sowohl bei der Ausdifferenzierung der Systeme wie auch bei deren Erfüllung der Leistung für andere Funktionssysteme der Gesellschaft eine besondere Bedeutung beigemessen werden konnte. Diese sogenannten Leitprofessionen (Stichweh 1996) verwalten jeweils den besonderen Wissenskorpus dieser Funktionssysteme und nehmen gegenüber den anderen im Kontext des Systems arbeitenden Berufen eine Kontroll- und Delegationsfunktion ein.
Obwohl nun die neuen Wissensberufe gegenüber den klassischen Professionen weder unbedingt etwas mit lebenspraktischen Problemen von Klienten zu tun haben noch gesellschaftliche Zentralwerte abdecken müssen, kann man in Bezug auf die Form der[55] Wissensbasierung beider beruflichen Gruppen auch eine Gemeinsamkeit markieren. Auch die Handlungslogik der zunehmenden Wissensberufe ist nicht die einer technisch-instrumentellen Anwendung von wissenschaftlichem Regelwissen; wie das Wissen der Professionen ist auch das Expertenwissen der Wissensberufe interpretationsbedürftig, kontingent und im Handeln immer wieder neu zu reproduzieren.
Ende des Berufs?
Der Bedeutungsverlust der Berufssoziologie korrespondiert in gewisser Weise mit der in den Massenmedien und der Wissenschaft seit den 1980er Jahren geführten Debatte über eine Krise bzw. einem Ende von Arbeit und Beruf (Dahrendorf 1983), womit zwar nicht ausgesagt wird, dass der Erwerbsgesellschaft gleich die (berufliche) Arbeit ausgehen würde, wohl aber wird das Ende der sogenannten Vollzeiterwerbsarbeitsgesellschaft prognostiziert. Die Veränderungen, die wir gegenwärtig in der Arbeitswelt beobachten können, zeigen gleichwohl auch noch nicht das von vielen heraufbeschworene Ende der Berufsform überhaupt an. Auch in Zeiten, in denen wir in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft über das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen diskutieren, werden Personen für Arbeit, die ihnen ihren Lebensunterhalt sichern soll, ausgebildet, und Organisationen müssen für die ausgeübte Arbeit, auf die sie angewiesen sind, bezahlen. Was sich aber vor allem verändert, ist das Verhältnis von Ausbildung und Arbeit/Erwerb und damit ein inhaltlicher Wandel des Berufs. Im Übergang zur Wissensgesellschaft, in der immer mehr Arbeit zur reflexiven Wissensarbeit wird, muss sich das Bildungssystem darauf einstellen, dass mehr und mehr Personen mit überfachlichen Kompetenzen und entwicklungsoffenen Qualifikationspotentialen gesucht werden. Hier zeigen sich Tendenzen einer Annäherung von beruflicher und allgemeiner Bildung.
Obwohl in zunehmendem Maße andere Formen von Arbeit an Bedeutung gewinnen, wird die berufliche Erwerbsarbeit auch weiterhin die dominante Form des Arbeitens bleiben (Daheim 2001). Die Veränderungen, die wir gleichwohl in der Arbeitswelt beobachten können, scheinen denn auch eher ein neues und sich immer schneller wandelndes Mischungsverhältnis anzudeuten; und zwar auf der einen Seite im Rahmen beruflicher Erwerbstätigkeit selber, auf der anderen Seite aber auch im Verhältnis der Erwerbsorientierung zu gemeinschaftsorientierten Tätigkeiten oder solchen im persönlich-familiären Bereich.
Genauso wenig wie man von einem Ende des Berufs sprechen kann, ist auch die Berufssoziologie noch lange nicht überflüssig geworden, sie scheint sogar gegenüber anderen das Berufsthema bearbeitenden soziologischen Teildisziplinen einen analytischen Vorteil zu haben: So kann sie etwa das Themenspektrum der Arbeitssoziologie und der Professionssoziologie mit bearbeiten. Denn der zwischen Arbeit und Profession stehende Berufsbegriff schließt sowohl nur wenig berufliche Qualifikationen erfordernde Erwerbsarbeit als auch hochqualifizierte professionelle Arbeit bzw. Wissensarbeit ein. Und darüber hinaus kann sie Beiträge zu anderen soziologischen Debatten beisteuern, wie etwa denen der Organisationssoziologie oder der soziologischen Ungleichheitsforschung, so dass die Berufssoziologie aus der spezifischen Perspektive der Berufsform eine Verbindung zwischen diesen Teildisziplinen herstellen kann (Kurtz 2005).
Literatur
Beck, Ulrich et al., 1980: Soziologie der Arbeit und der Berufe. Grundlagen, Problemfelder, Forschungsergebnisse, Reinbek. – Blau, Peter M.; Duncan, Otis D., 1967: The American Occupational Structure. New York u. a. – Daheim, Hansjürgen, 2001: Berufliche Arbeit im Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft; in: Kurtz, Thomas (Hg.): Aspekte des Berufs in der Moderne, Opladen, 21–38. – Dahrendorf, Ralf, 1983: Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht; in: Matthes, Joachim (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982, Frankfurt a. M./ New York, 25–37. – Durkheim, Emile, 1996: Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften, 2. Aufl., Frankfurt a. M. (1893). – Hartmann, Heinz, 1968: Arbeit, Beruf, Profession; in: Soziale Welt 19, 193–216. – Kurtz, Thomas, 2005: Die Berufsform der Gesellschaft, Weilerswist. – Luckmann, Thomas; Sprondel, Walter Michael, 1972: Einleitung; in: dies. (Hg.): Berufssoziologie, Köln, 11–21. – Parsons, Talcott; Smelser, Neil J., 1956: Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory, London. – Schelsky, Helmut, 1960/1965: Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft; in: ders.: Auf der Suche nach Wirklichkeit, Düsseldorf/Köln, 238–249. – Stichweh, Rudolf, 1996: Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft; in: Arno Combe; Helsper, Werner (Hg.): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen [56]zum Typus pädagogischen Handelns, Frankfurt a. M., 49–69. – Voß, G. Günter; Pongratz, Hans J., 1998: Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50, 131–158. – Weber, Max, 1984: Die protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung, hg. von Johannes Winckelmann, Gütersloh (1920). – Weber, Max, 1985: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen (1920).
Thomas Kurtz
Bevölkerungssoziologie und Demographie
Gegenstand und Thematik
Demographie (engl. demography) ist der Oberbegriff für Analysen quantitativer und qualitativer Veränderungen der Bevölkerungsverhältnisse einer Region, eines Landes oder der Welt als Ganzes. Da gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische, kulturelle und biologische Faktoren demographische Entwicklungen beeinflussen, ist Demographie idealerweise eine interdisziplinär ausgerichtete Wissenschaft. Die Bevölkerungssoziologie – als Teildisziplin – eröffnet einen spezifischen soziologischen Zugang zu demographischen Prozessen und Strukturen, und sie setzt dabei soziologische Denk- und Theorieansätze zur Analyse demographischer Entwicklungen ein (Niephaus 2012, 13 ff.). Im Zentrum der Bevölkerungssoziologie stehen sowohl die Auswirkungen gesellschaftlicher Wandlungen auf demographische Größen (wie Geburtenniveau, Überlebensordnung, Migration, Altersverteilung der Bevölkerung) als auch die Auswirkungen demographischer Entwicklungen auf Gesellschaften, Organisationen, Familien und Individuen. Zu den zentralen demographischen Komponenten – welche bevölkerungssoziologisch auf ihre gesellschaftliche Einbettung und Bedeutung hin untersucht werden – gehören im Einzelnen:
| a) | Familiengründung und Geburtenniveau: Die Zahl von neugeborenen Kindern wird zum einen durch die Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter bestimmt. Zum anderen wird die Geburtenzahl durch das Fertilitätsverhalten von jungen Frauen und Männern bestimmt. Das Fertilitätsverhalten seinerseits wird durch eine Reihe von Faktoren – wie Partnerschafts- und Familiengründungsverhalten, Kinderwunsch und Geburtenkontrolle – beeinflusst. Entsprechend ist das Geburtenniveau einer Gesellschaft eng mit ihren sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen verknüpft. Eine demographische Analyse von Veränderungen des Fertilitätsverhaltens kommt deshalb nicht aus ohne Bezug etwa auf familiensoziologische Konzepte. Bedeutsam für das Verständnis von Familiengründung und Geburtenverhalten sind aber auch soziologische Ansätze der Genderforschung oder – da das Familiengründungsverhalten je nach sozialer Schicht variiert – Theorien sozialer Ungleichheiten. |
| b) | Sterbefälle (Mortalität) bzw. Absterbe- und Überlebensordnung: Veränderungen der Lebenserwartung innerhalb einer Gesellschaft sind von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und epidemiologischen Einflussfaktoren abhängig. Zwar müssen alle Menschen einmal sterben, aber die Lebenserwartung bzw. Überlebensordnung von Menschen unterliegt markanten sozialen Unterschieden bzw. Ungleichheiten, etwa nach Geschlecht oder sozialer Schichtzugehörigkeit. Umgekehrt wirken sich Veränderungen der Überlebensordnung tiefgreifend auf gesellschaftliche Lebensverhältnisse, intergenerationelle Beziehungen und individuelle Lebensverläufe aus. Soziologisch stehen vor allem Fragen sozialer Ungleichheiten der (aktiven) Lebenserwartung sowie die Zusammenhänge zwischen Sozialstruktur und Lebenserwartung im Zentrum des Interesses. |
| In der klassischen Bevölkerungsstatistik warden Geburten und Sterbefälle zur sog. ›natürlichen Bevölkerungsbewegung‹ gezählt. Aus soziologischer Sicht – und angesichts der nachweisbaren enormen Bedeutung sozialer Faktoren für Geburtenhäufigkeit und Sterblichkeitsverläufe – greift der Begriff ›natürlich‹ zu kurz. Zudem genügen einzig auf globaler Ebene die Geburten- und Sterbezahlen formal zur Erklärung der Bevölkerungsentwicklung. Werden national oder regional begrenzte Gebiete analysiert, kommt eine weitere demographische Komponente hinzu: | |
| c) | Wanderungsbewegungen (Migration): Abwanderung reduziert und Zuwanderung erhöht die Bevölkerungszahl eines gegebenen Gebietes. Speziell für kleinere geographische Einheiten (Regionen, Kommunen, Quartiere) kann die Bevölkerungsentwicklung primär von Zu- oder Abwanderungsprozessen bestimmt sein. Migrationsbewegungen[57] sind nicht nur ökonomisch begründet, sondern sozial determiniert und sozial eingebettet (wie etwa bei Familiennachzug, Kettenmigration usw.). Soziologisch betrachtet sind räumliche Wanderungsbewegungen bedeutsame Elemente (sozial ungleich gestalteter) sozialer Mobilitätsprozesse. In vielen Fällen beeinflussen Zu- oder Abwanderungsbewegungen nicht allein die Bevölkerungszahl, sondern auch die sozialstrukturelle und sozialkulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung einer Nation oder Region. |
Geburtenniveau, Sterbeverhältnisse und Migrationsprozesse bestimmen zusammen Bevölkerungsentwicklung (Zu- oder Abnahme der Bevölkerung) und Bevölkerungsstruktur, inklusive Alters- und Geschlechterverteilung innerhalb einer Bevölkerung. Der spezifische Einfluss der drei demographischen Komponenten (Geburten, Sterbefälle, Migration) auf Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstruktur variiert je nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Starkes Bevölkerungswachstum kann sich aufgrund hoher Geburtenzahlen, aber auch aufgrund massiver Zuwanderung ergeben. Eine stagnierende Bevölkerungszahl kann sowohl das Ergebnis hoher Geburtenhäufigkeit gekoppelt mit geringer Lebenserwartung als auch das Resultat hoher Lebenserwartung bei geringer Geburtenhäufigkeit sein. Aktuell stehen in Europa vor allem Fragen einer ansteigenden demographischen Alterung und Szenarien einer schrumpfenden Bevölkerung im Zentrum demographischer und bevölkerungssoziologischer Diskurse.
Aus soziologischer Sicht von Bedeutung ist die Tatsache, dass die jeweiligen demographischen Strukturen und Entwicklungen eng mit der vorherrschenden Sozial- und Wirtschaftsstruktur einer Gesellschaft verbunden sind. Veränderungen der demographischen Komponenten lassen sich zwar rein bevölkerungsstatistisch beschreiben, jedoch nie ohne Rückgriff auf soziologische Theorien – wie etwa sozialstrukturanalytische, modernisierungstheoretische oder lebensverlaufsanalytische Ansätze – verstehen. Bei bevölkerungssoziologischen Analysen stehen die gesellschaftlichen Determinanten und Konsequenzen quantitativer Veränderungen von Bevölkerungsindikatoren im Zentrum. Im Grunde geht es darum, quantitative Phänomene bevölkerungsstatistischer Art mit qualitativen Veränderungen der Gesellschaft zu verknüpfen.
Demographische Prozesse und bevölkerungssoziologische Fragestellungen
Wie andere Teilgebiete der Soziologie weist auch die Bevölkerungssoziologie eine Vielfalt unterschiedlicher Fragestellungen auf. Es gibt allerdings allgemeine Grundfragen, die schon seit jeher die Diskussionen innerhalb der Bevölkerungssoziologie bestimmt haben. Dazu gehören namentlich folgende Fragestellunggen (vgl. Höpflinger 2012):
a) Welche wechselseitigen Zusammenhänge bestehen zwischen (quantitativen) demographischen und (qualitativen) gesellschaftlichen Wandlungen? Inwiefern sind Modernisierungsprozesse einer Gesellschaft systematisch mit spezifischen demographischen Wandlungen – wie etwa sinkende Geburtenhäufigkeit und steigende Lebenserwartung – verknüpft?
b) Welche individuellen, familialen und gesellschaftlichen Faktoren bestimmen Familiengründung und Fertilität junger Frauen und Männer? Wie lässt sich sozial differenziertes Fertilitätsverhalten erklären? Und welche gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen sind längerfristig bei tiefem Geburtenniveau zu erwarten?
c) Welche gesellschaftlichen Wandlungen führen zu verstärkten räumlichen Mobilitätsprozessen (Emigration oder Immigration), und von welchen gesellschaftlichen Folgeerscheinungen sind starke Ein- oder Auswanderungsbewegungen begleitet? Inwiefern sind räumliche und soziale Mobilität wechselseitig verknüpft?
d) Welche sozialen Faktoren tragen zu einer Erhö hung der Lebenserwartung bzw. zum Rückzug eines vorzeitigen Sterbens bei? Was sind die gesellschaftlichen Wirkungen einer hohen Lebenserwartung? Aus welchen Gründen entstehen soziale Ungleichheiten der Lebenserwartung insgesamt und der gesunden Lebenserwartung im Speziellen?
Neuerdings stehen in europäischen Gesellschaf ten zudem auch folgende Fragestellungen im Zentrum bevölkerungssoziologischer Aufmerksamkeit:
e) Welche gesellschaftlichen und sozialpolitischen Auswirkungen resultieren aus Prozessen einer verstärkten demographischen Alterung? Und welche Folgen hat eine stagnierende oder schrumpfende Bevölkerungszahl auf gesellschaftliche und sozialpolitische Verhältnisse?
[58]Bedeutung der Soziologie für demographische Analysen
Die Bevölkerungssoziologie bewegt sich dabei zwischen Makro- und Mikroebene einerseits und zwischen quantitativen und qualitativen gesellschaftlichen Wandlungen andererseits. Bevölkerungswachstum, Geburtenhäufigkeit, Migration oder demographische Alterung beispielsweise sind gesamtgesellschaftlich relevante Phänomene, die ihre Wurzeln gerade auch in familialem und/oder individuellem Verhalten und Handeln haben. Quantitative Veränderungen etwa von Bevölkerungszahl, Bevölkerungsverteilung und Bevölkerungsstruktur sind eng mit qualitativen Wandlungen von Gesellschaften verbunden.
Vielfach lassen sich demographische Entwicklungen nur durch den gleichwertigen Einbezug von Statistik, Ökonomie, Soziologie und Sozialgeschichte erfassen und verstehen. Soziologische Versuche, die gesellschaftlichen Wirkungen und sozialen Einbettungen demographischer Prozesse zu untersuchen, kommen nicht ohne Berücksichtigung der Arbeiten anderer Fachrichtungen aus. Ein wichtiges Merkmal der modernen Bevölkerungssoziologie – im weitesten Sinne als gesellschaftstheoretische Analyse und Diskussion bevölkerungsstatistisch feststellbarer Wandlungen zu verstehen – ist ihre disziplinübergreifende Perspektive. Trotz der unbestreitbaren Bedeutung anderer Fachrichtungen (Bevölkerungsstatistik, Ökonomie, Sozialgeschichte usw.) kann allerdings mit einigem Recht behauptet werden, dass im Rahmen der Bevölkerungswissenschaften der soziologischen Betrachtungsweise eine zentrale Bedeutung zukommt. G. Mackenroth – einer der Klassiker der deutschen Bevölkerungslehre – stellte die Soziologie sogar explizit ins Zentrum: »Das letzte Wort hat in der Bevölkerungslehre immer die Soziologie, und die Soziologie kann wiederum nicht betrieben werden ohne Einbeziehung der historischen Dimension.« (1953, 111, zur Geschichte der deutschen Bevölkerungssoziologie Henßler/Schmid 2007). Mackenroth brachte damit zum Ausdruck, dass rein bevölkerungsstatistische Analysen strukturblind sind. Da Bevölkerungsstatistiken von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abstrahieren, sind sie für eine Erklärung demographischer Veränderungen wenig geeignet. Modelle, welche Bevölkerungsentwicklungen nur mit Hilfe demographischer Variablen zu erklären versuchen, sind klar gescheitert. Mackenroth war gleichzeitig aber auch der Ansicht, dass Bevölkerungssoziologie ohne historische Betrachtung nicht betrieben werden kann, da Bevölkerungsverhältnisse ihren Ursprung oft in der Vergangenheit haben bzw. demographische Prozesse sich erst allmählich und mit beträchtlicher Zeitverzögerung auf Sozialstruktur, Wirtschaft und Politik auswirken. Auch der deutsche Demograph Josef Schmid (1984) vertrat die Ansicht, dass die Beschäftigung mit Bevölkerungsgeschichte ein notwendiger Bestandteil der Bevölkerungssoziologie sei: »Es geht ihr aber dabei nicht um ›Historie‹, sondern vielmehr um bevölkerungsbezogene Erforschung vergangener Epochen, die für unsere Gegenwart besonders konstitutiv sind und die zum Gegenwartsverständnis wesentlich beitragen.« (Schmid 1984: 18–19).
In den letzten Jahrzehnten ergaben sich gesamthaft betrachtet verstärkte Überlappungen zwischen bevölkerungsstatistischen und bevölkerungssoziologischen Forschungsansätzen und Analyseverfahren, und zwar primär aus zwei Gründen: Erstens erhielten die Sozialwissenschaften vermehrt Zugang zu anonymisierten Grunddaten der Statistik. Die Verbreitung von Mikrozensus-Erhebungen und umfangreicher Paneluntersuchungen hat den traditionellen Unterschied zwischen sozialer Umfrageforschung und Bevölkerungsstatistik aufgeweicht. Große Datensätze erlauben es, demographische und soziale Fragestellungen – etwa im Rahmen von Mehrebenen-Analysen – empirisch zu verknüpfen. Umgekehrt flossen die klassischen Methoden der statistischen Demographie vermehrt in die Soziologie ein. So werden in soziologischen Forschungsarbeiten vermehrt Kohorteneffekte (= Verhaltensunterschiede zwischen Personen aus unterschiedlichen Geburtsjahrgängen) empirisch analysiert. Auch ereignisanalytische Studien bzw. die Benützung stochastischer Modelle für diskrete Ereignisse in kontinuierlicher Zeit erfuhren in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Aufschwung, wodurch vermehrt soziologische Variablen in demographische Analysen (zum Beispiel von Geburtenentwicklung oder Überlebensordnungen) einbezogen werden.
Zweitens ergaben sich in konzeptueller und theoretischer Hinsicht deutliche Konvergenzen. Das wichtigste Beispiel ist die Entwicklung der Lebensverlaufsforschung, die traditionelle soziologische Forschungsfragen (wie z. B. Mobilitätsforschung) mit sozio-demographischen Fragen (z. B. Familiengründung, [59]Migration) verbindet. Damit werden klassische demographische Konzepte (Geburtsjahrgang bzw. Kohorte, generatives Verhalten, Migration, Sterblichkeit) mit sozialwissenschaftlichen Konzepten (Lebenslauf, Familienzyklus, kritische Übergänge und Statuspassagen) in Verbindung gesetzt. Eine verstärkte Verknüpfung von demographischen und sozialwissenschaftlichen Ansätzen ist auch im Bereich der historischen Familienforschung zu beobachten, wodurch die Beziehungen zwischen Geburtenentwicklung, Lebenserwartung und Familien- und Generationenstrukturen in verschiedenen Zeitepochen differenziert erfasst werden konnten. Auf gesellschaftstheoretischer Ebene haben Fragen zum Zusammenhang von Sozialstruktur und Reproduktion (Geburtenentwicklung, Generationenfolge) ebenfalls eine theoretische Weiterentwicklung erfahren, wodurch sich beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen wohlfahrtsstaatlichen Strukturen und soziodemographischen Wandlungen gezielter untersuchen lassen.
Neuere bevölkerungssoziologische Ansätze und Themen
Die in den letzten Jahrzehnten feststellbaren markanten Veränderungen der Geburtenhäufigkeit, des Familiengründungsverhaltens wie auch der familialen Strukturen und Lebensformen waren Anlass zur Entwicklung einer Theorie einer Zweiten demographischen Transition in hochentwickelten Gesellschaften. Dabei wird davon ausgegangen, dass die neueren Entwicklungen des generativen Verhaltens in modernen Gesellschaften einen vollständig anderen Charakter aufweisen als der Wandel von hoher zu tiefer Fertilität in der Phase einer ersten demographischen Transformation. Die Theorie einer zweiten demographischen Transformation ist ein theoretischer Ansatz, der explizit von engen Zusammenhängen zwischen sozio-kulturellen Wertorientierungen, familialen Lebensentwürfen und sozio-demographischen Variablen, wie Form und Zeitpunkt der Familiengründung und Geburtenniveau, ausgeht (vgl. Surkyn, Lesthaeghe 2004). Im Bereich der Migrationssoziologie wird räumliche Mobilität vermehrt als zentrales Element sozialer Mobilität wahrgenommen, und Migrationsbewegungen wurden systematischer mit Lebensereignissen und Lebensverläufen in Verbindung gesetzt. Namentlich lebensverlaufsanalytische Ansätze bieten sich in besonderem Maße an, weil Migration häufig mit einem Wechsel im biographischen und sozialen Status verbunden ist (Kley 2009, 50). Bezüglich Lebenserwartung bzw. Überlebensordnung steht die Feststellung im Zentrum, dass soziale Ungleichheiten – von Bildung, Einkommen und Status – zu ausgeprägten Ungleichheiten der Lebenserwartung beitragen. Dahinter verbergen sich auch soziale Ungleichheiten der gesunden Lebensjahre, des erfolgreichen Alterns und allgemein der Lebensqualität (vgl. Richter, Hurrelmann 2006). Entsprechend sind soziale Unterschiede der (gesunden) Lebenserwartung harte Indikatoren für die negativen Auswirkungen sozialer Chancenungleichheiten. Die erhöhte Lebenserwartung – auch im Alter – führen gleichzeitig dazu, dass Langlebigkeit und Hochaltrigkeit als gesellschaftliche Phänomene stark an Bedeutung gewinnen, mit bedeutsamen Auswirkungen auf Sozialpolitik, Generationenverhältnisse oder Pflegeaufwendungen.
Da immer mehr Länder mit einer doppelten demographischen Alterung (wenige Geburten, längere Lebenserwartung im Alter) konfrontiert werden, bilden die festgestellten oder vermuteten gesellschaftlichen Auswirkungen veränderter Alters- und Generationenstrukturen einen zentralen Themenschwerpunkt demographischer und bevölkerungssoziologischer Analysen und Diskurse (vgl. Schimany 2003). In einigen Regionen zeichnet sich sogar eine schrumpfende Bevölkerung ab (Kaufmann 2005). Bevölkerungssoziologisch zentral ist die Feststellung, dass sich demographische Alterungsprozesse oder Bevölkerungsrückgänge immer nur in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen auswirken (und dass eine Gleichsetzung von demographischer Alterung mit gesellschaftlicher Alterung keineswegs zulässig ist). Sowohl demographische Alterung wie Bevölkerungsschrumpfung erfordern vielfältige Anpassungen von Sozial-, Gesundheits- und Siedlungspolitik wie auch von Arbeits- und Konsummärkten (was etwa den Bedarf nach soziodemographischer und bevölkerungssoziologischer Politikberatung erhöht) (vgl. Jansen et al. 2005).
Literatur
Henßler, Patrick; Schmid, Josef; 2007: Bevölkerungswissenschaft im Werden. Die geistigen Grundlagen der deutschen Bevölkerungssoziologie, Wiesbaden. – Höpflinger, François; 2012. Bevölkerungssoziologie. Eine Einführung[60] in bevölkerungssoziologische Ansätze und demographische Prozesse, Weinheim. – Jansen, Stephan A. et al. (Hg.), 2005: Demographie. Bewegungen einer Gesellschaft im Ruhestand – Multidisziplinäre Perspektiven zur Demographiefolgenforschung, Wiesbaden. – Kaufmann, Franz-Xaver, 2005: Schrumpfende Gesellschaft. Vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen, Frankfurt a. M. – Kley, Stefanie, 2009: Migration im Lebensverlauf. Der Einfluss von Lebensbedingungen und Lebenslaufereignissen auf den Wohnortwechsel, Wiesbaden. – Mackenroth, Gerhard, 1953: Bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung, Berlin. – Niephaus, Yasemin, 2012: Bevölkerungssoziologie. Eine Einführung in Gegenstand, Theorien und Methoden, Wiesbaden. – Richter, Matthias; Hurrelmann, Klaus (Hg.), 2006: Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen, Probleme, Perspektiven, Wiesbaden. – Schimany, Peter, 2003: Die Alterung der Gesellschaft. Ursachen und Folgen des demographischen Umbruchs, Frankfurt a. M. – Schmid, Josef, 1984: Bevölkerung und soziale Entwicklung: Der demographische Übergang als soziologische und politische Konzeption, Boppard am Rhein. – Surkyn, Johan, Lesthaeghe, Ron J., 2004: Wertorientierungen und ›second demographic transition‹ in Nord-, West- und Südeuropa: Eine aktuelle Bestandsaufnahme; in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 29, 63–98.
François Höpflinger
Bewegung, soziale
Unter einer sozialen Bewegung (engl. social movement) versteht man ein soziales Subjekt, das aus einer relativ großen Anzahl von Menschen besteht, die unter einer zentralen, manchmal charismatischen, Führung, aber ohne sehr feste Organisation ein gemeinsames Anliegen gegenüber der Gesamtgesellschaft oder deren politischen Einrichtungen verfolgen. Meist will sie sozialen oder technischen Wandel herbeiführen, beschleunigen, umkehren oder verhindern und wirkt dann teilweise wie ein sozialer Katalysator.
Dieses Anliegen kann sein: wirtschaftliche Besserstellung und Schutz vor Willkür (z. B. Arbeiterbewegung), Gleichberechtigung (Frauenbewegung, US-Bürgerrechtsbewegung), Gewährung von Freiraum für selbstbestimmte Lebensführung (Jugendbewegung), Selbstbefreiung von fremder Unterdrückung (nationale Bewegungen), Schutz der Natur vor dem Menschen (Umweltbewegung), Protest gegen die Nichtbeachtung von Minderheiteninteressen in der offiziellen Politik (außerparlamentarische Opposition), Kampf gegen die Unterdrückung von Menschen durch den Staat (Menschenrechtsbewegung), Abwehr von befürchteten Nachteilen durch weltweite Entwicklungen (Antiglobalisierungsbewegungen) usw. Regelmäßig geht es um einen Missstand, der nach Ansicht der Bewegung von den vorhandenen und zuständigen gesellschaftlichen und politischen Organen gar nicht oder nicht angemessen beachtet wird. Insofern sind soziale Bewegungen i. d. R. ein Anzeichen für fehlenden sozialen oder politischen Wandel und damit ein sozialer Indikator für potenziellen Konflikt, mindestens aber für Mangel an Legitimität der zurzeit zuständigen Instanzen.
Wird dem Anliegen einer sozialen Bewegung nicht durch Anpassung der vorhandenen Institutionen Rechnung getragen, sind bei hinreichender Macht der sozialen Bewegung Unruhen, Bürgerkriege und gar Revolutionen nicht ausgeschlossen. Setzt sich die soziale Bewegung aber durch, wird sie zumeist in die bestehenden Strukturen eingebaut (z. B. Unterorganisation für Frauen oder Frauenquote in einer Partei), zur eigenständigen, formalen Organisation (Arbeiterbewegung als Gewerkschaft) oder von den bestehenden Einrichtungen aufgesogen (Umweltziele in die Programme aller Parteien integriert).
Wegen ihres im Vergleich zu formellen Organisationen recht konturlosen, aber facettenreichen Erscheinungsbildes, nur wenig deutlicher als Massen oder Mengen, haben die sozialen Bewegungen bisher noch nicht sehr viel allgemeintheoretische Aufmerksamkeit erhalten. Bisher wurden daher eher einige Einzelfragen eingehender behandelt, Führer-Gefolgschafts-Beziehungen, Rekrutierungswesen, Umschlag von Unterdrückung in Aufstand, Zustandekommen von Kollektivhandeln, Mobilisierungsstrategien der Führung usw.
Bürgerinitiativen unterscheiden sich von sozialen Bewegungen durch ihre lokale Begrenzung, geringe Mitgliederzahl, relativ enge Anliegen (Verlangen einer Umgehungsstraße, Verhinderung eines Gefängnisbaus) und relativ kurze Lebensdauer, so dass ihre Anliegen nicht auf sozialen Wandel deuten. Soziale Bewegungen werden wegen ihres Verlangens nach zumeist gesamtgesellschaftlichem Wandel an ihrem Anfang oft als illegitim angesehen, kriminalisiert und verfolgt, während Bürgerinitiativen fast regelmäßig erwartete und geduldete bis anerkannte Begleiterscheinungen z. B. eines jeden Bebauungsplans sind.
[61]Literatur
Eder, Klaus, 2000: Kulturelle Identität zwischen Tradition und Utopie. Soziale Bewegungen als Ort gesellschaftlicher Lernprozesse, Frankfurt a. M./New York. – Kern, Thomas, 2008: Soziale Bewegungen, Wiesbaden. – Roth, Roland; Rucht, Dieter (Hg.), 2008: Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945, Frankfurt a. M./New York.
Günter Endruweit
Beziehungen, soziale
Soziale Beziehungen (engl. social relationships) bestehen zwischen Personen, die voneinander abhängig sind und die ihre Interaktion koordinieren. Soziale Beziehungen werden durch Regeln organisiert, die der Koordination der beteiligten Personen dienen; sie setzen soziale Fertigkeiten voraus, sie verbinden Individuen, die ihre Ziele verfolgen, und sie werden durch die gegebenen Umweltfaktoren gefördert oder eingeschränkt (Argyle/Henderson 1990). Beispiele, die die Spannweite von sozialen Beziehungen veranschaulichen, sind Geschäftsbeziehungen, Freundschaften und Paarbeziehungen, die im zweiten Teil auch ausführlicher behandelt werden. Im ersten Teil wird mit dem Begriff der Figuration ein sozialwissenschaftliches Rahmenkonzept für soziale Beziehungen dargestellt, und im Anschluss daran wird die Norm der Reziprozität beschrieben, die eine der zentralen Regeln darstellt, durch die soziale Beziehungen koordiniert werden.
Figuration: Die Verbindung zwischen Individuum und Gruppe
Elias (1997, urspr. 1939) schreibt in der Einleitung seines berühmten Werkes »Über den Prozess der Zivilisation«: »Das Geflecht der Angewiesenheit von Menschen aufeinander, ihre Interdependenzen, sind das, was sie aneinander bindet.« Sie sind das Kernstück dessen, was hier als Figuration bezeichnet wird, als »Figuration aufeinander ausgerichteter, voneinander abhängiger Menschen« (S. 70). Er benennt diese Konfigurationen im Weiteren als Gruppen oder – auf einer höheren Ebene – als Gesellschaften. Mit dieser Begriffsbildung soll die Dichotomie zwischen Individuum und Gesellschaft überwunden werden. Die Gesellschaft wird entsprechend als »das von Individuen gebildete Interdependenzgeflecht« bezeichnet (S. 71).
Eine Analogie kann das Verständnis dessen, was eine Konfiguration ausmacht, erleichtern: Figurationen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Gesellschaftstänzen wie Tango oder Rock’n Roll (Elias 1997, 71). Zwar können unterschiedliche Individuen miteinander tanzen, aber die Abhängigkeit unter den Tänzern, die ihre Tanzschritte koordinieren, ist ein konstituierendes Merkmal des Tanzes. Figuration umfasst also interpersonelle Abhängigkeit und Koordination unter den Handlungen der beteiligten Personen. Während der Tanz eine überschaubare Anzahl von Menschen umfasst und meist auf einer dyadischen Beziehung beruht, kann die Figuration ganze Gesellschaften beschreiben, indem sie die Beziehung der kleineren Gesellschaftseinheiten untereinander darstellt.
An anderer Stelle verwendet Elias (2009, urspr. 1970) das Bild eines Gesellschaftsspiels, bei dem vier Personen zusammen Karten spielen. Die Spieler interagieren miteinander und bilden eine Figuration. Eine größere Figuration ergibt sich, wenn zwei Fußballmannschaften aufeinander treffen. An diesen Beispielen wird deutlich, dass Personen in Konfigurationen sowohl Verbündete als auch Gegner sein können (S. 142). Verbündete sind z. B. Lehrer und Schüler oder Arzt und Patient oder Mitglieder eines Stammtischs (zumindest wenn es gut läuft). Hingegen gilt es auch, Interessengegensätze zu berücksichtigen, wenn etwa die Bewohner einer Stadt in ihren Interdependenzen betrachtet werden. Die einen streben z. B. eine Reduzierung der Lärmbelästigung an, während andere den Ausbau des Regionalflughafens forcieren.
Der Begriff der Figuration thematisiert die Interdependenz der Individuen und die Koordination ihrer Handlungen auf unterschiedlichen Ebenen. Dem liegt die Idee zugrunde, dass es ein Grundbedürfnis nach Gesellung gibt (Bierhoff 2006). Menschen leiden unter Einsamkeit und streben danach, ihre Bedürfnisse in sozialen Beziehungen zu befriedigen. Elias spricht von Gefühlsbefriedigungen, die durch die Verbundenheit mit anderen Personen möglich werden. Die Nähe anderer, mit denen eine Beziehung aufgebaut wird, ermöglicht soziale Vergleiche und das Lernen von angemessenen Strategien. Dadurch wird die Unsicherheit reduziert und die Selbstsicherheit gesteigert.
Die Bedeutung der Interdependenz der Individuen, die Elias in den Mittelpunkt des Begriffs der Konfiguration rückt, wird in der sozialpsychologischen [62]Interdependenztheorie genauer betrachtet (Bierhoff/Jonas 2011). Dabei geht es um die Frage, wie individuelle Bedürfnisse und gemeinsame Interessen ein Muster der Interdependenz erzeugen, in dem die beteiligten Personen mehr oder weniger gut ihre Ziele erreichen können bzw. sich koordinieren müssen, um die Zielerreichung zu optimieren.
Reziprozität als Basis der Kooperation
Die Bedeutung der Reziprozität nimmt in der Moderne zu (Elias 2009, 159). In modernen, durch IT bestimmten Gesellschaften reduziert sich tendenziell die Bedeutung von Machtunterschieden, während ein System, das auf Gegenseitigkeit aufgebaut ist, an Bedeutung gewinnt. Reziprozität setzt eine gewisse Verlässlichkeit der Partner in sozialen Beziehungen voraus. Wenn das Vertrauen einer Person durch reziproke Verlässlichkeit der anderen Person bestätigt wird, nimmt das Vertrauen in der Folge zu. Wenn andererseits auf Vertrauen mit Misstrauen geantwortet wird, sinkt das Vertrauen dramatisch. Vertrauen baut sich langsam auf, wird aber schnell reduziert, wenn es in Frage gestellt wird.
Soziale Beziehungen üben einen Druck im Hinblick auf Reziprozität aus (Blau 1964). Denn bei Einseitigkeit der Beziehung besteht eine Imbalance, die in Richtung Balance tendiert, wie sie bei der Ausgeglichenheit des Austauschs gegeben ist. Jede Machtdifferenz erzeugt eine Imbalance, die nach Möglichkeit vermieden und bei Fortbestehen durch Legitimität oder Loyalität gerechtfertigt wird. Die Bedeutung der Reziprozität ist nicht nur zwischen Familienmitgliedern, sondern auch zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen festzustellen (Worsley 1970). Die zunehmende Spezialisierung von Gruppen und Institutionen führt zu einem intensiven Austausch von Leistungen, die in einem gewissen Sinne alle von allen abhängig macht. Im Zuge der Globalisierung hat sich die regionale Abhängigkeit in eine weltweite Abhängigkeit entwickelt.
Die Tit-for-Tat-Strategie wird häufig angewandt, um reziproke Beziehungen aufzubauen. Sie beinhaltet, dass die Vorgabe des ersten Akteurs durch eine kooperative Handlung gekennzeichnet ist. In den weiteren Handlungen findet eine Spiegelung der Wahlen der Interaktionspartner statt. Handelt der andere kooperativ, antwortet der Akteur mit Kooperation. Handelt der andere mit Wettbewerb, reagiert auch der Akteur wettbewerbsorientiert. Durch die Verwendung der Norm der Reziprozität werden im Regelfall kooperative soziale Beziehungen aufgebaut. Die Bewältigung der Vertrauensfrage beruht auf der Reziprozität kooperativer Wahlen. Reziprozität ist die Voraussetzung für einen florierenden Austausch. Die Regel der Reziprozität stellt eine soziale Norm dar, die kulturübergreifende Gültigkeit besitzt.
Freundschaft/Feindschaft in Beziehungen
Freundschaft ist eine Sozialbeziehung, die zwischen zwei Personen in informeller Weise aufgebaut wird. Sie beruht wesentlich auf der Norm der Reziprozität. Man spricht dann von Freundschaft, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Freiwilligkeit, Stabilität über die Zeit, positiver Erlebnischarakter und sexuelle Neutralität (Auhagen 1993). In Freundschaften spielt die Kommunikation eine große Rolle. Freundschaften tragen dazu bei, dass die beteiligten Personen ihre Biographie rekonstruieren und ihre Selbst-Identität entwickeln. Bemerkenswert sind die geschlechtsspezifischen Besonderheiten. Für Frauen sind Freundschaften generell häufiger und wichtiger als für Männer (Giddens 1992).
Eine Feindschaft beruht auf Gegensätzlichkeit und Kontroverse, wie sie z. B. zwischen Binnengruppe und Außengruppe bestehen kann. Wenn die Gruppenbeziehung durch Feindschaft gekennzeichnet ist, kann sich ein permanenter Antagonismus bilden, bei der ethnozentrische Einstellungen vorherrschen (Campbell 1967). Feindseligkeit zwischen Gruppen ist nicht immer das Ergebnis der Gegenüberstellung von Binnengruppe und Außengruppe, sondern hängt auch von der Natur der Begegnung der Gruppen ab. Konflikte sind dann zu erwarten, wenn die Interessen kollidieren. Bei einer potenziellen Inkompatibilität der Interessen und Ziele der Gruppen nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Beziehung antagonistischer gestaltet wird (Fritsche/ Kessler 2008). Diese zuletzt genannte Kennzeichnung lässt sich auch auf individuelle Feindschaften übertragen. Je mehr die Personen Interessenkonflikte haben oder sich mit Gruppen solidarisieren, die Interessenkonflikte aufweisen, desto eher kann eine Feindschaft zwischen ihnen entstehen.
Feindselige Konflikte entstehen häufig dadurch, dass das subjektive Empfinden von Unvereinbarkeit gegeben ist. Vielfach wird der Aspekt der subjektiven [63]Einschätzung betont. Denn wie eine potenzielle Konfliktsituation kognitiv interpretiert wird, hat einen erheblichen Einfluss auf den Konfliktverlauf. Unter Entstehungsbedingungen von sozialen Konflikten sind Äußerungen von Absichten zu fassen, der Mangel an Vertrauen sowie die Erfahrung der relativen Deprivation. Mit Letzterer sind Enttäuschung und Empörung über die Benachteiligung verbunden, die die Wahrscheinlichkeit von Konflikten erhöhen (Baros 2004). Feindschaften werden auch durch ein Null-Summen-Denken gefördert, wie es der Wettbewerbseinstellung entspricht: Der irrationale Glaube daran, dass es nur Gewinner und Verlierer geben kann, trägt zur Konflikteskalation bei.
Eskalationsprozesse müssen nicht Stufe auf Stufe ablaufen, sondern entwickeln sich häufig nach dem Motto, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Wichtig ist auch, dass die Konfliktparteien sich in ihrem Eskalationsverlauf unterscheiden, da eine Partei eine höhere Eskalationsstufe erreicht hat als die andere.
Konstruktive Konfliktbearbeitung beruht darauf, dass anstelle eines Null-Summen-Denkens das Prinzip der graduellen Verbesserung gestellt wird. Konfliktmanagement ist ergebnisorientiert und zielt auf tragfähige Win-win-Lösungen. Die Erreichung solcher Lösungen kann durch Mediation von dritter Seite erleichtert werden (Montada/Kals 2007).
Paarbeziehungen
In Paarbeziehungen bezeichnet Liebe eine kulturabhängige Vorstellung. Man kann vier Komponenten der westlichen Vorstellung von Liebe unterscheiden:
Idealisierung des Partners
Überraschender Beginn (»Liebe auf den ersten Blick«)
Auftreten physiologischer Erregung (»Schmetter linge im Bauch«)
Projektion einer langfristigen Bindung verbun den mit Opferbereitschaft.
Liebe wird aufgrund empirischer Ergebnisse als emotionale Basiskategorie bezeichnet. Die Auswertung von philosophischen und literarischen Schriften des Abendlands führt zu der Identifikation der folgenden Bedeutungen der Liebe:
Physische/emotionale Abhängigkeit vom Partner
Wunsch danach, den Partner zu umsorgen
Vertrauen in den Partner.
Nach Barnes und Sternberg (1997) kann man zwischen leidenschaftlicher und kameradschaftlicher Liebe unterscheiden. Unter die erstgenannte Form fallen die romantische, besitzergreifende und spielerische Liebe. Unter die letztgenannte Form lassen sich pragmatische, freundschaftliche und altruistische Liebe einordnen (vgl. Rohmann et al. 2012).
Empirische Studien von Bierhoff und Schmohr (2004) lassen erkennen, dass es eine allgemeine Entwicklungssequenz der Liebe gibt, wonach die besitzergreifende und die altruistische Liebe bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren überwiegt, während junge Erwachsene romantische Liebe und freundschaftliche Liebe bevorzugen (zusätzlich zur altruistischen Liebe). Im weiteren Verlauf der Beziehung nimmt die Bedeutung von altruistischer, pragmatischer und freundschaftlicher Liebe zu, während die Bedeutung der spielerischen Liebe abnimmt. Romantische und besitzergreifende Liebe bleiben bis zum mittleren Erwachsenenalter relativ unverändert. Das deutet darauf hin, dass kameradschaftliche (z. B. freundschaftliche) und leidenschaftliche (z. B. romantische) Liebe parallel hoch ausgeprägt sein können und gleichermaßen zur Initiierung und Aufrechterhaltung einer Beziehung beitragen.
Geschäftsbeziehungen
Geschäftsbeziehungen finden typischerweise zwischen Organisationen statt. Ein Beispiel ist die Beziehung zwischen einer Organisation, die als Kunde auftritt, und einer, die als Lieferant zur Verfügung steht. Geschäftsbeziehungen zeichnen sich durch ein Commitment aus, das unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Z. B. kann der Kunde ein enges Commitment an den Lieferanten entwickeln.
Für Geschäftsbeziehungen ist außerdem das Vertrauen zwischen den Partnern von großer Bedeutung (Shapiro et al. 1992). Grundsätzlich lassen sich drei Stufen des Vertrauens unterscheiden: Vertrauen als kalkuliertes Risiko (Vertrauen hängt von erwarteten Belohnungen und Kosten ab), Vertrauen aufgrund von Vorerfahrungen mit dem anderen (Vertrauen ist eine Funktion der Verhaltenskonsistenz des anderen) und Vertrauen, das auf gemeinsamen Projekten und einer früheren Transaktion beruht (Vertrauen durch Identifikation).
[64]Literatur
Argyle, Michael; Henderson, Monika, 1990: Die Anatomie menschlicher Beziehungen, München. – Auhagen, Ann E., 1993: Freundschaft unter Erwachsenen; in: Dies.; Salisch, Maria von (Hg.): Zwischenmenschliche Beziehungen, Göttingen, 215–233. – Barnes, Michael L.; Sternberg, Robert, 1997: A hierarchical model of love and its prediction of satisfaction in close relationships; in: Sternberg, Robert; Hojjat, Mahzad (Hg.): Satisfaction in close relationships, New York, NY, 79–101. – Baros, Wassilios, 2004: Konfliktbegriff, Konfliktkomponenten und Konfliktstrategie; in: Sommer, Gert; Fuchs, Albert (Hg.): Krieg und Frieden, Weinheim, 208–221. – Bierhoff, Hans-Werner, 2006: Sozialpsychologie, Stuttgart. – Ders.; Jonas, Eva, 2011: Soziale Interaktion; in: Frey, Dieter; Bierhoff, Hans-Werner (Hg.): Sozialpsychologie. Interaktion und Gruppe, Göttingen, 131–159. – Ders.; Schmohr, Martina, 2004: Romantic and marital relationships; in: Lang, Frieder R.; Fingerman, Karen L. (Eds.): Growing together, Cambridge, NY, 103–129. – Blau, Peter M., 1964: Exchange and power in social life, New York, NY. – Campbell, Donald T., 1967: Stereotypes and the perception of group differences; in: American Psychologist 22, 817–829. – Elias, Norbert, 1997: Über den Prozess der Zivilisation (Bd. 1), Frankfurt a. M. – Ders., 2009: Was ist Soziologie?, Weinheim. – Fritsche, Immo; Kessler, Thomas, 2008: Die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts; in Peterson, Lars E.; Six, Bernd (Hg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung, Weinheim, 214–222. – Giddens, Anthony, 1992: The transformation of intimacy, Cambridge, UK. – Montada, Leo; Kals, Elisabeth, 2007: Mediation, Weinheim. – Rohmann, Elke et al., 2012: Grandiose and vulnerable narcissism. Self-construal, attachment, and love in romantic relationships; in: European Psychologist 17, 279–290. – Shapiro, Debra L. et al., 1992: Business on handshake; in: Negotion Journal 8, 365–377. – Worsley, Peter, 1970: Introducing sociology, Harmondsworth, UK.
Hans-Werner Bierhoff
Bias
Bias (engl. für »Verzerrung«) bezeichnet ein verzerrtes Abbild der Wirklichkeit, verursacht durch systematische oder zufällige Fehler.
In der Empirie spricht man von Verzerrungen, wenn Forschungsergebnisse (beispielsweise von Umfragen) nicht die tatsächlichen Meinungen, d. h. nicht den »wahren Wert« abbilden und somit (Teil-) Ergebnisse über- bzw. unterschätzt werden. Auftreten können diese Abweichungen in quantitativen und qualitativen Untersuchungen unter anderem bei der Stichprobenauswahl (Selection-Bias), bei Selbstauskünften von Befragten (z. B. Non-Response-Bias oder infolge von sozialer Erwünschtheit), aber auch durch die Untersuchungsperspektive der Forschenden (z. B. Bestätigungs-Bias). In der Statistik beschreibt eine Verzerrung der Schätzfunktion (Estimation-Bias) die Differenz zwischen dem Schätzwert aus der Stichprobe und dem wahren Wert in der Population. Erwartungstreue Schätzfunktionen haben per Definition einen Bias von 0 (Unverzerrtheit).
Anders als zufällige Fehler können systematische Verzerrungen nicht durch (theoretisch unendlich) viele Messungen aufgehoben werden; allerdings können z. B. der Einsatz valider Messverfahren, eine Standardisierung der Erhebung oder Interviewerschulung Verzerrungen reduzieren.
Literatur
Diekmann, Andreas, 2009: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen, 20. Aufl., Reinbek. – Schnell, Rainer et al., 2011: Methoden der empirischen Sozialforschung, 9. Aufl., München.
Silke Kohrs
Bildungssoziologie
Die Bildungssoziologie (engl. sociology of education) beschäftigt sich – trotz der teilweise mit dem Begriff Bildung verbundenen essentialistischen Diskussionen – vor allem mit den inneren Strukturen und den Ergebnissen des Bildungssystems. Im Mittelpunkt der Forschung stehen dabei das Verhältnis von Bildung und Arbeitswelt, die Effizienz der Schule sowie unterschiedlicher Bildungssysteme und insbesondere das Problem der sozialen Ungleichheit und der Rolle der Bildung und der Bildungssysteme bei der Perpetuierung derartiger (Ungleichheits-) Strukturen sowie schließlich mögliche Änderungspotentiale. Hierbei werden immer die ökonomischen, kulturellen, politischen und sozialstrukturellen Bedingungen dieser Prozesse mitgedacht und untersucht (Kopp 2009; Becker 2009). Die Zahl, vor allem aber auch die Rezeption bildungssoziologischer Studien unterliegt dabei großen Schwankungen. Während in Westdeutschland im Anschluss an die Arbeiten von Dahrendorf (1965) bis in die Mitte der 1970er Jahre eine rege Diskussion zu finden ist,[65] ist danach eine relativ lange Latenzphase zu beobachten, die erst wieder durch die Studien von Shavit und Blossfeld (1993) sowie Müller und Haun (1994) beendet wird. Seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 ist die Bildungsforschung eines der am stärksten beachteten Felder innerhalb der Soziologie. Dies ist sicherlich auch dadurch begründet, dass mit dem Thema Bildung eine der genuinen Fragestellungen der Soziologie, die Beschäftigung mit den Gründen sozialer Ungleichheit (Berger 2005) wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Die wohl zunehmende Bedeutung von Bildung für die soziale Platzierung und die vielfältig zu findenden unterschiedlichen Chancen im Bildungssystem vor allem im Bezug zur sozialen Herkunft machen das zunehmende Interesse an bildungssoziologischen Fragestellungen verständlich. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass gerade in Anbetracht des demographischen Wandels die Funktion von Bildung im ökonomischen Prozess insbesondere in modernen Industriegesellschaften wohl immer wichtiger wird.
Historische Entwicklung und die Anfänge der Bildungsforschung in der Bundesrepublik
Ein erster Blick richtet sich auf die institutionelle Ausgestaltung des Bildungsbereiches und damit meist auf die historische Entwicklung und die aktuelle Situation des Bildungssystems. Bedingt durch ihre föderale Struktur weist die Bundesrepublik eine nur schwer nachvollziehbare Vielfalt der einzelnen Bildungsinstitutionen auf (vgl. für den Versuch eines Überblickes Cortina et al. 2008). Von besonderem Interesse ist dabei, dass die wesentlichen Züge des aktuellen Bildungssystems – die nahezu überall zu findende deutliche horizontale Gliederung des Bildungssystems mit einer frühen Entscheidung für einen bestimmten Bildungsgang sowie meist relativ geringen Übergangschancen, die Trennung zwischen einer grundständigen Ausbildung und einer Schulbildung als Vorbereitung für ein akademisches Studium, die territoriale Unterschiedlichkeit des Bildungssystems, aber auch die klare Trennung in der Ausbildung der Lehrkräfte für die einzelnen Bildungsgänge – ihre Wurzeln weit im 19. Jh. haben und trotz aller politischen Krisen und Umbrüche des 20. Jh.s eine erstaunlich hohe Persistenz bis in die heutige Zeit aufweisen (Herrlitz et al. 1998).
Soziologische Aufmerksamkeit kommt Bildung jedoch nicht nur durch ihre Institutionen zu, sondern vor allem durch ihre gesellschaftlichen Funktionen. Ausgehend von der Idee einer geordneten und systematischen gesellschaftlichen Entwicklung galt Bildung etwa bei Talcott Parsons als Universalie im Rahmen des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses und als charakteristisches Differenzierungsmerkmal moderner, ausdifferenzierter Gesellschaften. Wenn man von einigen eher kultursoziologischen Studien im Anschluss an die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges absieht, die sich mit der Entstehung der Barbarei in einer selbst so definierten Bildungsnation befassten und den daraus zu ziehenden Konsequenzen beschäftigten (Adorno 1969), waren jedoch die empirischen Diagnosen von Georg Picht, Hansgert Peisert und – sicherlich am bekanntesten – Ralf Dahrendorf zur (ungleichen) Bildungsbeteiligung in der Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre bahnbrechend für eine empirisch orientierte Bildungsforschung. Diese führte u. a. zur Gründung eines Max-Planck-Instituts. Während die ersten Arbeiten noch vor allem auf die starken regionalen Unterschiede und die vermuteten Bildungsreserven hinwiesen (hierbei ging es unter anderem um das wirtschaftliche Entwicklungspotential), rückten mit den Studien von Peisert und Dahrendorf die »soziale Lage und die Bildungschancen in Deutschland« in den Mittelpunkt. Bei diesen Analysen lässt sich Bildungsungleichheit in vier Dimensionen zeigen: neben den schon erwähnten regionalen Mustern, die vor allem auch eine Stadt-Land-Differenzierung abbilden, zeigen sich konfessionelle Unterschiede, ungleiche geschlechtsspezifische Bildungschancen sowie schließlich eben auch dramatische Unterschiede hinsichtlich der sozialen Herkunft. Zusammenfassend wurde hierbei von der Problematik des ›katholischen Arbeitermädchens auf dem Lande‹ gesprochen.
Diese auch große öffentliche Aufmerksamkeit erzeugende Untersuchungen waren der Beginn einer weitreichenden Diskussion über die sogenannte Bildungskatastrophe, die die Veränderung und hierbei vor allem den historisch unvergleichbaren Ausbau des Bildungssystems, der bereits seit den späten 1950er Jahren in der alten Bundesrepublik zu beobachten war, begleitete, wenn auch nicht verursachte. Die unterschiedliche Bildungsbeteiligung wurde dabei als Gefahr für die Gestaltung einer offenen und modernen Gesellschaft, als ökonomisches Entwicklungsrisiko aufgrund fehlenden Fachpersonals[66] mit qualifizierten Kenntnissen und schließlich als soziales Problem wahrgenommen, da hierdurch soziale Mobilität und das Prinzip der Meritokratie beeinträchtigt werden. Obwohl sicherlich die ökonomischen Argumente die größte Rolle beim Ausbau des Bildungssystems spielten, kam auch der soziologischen Argumentation bei der Akzeptanz dieser Maßnahmen eine Bedeutung zu. Theoretisch kann Bildung dabei als Investition in Humankapital angesehen werden, das wiederum in verschiedenen Bereichen produktiv eingesetzt beziehungsweise in andere Kapitalien im Bourdieuschen Sinne umgewandelt werden kann. Variierende Bildungsbeteiligungen sind dann als unterschiedliche Investitionsstrategien zu verstehen. Alternativ lassen sich diese Unterschiede jedoch auch auf soziale Schließungsmechanismen und als Ergebnis sozialer Konflikte interpretieren. Der Zugang zu Bildungsabschlüssen wird erschwert und beispielsweise von der Verwendung bestimmter Sprachcodes abhängig gemacht. Wenn Bildungszertifikate allein nicht mehr den Zugang zu angestrebten sozialen Positionen eröffnen, werden nichtfunktionale und sogenannte feine Unterschiede im Sinne Bourdieus als Distinktionsmechanismus eingesetzt.
Die Bildungssoziologie der 1970er und 1980er Jahre hatte einen Schwerpunkt bei der Erforschung der schulinternen Mechanismen, die diese Bildungsungleichheiten in der Schule reproduzieren. Hierbei wurde auf unterschiedliche Sozialisationserfahrungen, Erwartungen und Denk- sowie Verhaltensweisen, aber eben – wie gerade erwähnt – auch auf die schichtspezifische Verwendung bestimmter Sprachcodes (restringierter versus elaborierter Sprachcode) und deren unterschiedliche Einsetzbarkeit in Bildungsinstitutionen verwiesen. Begleitet wurde diese Diskussion durch einen enormen Ausbau des Bildungssystems und eine historisch einzigartige Bildungsexpansion. Als Ergebnis dieser Prozesse lässt sich ein deutlicher Rückgang der regionalen Unterschiede und damit einhergehend der Konfessionsunterschiede feststellen. Während bis in die 1970er Jahre noch deutlich schlechtere Bildungsergebnisse von Mädchen zu beobachten waren, hat in diesem Bereich eine Umkehr der Verhältnisse stattgefunden: der Frauenanteil in weiterführenden Schulen, aber auch an den Universitäten liegt über 50 Prozent, wobei sich jedoch immer noch deutlich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen etwa bei der universitären Ausbildung finden.
Während die aktuellen Befunde auch für das wiedervereinigte Deutschland Gültigkeit beanspruchen, muss die historische Entwicklung für die DDR gesondert betrachtet werden (vgl. Kopp 2009). Hier wurde nach 1945 ein einheitliches und eben nicht föderal zersplittertes Schulsystem aufgebaut, dessen Kern zuerst eine verbindliche achtjährige Grundschule war, die – und das war nicht selbstverständlich – koedukativ unterrichtete. Anschließend stellte eine vierjährige Oberschule einen, aber nicht den einzigen Weg zur Hochschulreife dar. Unterstützt wurde dieses zentralisierte Schulbildungssystem durch die konsequente und nahezu flächendeckende Einrichtung von Institutionen der Vorschulerziehung wie Kinderkrippen und -gärten, die selbstverständlich als Ganztageseinrichtungen konzipiert waren. Aussagen zur sozialen Selektivität des Schulsystems in der DDR sind aufgrund der stark eingeschränkten Datenlage nur schwer möglich. Versuche der positiven Diskriminierung von Kindern aus der Arbeiterklasse in den frühen Jahren der DDR beinhalteten eine gezielte Benachteiligung von Kindern bürgerlicher Schichten und religiös gebundener Bevölkerungsteile. Zu bedenken ist jedoch auch, dass der Zugang zu höherer Bildung im Rahmen der Planwirtschaft auch quantitativ gesteuert und vor allem stark eingeschränkt wurde und dass später Bildungsprivilegien der sog. sozialistischen Intelligenz zunahmen und man deshalb durchaus von einer sozialen Schließung des Bildungssystems sprechen kann. Mit dieser anfänglichen sozialen Öffnung des Bildungssystems und der daran anschließenden Zunahme sozialer Ungleichheiten spiegelt sich in der DDR ein Muster wider, das auch in anderen sozialistischen Staaten zu beobachten war (Shavit/Blossfeld 1993).
Bildung und soziale Herkunft
Während sich hinsichtlich der regionalen, konfessionellen und geschlechtsspezifischen Unterschiede also eine rasche Angleichung der Bildungserfolge beobachten lässt, sind die Befunde hinsichtlich der sozialen Selektivität der Bildung wesentlich unklarer und uneinheitlicher. Zwar hat die Bildungsbeteiligung in den unteren sozialen Schichten zugenommen, es ist jedoch offen, ob sich die Ungleichheitsrelationen auch verändert haben oder ob nicht vielleicht die Bildungsbeteiligung der oberen Schichten noch stärker gestiegen ist. Genau mit diesen Fragen beschäftigen[67] sich verschiedene Studien aus den 1990er Jahren, wobei die Entwicklungen sowohl in der Bundesrepublik wie auch im internationalen Vergleich beobachtet wurden (Shavit/Blossfeld 1993; Müller/Haun 1994). Generell lässt sich als ein Ergebnis dieser Untersuchungen festhalten, dass trotz der nahezu in allen Ländern und auch in allen sozialen Schichten feststellbaren gestiegenen Bildungspartizipation und einigen Egalisierungsentwicklungen immer noch – teilweise sogar dramatische – Ungleichheiten zu konstatieren sind. Darüber hinaus gibt es Befunde, die eine Verschiebung der Trennungslinie vom Übergang Hauptschule versus Realschule und Gymnasium hin zum Übergang Hauptschule beziehungsweise Realschule versus Gymnasium – also einen Fahrstuhleffekt sozialer Ungleichheit – vermuten lassen.
Die aktuelle bildungssoziologische Diskussion ist durch Spekulationen über den Einfluss der konkreten Organisation des Schulsystems geprägt. Schon in den 1970er Jahren wurde versucht, mit Hilfe der Einführung der Gesamtschulen der sozialen Selektivität von Bildung entgegenzusteuern. Hierzu wurden konkrete Bildungsreformen durchgeführt, die unter anderem die Einführung von integrierten Gesamtschulen als Regelschule umfassten. Der politische Widerstand gegenüber diesen Maßnahmen war allerdings so groß, dass diese Versuche wieder zurückgenommen werden mussten, bevor die begleitenden sozialwissenschaftlichen Evaluationen beendet und ihre relativ klaren und vor allem positiven Ergebnisse veröffentlicht werden konnten. Dabei sind diese Ergebnisse mit neueren Leistungstests nicht vergleichbar, da im heutigen Bildungssystem Gesamtschulen eine Option unter vielen, aber eben keine Regelschule darstellen und somit Prozesse der Selbstselektion zu beobachten sind (Fend 1982).
Bildungsleistungen im internationalen Vergleich
Die sicherlich in den letzten Jahren am häufigsten diskutierte bildungssoziologische Untersuchung stellt die sogenannte PISA-Studie dar, deren Ziel es war, vergleichende Daten über die Ressourcenausstattung, individuelle Nutzung sowie Funktionsund Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme zur Verfügung zu stellen. Ausgangspunkt war der Versuch, die Vermittlung bestimmter Basiskompetenzen in einzelnen Wissensbereichen zu überprüfen. Im Einzelnen stehen die Lesekompetenz, eine mathematische und eine naturwissenschaftliche Grundbildung 15-jähriger Jugendlicher im Mittelpunkt von PISA. Die öffentliche Diskussion fokussierte sich eher auf die Rangordnung der einzelnen Länder, Ursachen für die unterschiedlichen Platzierungen lassen sich aus den Daten aber nur schwer ableiten. Bildungssoziologisch relevanter ist aber die dabei zu Tage tretende große Streuung der Leistungen innerhalb der Bundesrepublik. Wenn man die Verteilung der Schüler und Schülerinnen auf fünf Kompetenzstufen betrachtet und davon ausgeht, dass vor allem Schüler, die bereits mit den Aufgaben der ersten Stufe Probleme aufweisen, eine besondere Risikogruppe darstellen, so zeigt sich rasch, dass in der Bundesrepublik besonders Kinder mit einem Migrationshintergrund in diese Risikogruppe fallen. Es zeigt sich zudem, dass diese Schüler sich konzentriert in Hauptschulen wiederfinden – und dort auch verbleiben. Darüber hinaus lassen sich auch mit den Daten von PISA einige bekannte Tatsachen über die soziale Ungleichheit von Bildungschancen replizieren. So interessant diese Befunde auch sind, wirklich überraschen konnten sie aufgrund der zuvor skizzierten Forschungsergebnisse nicht mehr. Die Befunde erneuern bekannte Ergebnisse und Probleme.
Bildung und ethnische Herkunft
Gerade auch in den PISA-Untersuchungen wird immer wieder auf die dramatische Ungleichheit hinsichtlich einer ethnischen Dimension hingewiesen. Auch in diesem Bereich kann man auf einige bahnbrechende Studien in den Vereinigten Staaten hinweisen wie beispielsweise die Untersuchung »Equality of Educational Opportunity«, in der unter der Leitung von James S. Coleman die Ursachen für die dramatischen Unterschiede im Bildungsniveau zwischen farbigen und weißen Schülern im Auftrag des amerikanischen Präsidenten geklärt werden sollen (vgl. Kopp 2009 für eine ausführliche Darstellung). Trotz aller im Nachhinein diskutierbaren methodischen Probleme wurde als wichtigste Ursache die fehlende ethnische Heterogenität der Schulen ausgemacht und durch konkrete sozialpolitische Maßnahmen – das sogenannte busing – in Angriff genommen. Auch in der Bundesrepublik finden sich in der Zwischenzeit erste Ergebnisse, die die Zusammensetzung beziehungsweise die hohe Segregation der Schulklassen als wichtigen Faktor des Bildungserfolges [68]diagnostizieren. Weiterhin wird auf die Bedeutung eines frühzeitigen Spracherwerbs hingewiesen. Gerade in diesen Bereichen besitzt die Bildungsforschung evaluativen Charakter für die verschiedensten schulpolitischen Maßnahmen (vgl. als weiteres Beispiel die Studie von Bowen und Bok (1998) über die Folgen der affirmative action bei der Zulassung zu Colleges und Universitäten in den Vereinigten Staaten).
Aktuelle Entwicklungen der Bildungsforschung
Die Schwierigkeiten der empirischen Bildungsforschung in der Bundesrepublik und die zunehmende Bedeutung von Bildung im Lebensverlauf haben zur Initiierung des Deutschen Bildungspanels (NEPS: National Educational Panel Study) geführt. In dieser Studie werden seit 2009 Längsschnittdaten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen und Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und informellen Kontexten über die gesamte Lebensspanne erhoben. Zusammen mit einer zunehmend theoretisch beleuchteten Analyse der Bildungsentscheidungen der verschiedenen Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems (vgl. etwa Breen/Goldthorpe 1997) erscheinen hierdurch die bildungssoziologischen Fragen dauerhaft gut beantwortbar.
Literatur
Adorno, Theodor W., 1969: Stichworte, Frankfurt a. M. – Becker, Rolf (Hg.), 2009: Lehrbuch der Bildungssoziologie, Wiesbaden. – Berger, Johannes, 2005: »Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen«. Zur Vergangenheit und Gegenwart einer soziologischen Schlüsselfrage; in: Zeitschrift für Soziologie 33, 354–374. – Bowen, William G.; Bok, Derek, 1998: The Shape of the River. Long-Term Consequences of Considering Race in College and University Admissions, Princeton. – Breen, Richard; Goldthorpe, John H., 1997: Explaining Educational Differentials. Towards a Formal Rational Choice Theory; in: Rationality and Society 9, 275–305. – Cortina, Kai S. et al. (Hg.), 2008: Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Überblick, Reinbek. – Fend, Helmut, 1982: Gesamtschule im Vergleich. Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs, Weinheim/Basel. – Herrlitz, Hans-Georg et al., 1998: Deutsche Schulgeschichte von 1800 bis zur Gegenwart. Eine Einführung. 2. Aufl., Weinheim/München. – Kopp, Johannes, 2009: Bildungssoziologie, Wiesbaden. – Müller, Walter; Haun, Dietmar, 1994: Bildungsungleichheit im sozialen Wandel; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 46, 1–42. – Shavit, Yossi; Blossfeld, Hans-Peter (Hg.), 1993: Persisting Inequality: Changing Educational Stratification in Thirteen Countries, Boulder.
Johannes Kopp
Biographieforschung
Biographieforschung (engl. biographical research) ist eine insbesondere in der Soziologie (Rosenthal 2005; Völter u. a. 2005), aber auch in den Erziehungswissenschaften (Krüger, Marotzki 1999) national und international etablierte Teildisziplin mit einer eigenen genuinen Theoriegrundlage und Methodologie, die in der Bundesrepublik in erster Linie auf dem Sozialkonstruktivismus in der Tradition von Peter L. Berger und Thomas Luckmann und interpretativen Methoden gründet. Zentrales Anliegen der soziologischen BF ist es, der gegenseitigen Konstitution von Individuen und Gesellschaften gerecht zu werden. Lebensgeschichtliche und kollektivgeschichtliche Prozesse werden in ihren »Wechselwirkungen« und unhintergehbaren Verflechtungen empirisch untersucht. Biographie wird also nicht als etwas rein Individuelles oder Subjektives, sondern als ein soziales Konstrukt verstanden, das auf kollektive Regeln, Diskurse und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verweist und sowohl in seiner Entwicklung als auch im deutenden Rückblick der AutobiographInnen immer beides zugleich ist: ein individuelles und ein soziales Produkt. Mit einem biographietheoretischen Ansatz sind neben dem von den Biographien und Handlungsgeschichten von Individuen ausgehenden Versuch, diesen »Wechselwirkungen« gerecht zu werden, noch zwei weitere Prämissen verbunden. Zum einen ist es die Forderung danach, Bedeutungen von Erfahrungen nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang der Lebensgeschichte zu interpretieren, und zum anderen der Anspruch einer Prozessanalyse, die den historischen Verlauf der Entstehung, Aufrechthaltung und Veränderung von sozialen Phänomenen im Kontext von Lebensverläufen rekonstruiert.
Datenmaterial
Neben meist in biographisch-narrativen Interviews erzählten bzw. präsentierten Lebensgeschichten sind auch niedergeschriebene und veröffentlichte Autobiographien,[69] biographische Thematisierungen in Alltags- oder Organisationskontexten, (familien-) biographische Dokumente (Fotoalben, Tagebücher oder Briefe etc.) und personenbezogene Akten (Lebensläufe in Gerichtsverfahren, Personalakten in Parteien, Anamneseakten etc.) und die Kombination dieser Materialien die Datengrundlage für die Rekonstruktion sozialen Handelns (sowie Erlebens) und sozialer Milieus in ihrer Entstehungsgeschichte.
Ziele
Das Anliegen biographischer Forschung kann in unterschiedliche Ziele differenziert werden. Zum einen geht es um die Analyse des gelebten Lebens bzw. spezifischer Lebensbereiche oder -phasen von bestimmten Personengruppen oder gesellschaftlichen Gruppierungen in bestimmten historischen Zeiträumen (z. B. die klassische Untersuchung von Thomas und Znaniecki zu polnischen Migranten in den USA oder Studien zu bestimmten Jugendszenen). Zum anderen geht es um die Rekonstruktion bestimmter sozialer Settings aus der Perspektive der Handelnden in spezifischen historischen Epochen und soziokulturellen Kontexten (z. B. eine Milieustudie über einen sozialen Brennpunkt in einer Großstadt). Ein weiteres Ziel ist die Analyse biographischer Selbst- und Fremdthematisierungen in sozialen Interaktionen (z. B. biographische Thematisierungen von Klient/innen auf Ämtern). Für die gegenwärtige soziologische Biographieforschung sind weitere wichtige Anliegen die Analyse der biographischen Konstruktionen und der biographischen Selbstpräsentation in der Gegenwart (z. B.: Was sind die Regeln biographischer Selbstthematisierungen von Überlebenden kollektiver Gewalt aus Bosnien oder von ehemaligen Psychiatriepatienten?) und, damit verbunden, die Rekonstruktion der Genese und Transformationen dieser Konstruktionen. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, inwiefern biographische Thematisierungen in der Vergangenheit in bestimmten Settings (wie z. B. ein Asylverfahren oder auch Gespräche in der Psychiatrie) einen nachhaltigen Einfluss auf die Konstruktionen in der Gegenwart in anderen sozialen Kontexten und Situationen haben. Des Weiteren zielt biographische Forschung auf Konzeptionen für eine biographische Diagnostik sowie biographische Gesprächsführung in diversen Praxisfeldern ab.
Biographisch-narrative Interviews und Biographische Fallrekonstruktionen
Fritz Schütze (1983) entwickelte in den 1970er Jahren die Technik des narrativen Interviews sowie eine Methode der textanalytischen Auswertung erzählter Lebensgeschichten. Die Methoden der narrativen Gesprächsführung wurden seither, insbesondere was die Nachfragetechniken betrifft, weiterentwickelt und in unterschiedlichen Forschungs- sowie Beratungskontexten erprobt (Rosenthal 1995, 186–207). Im Interview werden die Befragten zunächst zur ausführlichen Erzählung ihrer Familien- und Lebensgeschichte oder bestimmter Phasen und Bereiche ihres Lebens aufgefordert, und erst in der zweiten Phase des Gesprächs werden erzählgeneriende Nachfragen gestellt. Neben der von Schütze vorgestellten Text- und Erzählanalyse, bei der die Unterscheidung von Textsorten (Erzählung, Argumentation und Beschreibung) und die Analyse der Funktionen ihrer Verwendung eine wesentliche Rolle spielen, gibt es mittlerweile mehrere Modifikationen und Versuche der Verbindung mit anderen interpretativen Verfahren, insbesondere mit der Objektiven Hermeneutik von Ulrich Oevermann, wie sie z. B. von Bruno Hildenbrand, Monika Wohlrab-Sahr oder der Autorin vorgestellt wurden. Gemeinsam ist diesen Verfahren ihr rekonstruktives und sequenzielles Vorgehen. In der von der Autorin vorgestellten Methode biographischer Fallrekonstruktionen (Rosenthal 2005, 137–160, 173–198) ist es entscheidend, zwischen erzählter und erlebter Lebensgeschichte zu differenzieren und den beständigen Wandel von Bedeutungen im Lebensverlauf zu berücksichtigen. Um dies zu ermöglichen, ist es erforderlich, in getrennten Analyseschritten den biographischen Bedeutungen von Erlebnissen in der Vergangenheit und den Bedeutungen von Erinnerung und Präsentation in der Gegenwart nachzugehen. Einerseits wird versucht, die Chronologie der biographischen Erfahrungen im Lebensverlauf und deren Bedeutungen für den Biographen zu rekonstruieren. Andererseits wird die zeitliche Struktur der Lebenserzählung analysiert, d. h. der Frage nachgegangen, in welcher Reihenfolge, in welcher Ausführlichkeit und in welcher Textsorte die Biograph/innen ihre Erfahrungen im Kontext der Textproduktion (in einem Interview oder auch in einem anderen Rahmen, wie z. B. einem Familiengespräch oder einer niedergeschriebenen Biographie) präsentieren. [70]Bei diesem Analyseschritt, der sich auf die aktuelle Präsentation der Lebensgeschichte konzentriert, wird vor allem der Interaktionsverlauf zwischen Befragten und Zuhörern rekonstruiert.
Literatur
Fuchs-Heinritz, Werner, 2000: Biographische Forschung, Opladen. – Krüger, Heinz Hermann; Marotzki, Winfried (Hg.) (1999): Handbuch Biographieforschung, Opladen. – Rosenthal, Gabriele, 1995: Erlebte und erzählte Lebensgeschichte, Frankfurt a. M. – Dies., 2005: Interpretative Sozialforschung, Weinheim/München, Kap. 5.4. Narratives Interview und narrative Gesprächsführung, 137–160; Kap. 6. Biographieforschung und Fallrekonstruktionen, 161–198. – Schütze, Fritz, 1983: Biographieforschung und narratives Interview; in: Neue Praxis 3, 283–293. – Völter, Bettina et al. (Hg.), 2005: Biographieforschung im Diskurs, Wiesbaden.
Gabriele Rosenthal
Boykott
Boykott (engl. boycott) oder »Verrufserklärung« (bzw. Ächtung) bezeichnet primär ein wirtschaftliches und soziales Sanktionsmittel (benannt nach dem gleichnamigen irischen Gutsverwalter, der 1879/80 wegen seiner sozialen Härte allgemein geächtet wurde). Während der Früh- und Hochindustrialisierung diente er als Ersatz oder Ergänzung zu Streik und Aussperrung. So suchten Arbeiter, (zusätzlichen) Druck auf Unternehmer auszuüben durch organisierte Entziehung von Kaufbereitschaft (Warenboykott), z. T. auch durch Unterbindung des gesamten wirtschaftlichen Verkehrs; eine Steigerungsform stellen Blockaden dar, die dies auf direktem Weg, mit physischen Mitteln zu erreichen suchen. Unternehmer bedienten sich »schwarzer Listen«, um die Einstellung unliebsamer Arbeitnehmer (z. B. Agitatoren, Streikführer, Gewerkschaftskader) zu verhindern. Mit dem Ausbau der Gewerkschaften und der Institutionalisierung der Tarifautonomie verlor der Boykott als Mittel des industriellen Konflikts an Bedeutung.
Als politisches Druckmittel ist er weiterhin gebräuchlich (Boykott jüdischer Geschäfte durch die Nationalsozialisten 1933; Boykott südafrikanischer Produkte als Protest gegen die Apartheidpolitik). In neuerer Zeit kam es auch aus ökologischen Motiven zu organisierten Warenboykotts (z. B. gegen den Import von Robbenfellen oder Schildkrötenprodukten). Anwendung findet der Boykott als Störung und Unterbindung des wirtschaftlichen Verkehrs auch in den internationalen Beziehungen: Regierungen benutzen ihn als politisches Mittel gegen feindliche Staaten oder Staatengruppen.
Literatur
Binkert, Gerhard, 1981: Gewerkschaftliche Boykottmaßnahmen im System des Arbeitskampfrechts, Berlin. – Maschke, Richard, 1911: Boykott, Sperre und Aussperrung, Jena. – Schwittau, Georg., 1912: Die Formen des wirtschaftlichen Kampfes, Berlin.
Walther Müller-Jentsch
Bürgertum
Das Bürgertum (engl. bourgeoisie) bezeichnete in den europäischen Ständeordnungen den Dritten Stand. Der Begriff des Bürgers hingegen findet sich bereits in der Antike und verweist auf jene, die im Besitz der Bürgerrechte im Staat sind. Im Frühmittelalter kennzeichnete der Begriff jene, die sich um eine Burg ansiedelten, schließlich im Hochmittelalter die freien Bewohner der Städte, die sich zu einem Schwurverband zusammenschlossen und sich eine von der feudalen Grundherrschaft unabhängige kommunale Verwaltung erkämpft hatten. An der Spitze der Stadtgemeinde stand das Ratspatriziat aus Großkaufleuten und Adeligen, darunter das zünftische Handwerk, während die zunftlosen Gewerbe und das »kleine Volk« oft kein Bürgerrecht besaßen.
Die politische Macht des Bürgertums war im Gegensatz zu seiner wirtschaftlichen Stärke in den absolutistischen Staaten der Neuzeit gering. Es stellte zwar in der herrschaftsständischen Privilegienordnung den Dritten Stand neben Adel und Klerus dar, aber jene dominierten politisch und kulturell. Das Bürgertum orientierte sich am adeligen Lebensstil und strebte nach Adelstiteln. Erst allmählich entwickelte es eigene Lebensweisen und Wertvorstellungen, ein Bewusstsein von »Bürgerlichkeit«, das nach allgemeiner Anerkennung strebte, so dass man im 18. Jh. von der Entstehung einer Zivilgesellschaft bzw. bürgerlichen Gesellschaft sprach, die eine außerpolitische Sphäre des Privaten zwischen Familie und Staat war. In ihr stellten Besitz, Bildung und[71] individuelle Leistung die wesentlichen Werte dar, die überständische Kriterien des sozialen Aufstiegs darstellten.
Die Französische Revolution war eine bürgerliche Revolution, die sich aber aller Schichten bediente und zeitweise eine standeslose Bürgergesellschaft der »citoyens« ins Leben gerufen hatte (Labrousse). Obwohl die ständisch-aristokratische Herrschaftsstruktur das 19. Jh. überdauerte, bestimmten Ideen, Wertvorstellungen und Lebensstile des Bürgertums zunehmend die moderne Kultur und Bildung, ihre Ausrichtung auf Fortschritt und Wissenschaft. Es spaltete sich jedoch in das wohlhabende Besitzbürgertum und das oft von Armut bedrohte Bildungsbürgertum. Die Wirtschaftsbürger bezeichnete Karl Marx als Bourgeoisie und sah sie als die herrschende Klasse des Kapitalismus. Ihre Weltanschauung orientierte sich an Liberalismus und Individualismus, die auch die Kultur des Kapitalismus prägte (Sombart).
Der Begriff des Bürgertums kann, wie Weber meinte, daher in politischem, in ständischem oder in ökonomischem Sinn verstanden werden. Noch heute wird der Begriff »bürgerlich« mitunter zur Bezeichnung ideologischer Anschauungen und ökonomischer Lage eingesetzt.
In der Gegenwart macht sich jedoch auch eine Rückkehr zu einem mehr soziokulturellen Verständnis des Bürgerlichen bemerkbar. Die Existenz eines Bürgertums und sein Verhältnis zum »Mittelstand« sowie die Entstehung einer »neuen Bürgerlichkeit« werden in der Gegenwart diskutiert (Hettling/Ulrich; Budde et al.). Damit verbunden ist die Frage, inwieweit noch von einer bürgerlichen Gesellschaft gesprochen werden kann und in welchem Verhältnis diese zum Begriff einer freien, verantwortlichen und solidarischen »Bürgergesellschaft« (Fürstenberg) im Zeitalter der transnationalen Vernetzung und der globalen Migrationsbewegungen steht.
Literatur
Budde, Gunilla et al. (Hg.), 2010: Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter, Göttingen. – Fürstenberg, Friedrich, 2011: Die Bürgergesellschaft im Strukturwandel, Berlin. – Gall, Lothar, 1889: Bürgertum in Deutschland, Berlin. – Hettling, Manfred; Ulrich, Bernd (Hg.), 2005: Bürgertum nach 1945, Hamburg. – Labrousse, Ernest et al., 1979: Geburt der bürgerlichen Gesellschaft: 1789, Frankfurt. – Mommsen, Wolfgang J., 2000: Bürgerliche Kultur und politische Ordnung, Frankfurt. – Ruppert, Wolfgang, 1983: Bürgerlicher Wandel, Frankfurt. – Schäfer, Michael, 2009: Geschichte des Bürgertums, Köln/Wien/Graz. – Schulz, Andreas, 2005: Lebenswelt und Kultur des Bürgertums im 19. und 20. Jahrhundert, München. – Sombart, Werner, 1913: Der Bourgeois, München. – Weber, Max, 1958: Wirtschaftsgeschichte, München, 270 ff.
Gertraude Mikl-Horke
Bürokratie
Begriff
Der Begriff »Bürokratie« (engl. bureaucracy) wird seit dem 18. Jh. in einer polemischen Version vorgetragen; seit dem ausgehenden 19. Jh. koexistiert daneben ein begriffsgeschichtlicher Strang, in dem es um einen versachlichten, soziologischen Gebrauch mit theoretischer Unterlegung geht. Zwischen beiden Bestrebungen kam es jedoch bis in die Gegenwart hinein zu Verwischungen und Überlagerungen, bei denen z. B. der negative Beigeschmack des alltagssprachlichen Bürokratiebegriffs für beabsichtigte, implizite Wertungen nutzbar gemacht wird.
Doch der polemische Sprachgebrauch selbst war nie einheitlich. Im spätabsolutistischen Staat wurde er als Etikett für eine Machtverschiebung – weg von den Ständen, hin zu den zentralisierenden »Bureaus« der Zentralverwaltung – eingeführt, so ursprünglich bei Vincent de Gournay. Die Brechung alter Strukturen und Privilegien durch Zentralisation und Beamtenherrschaft blieb im 19. Jh. ein wichtiger Anstoß für Klagen über Bürokratie – bezeichnenderweise vor allem aus konservativer Sicht, die darin vor allem die Nivellierung durch abstrakt-gleiche staatliche Verfahren kritisierte (Jacoby 1969, 78 ff.). Somit wurden schon früh zumindest drei Varianten der Begriffsverwendung erkennbar: Bürokratie als Bezeichnung einer durch Verwaltung machtausübenden Kaste, als eine bestimmte Verfasstheit des Staatswesens und als die Spezifik der Verfahren und der Maßnahmen, die dabei auf die Gesellschaft angewandt werden. Schon dabei treten eigenartige Paradoxien auf: als »bürokratisch« wird ebenso häufig ein Staatshandeln, das träge und schablonenhaft auftritt (»red tape«), wie auch ein interventionistisches und bevormundendes Agieren gegenüber den Untertanen kritisiert. Der gemeinsame Nenner ist hier Erstarrung: die Herrschaft der Prozeduren und des am Status quo ansetzenden Eigensinns der Kompetenzverwalter. Mit diesem Akzent erhielt der polemische [72]Bürokratiebegriff eine besondere Schlagkraft in der Kritik an Systemen des »real existierenden Sozialismus«. Die Herrschaft der Kader, die in Zeiten der revolutionären Umwälzung sich noch auf zukunftsgerichtete und begeisternde Ideologien stütze, wandele sich nach der Machtstabilisierung in eine Herrschaft bürokratischer Funktionäre, die mit revolutionären Lippenbekenntnissen ihre Privilegien und die Erstarrung im Status quo verschleierten (vgl. Hegedüs 1981, 86 f.). Diese Kritik bewegte sich in der Kontinuität der Parteiensoziologie Robert Michels: Dieser beobachtete an der Sozialdemokratie im wilhelminischen Deutschland Verselbstständigungstendenzen der Funktionsträger bis hinab zur Ortsebene, für die sich die Routine der Amtswaltung und der kleinlichen Kompetenzwahrung vor die deklarierten, umwälzenden Ziele schiebt. Über dieser bürokratischen Verkrustung erhebt sich dann die Darstellungspolitik der akademischen Führungseliten. Nachrevolutionäre, sozialistische Systeme schließen jedoch in noch einer anderen Weise an die Widersprüche der alten Bewegungspolitik an. Subalternfunktionäre ebenso wie abgehobene Spitzenkader benötigen nämlich weiterhin den Anschein der ideengeleiteten Massenmobilisierung als Rechtfertigungsmuster. Darum etablieren sich regelmäßig aktivierende Massenorganisationen, die Pseudo-Partizipation bei erzwungener Mitgliedschaft betreiben und Aktivitäten zugunsten von Kultur, Infrastruktur oder Zivilschutz usw. kanalisieren. Solche Organisationen sind keine Anfechtung für die Kader und Eliten, sondern schaffen ihnen eine zusätzliche, ideologisch verbrämte Bestätigung (Kasza 1995, 26 ff.).
Bürokratie bei M. Weber
Diese Dialektik von Wandel und Beharrung ist mit dem wichtigsten Versuch, den Bürokratiebegriff der polemischen Verwendung zu entkleiden, gut beschreibbar. Max Weber hat die Umsetzungsleistung eines bürokratischen Verwaltungsstabs als wesensmäßig dem Idealtypus einer legalen Herrschaftspraxis und -legitimation zugeordnet. Gehorsam wird hier inhaltsunabhängig für Befehle geleistet, weil diese aus allgemeinen Regeln abgeleitet sind, denen sich auch die Befehlenden fügen. Die Prinzipien der Bürokratie – z. B. Einsetzung nach Fachqualifikation, Trennung von den Amtsmitteln, Aktenkundigkeit, vorstrukturierte Arbeitsteiligkeit, hierarchische Gehorsams- und Rechenschaftspflicht – unterbinden alles, was von der administrativen Regelorientierung ablenken könnte. Solche Apparate handeln nach abstrakten Gleichheitsgrundsätzen, sie negieren alte (ständische) Besonderheiten ebenso, wie dies Märkte und moderne Staatsverfassungen tun. Hier markierte Weber den »rationalen« Zug der Bürokratie: sie füge sich in eine neuzeitliche Weltordnung, die natürliche und gesellschaftliche Verhältnisse gesetzesförmig zu durchschauen und beherrschbar zu machen trachte. Außerdem sei der bürokratische Verwaltungsstab in seiner »neutralen« Instrumentalisierbarkeit bestens dafür geeignet, einheitlichen Willen auf große Organisationen, bis hinauf zum Nationalstaat, auszuüben. Damit aber macht sich der Apparat tendenziell unentbehrlich. Wegen des in der Bürokratie akkumulierten Fach- und Dienstwissens sah auch Weber die Gefahr, dass sich Diener in Herrscher verwandeln, dass dadurch selbst politische Umwälzungen nur einen Austausch des Spitzenpersonals brächten. Zudem war der bürokratische Arbeitsmodus für ihn kein Privileg des Staates, sondern charakterisiere alle hochorganisierten Zusammenhänge in Wirtschaft und Gesellschaft (was wiederum einen Ausstieg aus dem ineinander verzahnten Arbeits- und Herrschaftsmechanismus erschwere!).
Damit ist es auch mit Webers Kategorien möglich, Bürokratie als Grundlage organisatorischer Fehlentwicklungen zu bestimmen. Er selbst hat dies in eher zeitbezogenen Schriften getan, als er die Selbstrekrutierung der politischen Führung aus den Verwaltungsstäben heraus als Ursache für Kreativitätsverlust und Kastenwesen (z. B. im Wilhelminischen Reich) kritisierte.
Die Weber-Rezeption in der angelsächsischen Organisationssoziologie ab ca. 1930 übersah diesen Aspekt und missverstand das Rationalitätspostulat. Wollte Weber damit die Einordnung bürokratischer Elemente in den neuzeitlichen Rationalisierungsprozess verdeutlichen, so deuteten seine Kritiker »Rationalität« in die behauptete Leistungsfähigkeit dieser Elemente bei der Erfüllung einzelorganisatorischer Aufgaben um. Trotz ihrer Schieflage hat diese Kritik eine wichtige, empirisch fundierte Sicht auf Organisationen begründet (Morgan 1990, 63 ff.). Kernaussagen waren z. B. jeweils
ddass Steuerung durch strikte Regeln und Hierar chien nur in standardisierten, wiederkehrenden Aufgabenstellungen Erfolg garantiere;
[73]ddass gerade bei der Integration von professionel len Kompetenzen die Fixierung auf die offizielle, positionale Autoritätsstruktur zu starr sei;
ddass Organisationen von komplexeren Zielstrukturen angeleitet würden als nur durch die autoritativen Festlegungen seitens der Spitze;
ddass erfolgreiche, anpassungsfähige Verwaltungsführung Freiräume und eigenständige Umweltbeziehungen der nachgeordneten und dezentralen Einheiten zulassen müsse.
»Weberanische« Bürokratie wurde für diesen Argumentationsstrang zum Typus einer überformalisieren, überzentralisierten und überroutinisierten Organisationsgestaltung; sie wurde somit implizit in die Nähe einer tayloristischen Arbeitsgestaltung gerückt, in der menschliche Spielräume als zu tilgende Störfaktoren erscheinen. In politologischer Kritik erschien der Typ als Korrelat einer Verwaltungskontrolle, die allein auf Gesetzeseinhaltung poche und ein repräsentativ-zentralistisches Demokratieverständnis pflege.
Weitere Ansätze
In noch stärkerem Maße machte sich eine andere Theorievariante den negativen, alltagssprachlichen Klang des Bürokratiebegriffs zunutze. Es handelt sich dabei um Argumentationen auf der Grundlage von »public choice«-Prämissen, die Bürokratie als Kernform des nicht-marktlichen Entscheidens bestimmen. Diese Zuordnung impliziert, dass solches Entscheiden regelmäßig zu Fehlallokation und Überproduktion öffentlicher Güter neigend beschrieben wird, da ihr die Gegenmacht von unverfälschten Konsumentenwünschen und Preisbildung fehle.
Konkurrenz, wenn sie denn stattfindet, ist die der »Bureaus«, um die Anteile des öffentlichen Haushalts, mit denen günstige Beziehungen zu den fachspezifischen Umweltinteressen hergestellt werden, die selbst wieder (z. B. durch Lobbyismus) Vorteile suchen, für die die Allgemeinheit aufkommen muss. Kritik an Bürokratie meint in dieser Denkrichtung etwas Allgemeineres: nämlich die Verteilung von Vorteilen an Nutznießer, die ebenso wenig wie die Verteiler für die Kosten äquivalent aufkommen müssen (vgl. z. B. Mitchell/Simmons 1994). Nicht zufällig erlangte diese Sicht politische Popularität, als Wohlfahrtsstaaten und Umverteilungspolitiken über das demokratische Mehrheitsprinzip ab ca. 1980 von konservativen/libertären Bestrebungen geächtet wurden. Ausdruck dieser Ideologie waren Verwaltungsreformbestrebungen, die staatliche Leistungen privatisierten und staatliche Einrichtungen inneren oder äußeren Wettbewerbsanforderungen aussetzten (Suleiman 2003, 51 ff.).
Bürokratie wird ökonomisch als Produktivitätsverlust für den Auftraggeber »Steuerzahler« in seiner Gesamtheit verbucht; Therapie kann für diese Optik in spezifischeren, dezentralen Käuferbeziehungen gegenüber einzelnen öffentlichen Gütern bestehen: durch Privatisierung, Verpreisung usw. Die Interessen des Gesamtsteuerzahlers können aber auch zentral gegen den Eigensinn der Bürokratie und ihrer Klientenbeziehungen geltend gemacht werden. Dies ist das Thema der »principal-agent«-Fragestellung, die ebenfalls meist in Kategorien der »public choice«-Ansätze erörtert wird.
Der Ansatz hat seinen Ursprung in der Versicherungswirtschaft und beschreibt Vertragsbeziehungen mit riskanten Partnern. Der Prinzipal »Parlament« delegiert z. B. die Ausfüllung von Gesetzesinhalten an semi-autonome Behörden, ohne deren Agieren im Politikfeld hinreichend kalkulieren zu können. Die Stimulierung von rationalen Verhaltensanreizen oder von korrigierenden Einwirkungsmöglichkeiten ausgewählter Interessenten (»stakeholder«) kann die Delegationsrisiken mindern.
Eine solche Minderung kann aber auch durch die altfränkische, hierarchische Einwirkungsform »Bürokratie« zustande kommen, die in einem neuen, sozialwissenschaftlichen Modenumschwung wieder respektvollere Bewertung erfährt (Olsen 2008). Regeln werden nicht nur als Einschränkungen, sondern auch als Entlastung eingestuft, da sie von ständigen Neuaushandlungen der Entscheidungskontexte befreien und die Akteure überhaupt erst entscheidungsfähig in ihren zugewiesenen Kompetenzen machen. Im Gegensatz dazu erscheint die horizontale und dezentrale Aushandlung in »Netzwerken« als eine, die häufig Privilegien, Verstetigung und Intransparenz erzeugt. Auch im organisierten Innenverhältnis wird die Steuerung durch Hierarchie- und Regelbindung inzwischen wieder milder gesehen, da sie bestimmten Persönlichkeitstypen und Arbeitssituationen angemessen erscheint und einen Sockel der routinehaften Erledigung schafft, auf dem anspruchsvollere Aufgabenzuweisung aufbauen kann (Bobic/Davis 2003). Bürokratie [74]im Weber’schen Sinne bleibt also ein anregendes Studienobjekt, an dem auch die Abkehr von ihr interpretativ zu bewerten ist.
Literatur
Bobic, Michael P.; Davis, William E., 2003: A Kind Word for Theory X: Or Why So Many Newfangled Management Techniques Quickly Fail; in: Journal of Public Administration Research and Theory 13, 239–264. – Bozeman, Barry, 2000: Bureaucracy and Red Tape, Upper Saddle River, N. J. – Derlien, Hans-Ulrich et al., 2011: Bürokratietheorie. Einführung in eine Theorie der Verwaltung, Wiesbaden. – Hegedüs, András, 1981: Sozialismus und Bürokratie, Reinbek bei Hamburg. – Jacoby, Henry, 1969: Die Bürokratisierung der Welt. Ein Beitrag zur Problemgeschichte, Neuwied/Berlin. – Kasza, Gregory J., 1995: The Conscription Society. Administered Mass Organizations, New Haven/London. – Mitchell, William C.; Simmons, Randy T., 1994: Beyond Politics. Markets, Welfare and the Failure of Bureaucracy, Boulder/San Francisco/Oxford. – Morgan, Glenn, 1990: Organizations in Society, Houndsmills/London. – Olsen, Johan P., 2008: The Ups and Downs of Bureaucratic Organization; in: Annual Review of Political Science 11, 13–37. – Suleiman, Ezra, 2003: Dismantling Democratic States, Princeton/Oxford. – Weber, Max, 1980: Wirtschaft und Gesellschaft, 5. rev. Aufl. 1972, Studienausgabe, Tübingen (1921).
Rainer Prätorius