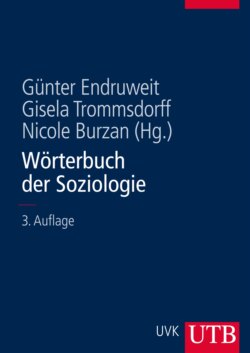Читать книгу Wörterbuch der Soziologie - Группа авторов - Страница 11
Оглавление[83]E
Ehe
Die Ehe (engl. marriage) ist eine durch Sitte und/ oder Gesetz normierte, auf Dauer angelegte Form gegengeschlechtlicher Paarbeziehung eigener Art. Diese eigene Art wird durch eine besondere Binnenstruktur und durch die Zuweisung gesellschaftlicher Funktionen, zumindest der biologischen Reproduktionsfunktion, begründet. Trotz aller kulturellen Unterschiede ist die Ehe überall – wenn auch mit unterschiedlichen Verpflichtungsgraden – als soziale Institution der legitimen Nachkommenssicherung anerkannt. Sie steht zumeist unter öffentlichem Schutz und ist – in mehr oder weniger starkem Maße – öffentlichen Regulierungen unterworfen. Sie begründet Erbfolgen und verlangt – zumindest dem Anspruch nach – von den Partnern und ihren Herkunftsfamilien gegenseitige Hilfeleistung und Kooperation.
Die für die heutige Ehe in fast allen Industriegesellschaften konstitutiven Merkmale der Emotionalität und Intimität ihrer Binnenstruktur und die der relativen Autonomie gegenüber der Herkunftsfamilie sind neuartige Erscheinungen und gelten daher auch keineswegs für die Ehen aller Kulturen. Dass sich die sog. »romantische Liebe« in der westlichen Welt in allen Schichten immer mehr als einzig legitimer Heiratsgrund durchsetzte und zur unhinterfragten sozialen Norm für jede Eheschließung wurde, hat die Eheforschung seit langem beschäftigt. Das Konstrukt »romantische Liebe« jedoch wurde erst mit der Entwicklung der Emotionssoziologie zu einem intensiv behandelten Thema der Soziologie.
Auch in den außereuropäischen Staaten setzt sich die »romantische Liebesehe« allmählich immer stärker durch. Gleichwohl überwiegen quantitativ weltweit die »arrangierten Ehen«. Diese waren – historisch gesehen – auch in unserem Kulturkreis nicht nur im Feudalsystem, sondern überall dort, wo Besitz zu vererben war, üblich. Hiervon sind zu unterscheiden die »Zwangsehen«, in denen Kinder von ihren Eltern gegen ihren Willen verehelicht werden.
Weiterhin bleibt ein wesentliches Strukturmerkmal aller Ehen, auch der modernen, dass sie über das bloße personale Paarverhältnis auf Familie verweisen. Denn die Hochzeit, die überall mit bestimmten rituellen Handlungen vollzogen wird, beinhaltet einen Statuswechsel des Brautpaares sowohl im Hinblick auf die Öffentlichkeit als auch innerhalb des Familienverbandes. Die Eheschließung stellt nämlich insofern auch heute noch einen »rite de passage« dar, als mit ihr neue soziale Rollen mit genau festgelegten Rechten und Pflichten übernommen werden: Die Braut wird zur Schwiegertochter, die Mutter zur Schwiegermutter, der Bruder zum Schwager usw. Welche konkreten Folgen bzw. Pflichten und Rechte für die Einzelnen mit der Eheschließung und der Übernahme der neuen sozialen Rollen verbunden sind, ist kulturvariabel und von den bestehenden Verwandtschaftslinien abhängig, ob z. B. ein patrioder matrilineares oder – wie in unserem Kulturkreis – ein duales Verwandtschaftssystem gegeben ist. Solche durch die Eheschließung zugeschriebenen Rollen werden lebenslänglich erworben und bleiben auch bei Tod des Ehepartners – und bei Ehescheidung neu definiert – sozial relevant. Insofern verweist die Eheschließung immer auf Familie (selbst bei Kinderlosigkeit), die Familie dagegen nicht auf Ehe, z. B. bei Alleinerzieherschaft.
Die Differenz zwischen der Ehe und den heutigen nichtehelichen Lebensgemeinschaften liegt insbesondere auch in dem Nichtbestehen eines sozial regulierten Integrationsprozesses zu den Herkunftsfamilien und der fehlenden öffentlichen Absichtserklärung, die Paarbeziehung mit dem Anspruch der Dauerhaftigkeit erhalten zu wollen. Nichteheliche Lebensgemeinschaften sind in Deutschland überwiegend eine neue Lebensform ohne Verpflichtungscharakter während der Postadoleszenz.
In allen Kulturen gibt es die Möglichkeit der Eheauflösung, zumindest in der Form der Partnertrennung. Die Ehescheidung ist der letzte rituelle oder formal-rechtliche und somit an bestimmte öffentliche Vorschriften gebundene Vollzug der Eheauflösung. In vielen Staaten ist vor der Ehescheidung eine Trennungszeit formal-rechtlich vorgeschrieben. Die Zahl der gerichtlichen Ehescheidungen ist seit Ende des vorigen Jh.s in allen Industrienationen stetig gestiegen. In einigen Staaten wird von allen Ehen bereits wieder die Hälfte durch Scheidung aufgelöst (z. B. in den USA, Kanada), zumindest ein Drittel (z. B. in Deutschland).
In Bezug auf die Eheformen ist zwischen Monogamie und Polygamie zu unterscheiden. Die polygame Ehe ist soziologisch zu definieren als die Mehrfach-Besetzung[84] einer Ehepartner-Rolle, entweder der des Ehemannes (=Polyandrie) oder der der Ehefrau (=Polygynie).
Literatur
Burkhart, Günter, 2001: Liebe am Ende des 20. Jahrhunderts, Opladen. – Lenz, Karl, 2003: Soziologie der Zweierbeziehungen, Wiesbaden. – Nave-Herz, Rosemarie, 1997: Die Hochzeit. Ihre heutige Sinnzuschreibung seitens der Eheschließenden, Würzburg. – Dies., 2006: Ehe- und Familiensoziologie, 2. Aufl., Weinheim/München. – Dies.; Markefka, Manfred (Hg.), 1989: Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Bd. I: Familienforschung, Neuwied.
Rosemarie Nave-Herz
Ehre
Begriffserklärung
Die Ehre (engl. honour) ist eine psycho-soziale Gegebenheit, die Simmel zwischen Recht und Moral im Bereich der Sitte ansiedelt. Im Deutschen bezeichnet der Begriff Ehre ein Doppelphänomen, das sowohl die Subjekt- wie auch die Objekt-Perspektive erfasst: als subjektive Ehre meint sie das Selbstwertgefühl eines Menschen, Selbstachtung, Anstand, Redlichkeit, Glaubwürdigkeit, Integrität; als objektive Ehre die Ehrerbietung und Wertschätzung, die jmdm. vom Sozium entgegengebracht wird: Ansehen, Anerkennung, Respekt, Reputation, guter Ruf (Leumund). Als übergeordnete philosophische Kategorie gilt Würde, die den Menschen als vernunftbegabtes und zu moralischem Handeln fähiges Gattungswesen gegenüber dem Tier auszeichnet.
Historischer Wandel
»Nicht die Ehre ist veränderlich, sondern das, worin die Menschen ihre Ehre setzen« (Scheler). Was heutzutage ein Gebot der Höflichkeit und der guten Manieren ist, z. B. jemandem den Vortritt lassen, war in der vertikal differenzierten Gesellschaft eine Frage der Ehre (s. den Königinnen-Streit im »Nibelungenlied«). Signifikant ist etwa auch der Bedeutungswandel des Begriffs »unehrlich« von einer sozialen Kategorie zu einem mentalen Attributivum: »Unehrlich« bedeutet heute »unaufrichtig«, während man in der ständischen Gesellschaft unter »unehrlichen Leuten« die marginalisierte Gruppe der Fahrenden, Prostituierten, Henker, Abdecker und anderer Stigmatisierter verstand. Auch wenn die Ehre in der funktionalen Massengesellschaft gleichberechtigter Staatsbürger ihr ausgeprägtes soziales und kulturelles Profil eingebüßt hat, ist sie in Alltagsbereichen (etwa im Sport) und beim Staatszeremoniell noch von gewisser Relevanz; sie besitzt jedoch keine Geltung mehr als zentraler normativer Wert. Der Wandel im Begriffsumfang der Ehre besteht i.W. darin, dass die nichtverantworteten Eigenschaften einer Person (Abkunft, Alter, Geschlecht) sowie die Stellung im Gesellschaftsgefüge als Kriterien adäquater Ehrezuweisung an Gewicht verloren, während persönliche Leistung und Moralität als Prüfstein für Ehrbarkeit zu Dominanz gelangten. Gleichzeitig gingen moralitätsunabhängige Charakteristika der Ehre in Begriffe wie Prestige, Status und Image ein.
Kulturspezifische Dimensionen
Die europäische Ständegesellschaft prägten öffentliche Ehrenstrafen (Pranger etc.) und (seit dem 16. Jh.) Duelle, während in Japan die Familienehre durch rituellen Selbstmord (Seppuku bzw. Harakiri) restituiert werden konnte. Den vom indischen Kastenwesen ausgeschlossenen »Unberührbaren« entsprachen in etwa die »unehrlichen Leute«. In patriarchalischen Milieus traten und treten Blutrache oder der sogenannte Ehrenmord (literarisiert z. B. in Lessings »Emilia Galotti«) als Form von Selbstjustiz auf. Zugrunde liegt eine somatische Auffassung von Ehre, deren Berechtigung mit zunehmender Aufgeklärtheit in Zweifel gezogen wird.
Aktualität der Ehre
Weniger die Modernität der Ehre (Vogt) steht zur Debatte, sondern vielmehr die Frage ihres Fortbestehens in der Gegenwart. Im Gegensatz zur »völkischen Ehre« im Nationalsozialismus und der Gleichsetzung von Ehre und Parteitreue in sozialistischen Staaten wird in rechtsstaatlichen Systemen Würde (Menschenwürde) als Grund für die Ehrbarkeit des Menschen angesehen. Neben dem im Grundgesetz Art. 1, 2 und 5 verankerten oder aus diesen abzuleitenden Recht der persönlichen Ehre gibt es in der Bundesrepublik einen strafrechtlichen Schutz vor Beleidigung (StGB §§ 185–200) und einen zivilrechtlichen Ehrenschutz (BGB §§ 823, 824, 826). [85]Zu konstatieren sind ein ausgeprägter Gabentausch in Form von Ordens- und Preisverleihungen, Selbstehrung durch Stiftungen, Ahndung des »unehrenhaften und berufswidrigen« Handelns von Journalisten (Pressekodex Ziffer 15) sowie Affären um das ehrlose Verhalten von Politikern, Wirtschaftsführern oder Wissenschaftlern (Korruption, Plagiat) bzw. deren Klagen gegen Rufmord (Diffamierung).
Der Rufschädigung im Internet mittels weltweiter digitaler Anprangerung (Cyber-mobbing etc.). wird durch Online-Reputationsmanagement begegnet.
Literatur
Burkhart, Dagmar, 2006: Eine Geschichte der Ehre, Darmstadt. – Scheler, Max, 1957: Über Scham und Schamgefühl. Ges. Werke, Bd. 10, Bern. – Simmel, Georg, 1922: Soziologie, 2. Aufl., München/Leipzig (1908). – Speitkamp, Winfried, 2010: Ohrfeige, Duell und Ehrenmord, Stuttgart. – Vogt, Ludgera, 1999: Die Modernität der Ehre; in: Ethik und Sozialwissenschaften 10, H. 3, 335–344, 384–393, dazu 20 Kritikartikel, 345–383.
Dagmar Burkhart
Ehrenamt
Unter Ehrenamt (engl. volunteering) versteht man eine produktive Tätigkeit, die freiwillig und unentgeltlich geleistet wird und die der Förderung der Allgemeinheit dient. Eine Tätigkeit wird dann als produktiv bezeichnet, wenn die Leistung prinzipiell auch von Dritten gegen Bezahlung erbracht werden könnte. Der Aspekt der Freiwilligkeit ist wichtig, um das Ehrenamt abgrenzen zu können von verpflichtenden Tätigkeiten, wie den Arbeitsgelegenheiten für ALG II-Empfänger (Ein-Euro-Jobs) oder unbezahlten Praktika im Rahmen einer Ausbildung. Das Kriterium der Unentgeltlichkeit bedeutet, dass zwar Kostenersatz für Ausgaben (z. B. Fahrtkosten) oder auch Pauschalen (wie die Übungsleiterpauschale im Sport) geleistet werden können, dass aber nicht wie bei der Erwerbsarbeit der geleistete Zeitaufwand abgegolten werden darf. Das Kriterium der Förderung der Allgemeinheit dient der Abgrenzung gegenüber Familienarbeit, wie beispielsweise Pflegeaufgaben für Angehörige innerhalb oder außerhalb des eigenen Haushalts. Es schließt nicht aus, dass die ehrenamtlich tätige Person auch selbst Nutzen aus ihrer Tätigkeit ziehen darf. Das wird häufig der Fall sein, da von einem Motivmix der Ehrenamtlichen auszugehen ist, der neben altruistischen auch egoistische Motive umfasst; ein Grenzfall, bei dem kontrovers diskutiert wird, ob es sich um Ehrenamt handelt, sind Selbsthilfegruppen. Ehrenamt findet in seiner formellen Form in Vereinen und Verbänden statt. Darüber hinaus ist umstritten, ob auch informelle Freiwilligenarbeit außerhalb solcher Organisationsformen, wie beispielsweise Nachbarschaftshilfe, dem Ehrenamt zugerechnet werden sollte. Eine passive Mitgliedschaft in einem Verein sowie Geldspenden sind nicht als Ehrenamt zu bezeichnen.
Der Begriff des Ehrenamts stammt aus dem 19. Jh. und betraf einerseits administrativ politische Ehrenämter, andererseits humanitär und karitativ christliche Hilfstätigkeiten gegenüber Armen. Heute wird alternativ auch von Freiwilligenarbeit bzw. bürgerschaftlichem Engagement gesprochen, wobei sich die Bezeichnung der Freiwilligenarbeit bewusst stärker an dem englischsprachigen Begriff des Volunteering orientiert.
Theoretisch ist das Ehrenamt vor allem mit dem Begriff des Sozialkapitals verbunden. Nach dem politikwissenschaftlichen Verständnis von Sozialkapital erhöht das ehrenamtliche Engagement in einer Region das Sozialkapital derselben, was wiederum mit der wirtschaftlichen Prosperität der Region in Verbindung gebracht wird. Die soziologische Perspektive betrachtet Sozialkapital als individuelle Ressource; im Ehrenamt wird vor allem die Anzahl schwacher sozialer Bindungen erhöht, denen eine positive Funktion beispielsweise bei der sozialen Integration zugesprochen wird.
Literatur
Dathe, Dietmar, 2005: Bürgerschaftliches Engagement; in: SOFI et al. (Hg.): Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland. Arbeit und Lebensweisen, Wiesbaden, 455–480. – Gensicke, Thomas et al., 2005: Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999–2004, Wiesbaden.
Susanne Strauß
[86]Eigentum
Die Definition von Eigentum (engl. property) kann unterschiedlich eng bzw. weit erfolgen: Im weitesten Sinne lässt sich Eigentum als auf knappe Güter bezogenes Handlungspotenzial in einer sozialen Umwelt verstehen (Krüsselberg) oder eingegrenzter als rechtlich geschützte Ansprüche bzw. Verfügung über knappe Güter. In juristisch eingegrenzter Definition ist Eigentum das weitgehendste Verfügungsrecht über Sachen und Rechte, wobei zwischen Besitz und Eigentum zu trennen ist: Während mit Besitz die tatsächliche Verfügungsgewalt angesprochen ist, beinhaltet Eigentum die höchste Verfügungsmacht über eine Sache. Eine zentrale Unterscheidung ist die in Privateigentum und Kollektiveigentum. Damit ist deutlich gemacht, dass nicht bezüglich aller knappen Güter in einer sozialen Umwelt privates Einzeleigentum möglich oder gesellschaftlich akzeptabel erscheint: Dies kann einerseits mit der Unteilbarkeit des Gutes zusammenhängen (»die Luft zum Atmen«), kann andererseits aber auch eine politische Entscheidung sein: In sozialistischen Gesellschaften etwa ist festgelegt, dass Eigentum an Produktionsmitteln im Regelfall kollektiv verankert ist. Der französische Frühsozialist Proudhon verurteilte die zu seiner Zeit bestehende Eigentumsverfassung sogar mit dem Verdikt »Eigentum ist Diebstahl«.
Eigentum hat verschiedene Funktionen. So ist mit Eigentum Verfügbarkeit und ein Zuwachs an Handlungsspielraum verbunden. Eigentum macht damit die Person z. B. unabhängiger von sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. davon, zur Existenzsicherung täglich seine Arbeitskraft anbieten zu müssen). Des Weiteren bedeutet Eigentum »soziale Sicherheit«. In dem Maße, wie Eigentum unterschiedlich konvertibel ist (Geldeigentum vor allem; Eigentum an Grund und Boden je nach Marktlage; Eigentum an einer »Idee«, die erst noch zu erproben ist, am wenigsten), beinhaltet dies auch Sicherung der zukünftigen Existenz. Gerade in sozialer Hinsicht beinhaltet Eigentum auch einen Zuwachs an Prestige, ist somit eine wesentliche Teildimension für relative Rangpositionen und die soziale Positionszuweisung der Person.
In dem Maße, wie Eigentum nicht ausschließlich und selbst genutzt wird, ist damit eine Delegation von Eigentumsbefugnissen verbunden. So ist die Trennung zwischen Eigentum (des Unternehmers) und Verfügung über Produktionsmittel (durch den Arbeitnehmer) das durchgängige Prinzip der Wirtschaftsstruktur heutiger (westlich/kapitalistischer) Industriegesellschaften. In großen Wirtschaftsunternehmen ist die Rolle des Managers ein herausragendes Beispiel für weitreichende Entscheidungen auf der Basis von delegierten Eigentumsbefugnissen. Bezieht man die in der Theorie der »property rights« sowie in den sozialwissenschaftlichen Austauschtheorien zentrale Annahme des selbstinteressierten Handelns hier in die Überlegungen ein, so ist abzuleiten, dass die Ziele des Managers partiell anders gelagert sind als die Ziele des Eigentümers. Damit zeichnet sich bei delegierten Eigentumsbefugnissen grundlegend das Problem der Kontrolle ab. Die Delegation erscheint nur in dem Maße (ökonomisch) sinnvoll, wie die Kontrollkosten nicht die Gewinne aus der Delegation aufzehren. Delegation bedeutet durchweg eine Verdünnung von Eigentumsrechten. Je nach Sachkategorie bzw. nach Nutzercharakteristik können hohe Sicherungskosten entstehen; diese sind umso niedriger, je weniger Eigentumsrechte bestritten werden, je funktionaler Rechtspflege und Gerichtsbarkeit organisiert sind, je eindeutiger das Staatsmonopol zur Sicherung von Eigentumsrechten gegeben und allgemein anerkannt ist.
Literatur
Badura, Peter, 1998: Freiheit und Eigentum in der Demokratie, Köln. – Bieszcz-Kaiser, Antonia (Hg.), 1994: Transformation – Privatisierung – Akteure, München. – Engerer, Hella, 1997: Eigentum in der Transformation, FU Berlin. – Hauck, Ernst, 1987: Wirtschaftsgeheimnisse – Informationseigentum kraft richterlicher Rechtsbildung? Berlin. – Heinsohn, Gunnar, 1996: Eigentum, Zins und Geld, Berlin. – Kessler Rainer; Loos, Eva (Hg.), 2000: Eigentum: Freiheit und Fluch, Gütersloh. – Krüsselberg, Hans-Günter 1977: Die vermögenstheoretische Dimension in der Theorie der Sozialpolitik; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 19, 232–259. – Roggemann, Herwig (Hg.), 1996: Eigentum in Osteuropa, Berlin. – Stehr, Nico, 1994: Arbeit, Eigentum und Wissen, Frankfurt a. M. – Tomuschat, Christian (Hg.), 1996: Eigentum im Umbruch, Berlin. – Wengorz, Lars H., 2000: Die Bedeutung von Unternehmertum und Eigentum für die Existenz von Unternehmen, Frankfurt a. M.
Thomas Kutsch
[87]Einstellung
Wenn wir mit dem Begriff »Einstellung« (engl. attitude) konfrontiert werden, können wir uns unmittelbar eine inhaltliche Vorstellung davon machen, was gemeint ist. Man denkt vielleicht an die Einstellung zu Politikern oder die Einstellung zu gesunder Ernährung oder evtl. auch an die Einstellung zu bestimmten Produkten im Smartphone-Bereich. Die Verwendung des Begriffs der sozialen Einstellung – im Unterschied zu der Einstellung, die an einer mechanischen Vorrichtung vorgenommen wird – beruht auf dem bekannten Werk »The Polish peasant in Europe and America« der Soziologen William Thomas und Florian Znaniecki von 1918. Einstellungen bilden soziale Gegebenheiten ab. Sie werden sowohl von individuellen Präferenzen als auch von gesellschaftlichen Werten beeinflusst. In der Regel hat eine Person eine Vielzahl von Einstellungen, die zusammengenommen ihre Einstellungsstruktur bilden. Diese dient als soziales Orientierungsschema. Damit ist gemeint, dass Einstellungen die Person darüber informieren, was sie vermeiden muss und wem sie sich annähern kann. Einstellungen sind emotional aufgeladen: Negative Einstellungen verweisen auf Sachverhalte, die die Person schwächer oder stärker ablehnt, während positive Einstellungen auf Gegebenheiten deuten, die die Person mit Freude erwartet.
Einstellungsobjekt
Eine Einstellung ist ein evaluatives Summenurteil über ein Objekt, das kognitive, affektive und behaviorale Komponenten beinhalten kann (Bierhoff/ Frey 2011, 304). Wenn von einem evaluativen Summenurteil gesprochen wird, soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass die Person das Einstellungsobjekt auf verschiedenen Dimensionen bewertet und dass der Einstellung die Summe dieser Bewertungen des Einstellungsobjekts zugrunde liegt. Betrachten wir z. B. ein Produkt wie das Smartphone der Marke X. Die Benutzerin kann es im Hinblick auf sein Design, seinen Preis, seine Beständigkeit, seine Benutzeroberfläche und weitere Aspekte bewerten. Diese Meinungen werden in der Einstellung zu dem Smartphone X zusammengefasst. Somit sind Einstellungen Zusammenfassungen, die in einer kurzen Aussage einen komplexen Sachverhalt wiedergeben und sowohl leicht im Gedächtnis gespeichert werden als auch als Handlungsanweisung benutzt werden können.
Es besteht in der Tendenz ein positiver Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten, der substantiell ist, wenn die Einstellungsmessung in ihrem Abstraktionsniveau mit der Verhaltensmessung übereinstimmt. Die Einstellungsmessung erfolgt in der Regel durch die Bewertung eines Einstellungs-Objekts auf einer Urteilsskala. Ein Beispiel lautet: ›Das Smartphone X ist gut ------schlecht‹. Zusätzlich wird auch auf implizite Einstellungsmessungen zurückgegriffen, bei denen der Zweck der Messung für den Teilnehmer nicht transparent ist. Ein Beispiel ist der Implizite-Assoziations-Test.
Einstellungen beziehen sich häufig auch auf die eigene Person. Dann spricht man von Selbstbewertung. Andere Einstellungen, die den Blickwinkel auf bestimmte Personengruppen verzerren, werden Vorurteile genannt. Wenn die Einstellung auf einzelne Personen gerichtet ist, spricht man von Sympathie und Antipathie. In der Regel wird zwischen einer bewertenden, einer kognitiven und einer Verhaltenskomponente der Einstellung unterschieden (Drei-Komponenten-Modell der Einstellung).
Diese Unterscheidung lässt sich an dem Einstellungsobjekt Smartphone veranschaulichen. Wir hatten schon gezeigt, wie die bewertende Komponente gemessen wird. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Meinungen über die Vor- und Nachteile des Smartphones. Diese beziehen sich z. B. auf Design, Preis, Beständigkeit und Benutzeroberfläche. Um die Meinung über diese Attribute direkt zu erfassen, kann man Feststellungen vorgeben wie: »Das Design von Smartphone X ist überhaupt nicht ------- sehr gelungen«. Schließlich können auch Verhaltensabsicht und tatsächliches Verhalten erfasst werden. Die Verhaltensabsicht beinhaltet die subjektive Wahrscheinlichkeit dafür, Smartphone X zu kaufen, während die Erfassung des offenen Verhaltens den Bericht über den Kauf des Smartphones betrifft.
Einstellungen haben bestimmte Funktionen. Sie beinhalten Wissen, das es erlaubt, Probleme zu lösen. Darüber hinaus dienen sie der sozialen Anpassung in einer gegebenen kulturellen Umwelt. Sie haben eine Wert-Ausdrucksfunktion, da sie bestimmte Präferenzen der Person kennzeichnen, und sie können der Funktion der Ich-Abwehr dienen, indem z. B. durch positive Einstellungen gegenüber[88] Minderheiten Schuldgefühle gemildert werden, die durch die gesellschaftliche Benachteiligung dieser Minderheiten ausgelöst werden.
Vertrauen
Im Folgenden werden zwei wichtige Themen der Sozialwissenschaft angesprochen, die eng mit Einstellungen zusammenhängen: Vertrauen und subjektives Wohlbefinden. Vertrauen beinhaltet eine Einstellung gegenüber anderen Personen, die von deren wahrgenommener Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit abhängt. Hohes Vertrauen in die Information, die eine andere Person gibt, reduziert die Unsicherheit darüber, ob die andere Person wahrheitsgemäß Auskunft gibt. Vertrauensvorschuss ist aber auch mit einem Risiko der Enttäuschung verbunden.
Hohes Vertrauen reduziert die Komplexität der sozialen Welt auf ein überschaubares Ausmaß (Luhmann 1973). Die Unsicherheit, die in der Zukunft liegt, wird durch Vertrauen verringert. Denn objektive (und möglicherweise lähmende) Unsicherheit wird in subjektive Sicherheit umgewandelt, die es der Person ermöglicht, die Initiative zu ergreifen und zu handeln. Die subjektive Sicherheit kann sich auf den Umgang mit Personen oder Systemen (wie Medien) beziehen und ist nicht weiter ableitbar (Giddens 1991). Vertrauen ist eine implizite soziale Orientierung, die auf einzelne Personen, Organisationen oder politische Systeme gerichtet ist. Die Entwicklung einer sicheren Bindung zu den Eltern trägt wesentlich zum Aufbau von Basisvertrauen bei. Während sichere Bindung mit hohem Vertrauen gegenüber der Bezugsperson einhergeht, hängt unsichere Bindung mit geringem Vertrauen zusammen.
Glück und subjektives Wohlbefinden
Einer der am meisten untersuchten Einstellungs-Inhalte ist die Einstellung zum eigenen Leben. Die bewertende Einschätzung des eigenen Lebens bezieht sich auf das Lebensglück. In empirischen Untersuchungen wird Lebensglück häufig als subjektives Wohlbefinden erfasst, das die Bewertung des eigenen Lebens betrifft, die sich entweder auf den Augenblick oder auf einen bestimmten Lebensabschnitt bezieht (Frey/Bierhoff 2011). Ein Beispiel ist die Beantwortung der Frage: »Auf einer Skala von 1 (unzufrieden) bis 10 (zufrieden), wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrem Leben insgesamt?«
Glück ist subjektiv und stellt eine individuelle Erfahrung dar, die für jede Person besonders sein kann. Daher ist streng genommen das Glück der einen Person nicht vergleichbar mit dem der anderen. Vergleichbarkeit wird dadurch hergestellt, dass der Glückszustand sprachlich beschrieben oder auf einer Urteilsskala eingeschätzt wird. Die Einschätzung des Glücks wird sowohl durch aktuelle Gefühle als auch durch die allgemeine Lebenszufriedenheit beeinflusst. Die aktuellen Gefühle sind von dem Kontext abhängig, in dem sie auftreten. Wie Dostojewski eindrucksvoll geschildert hat, kann der Vorgang zu baden ein Erlebnis höchsten Glücks sein, wenn man Gefangener in einem russischen Gulag ist.
Subjektives Wohlbefinden hängt eng mit Beziehungszufriedenheit, Vertrauen und Commitment an die Partnerschaft zusammen (Rohmann 2008). Unter glücklichen Menschen finden sich nur wenige, die keinen romantischen Partner haben. Von hohem subjektivem Wohlbefinden kann eine Aufwärtsspirale des Denkens und Handelns ausgehen, die sich ihrerseits wieder positiv auf das Wohlbefinden auswirkt.
Der Begriff des Glücks kann sehr oberflächlich oder auch tiefergehend verstanden werden. Grundsätzlich lassen sich drei Ebenen unterscheiden:
| 1) | Vergnügen, das sich kurzfristig ergibt, weil ein erfreuliches Ereignis eingetreten ist (z. B. das Erlebnis eines sonnigen Vormittags während eines Besuchs im Park) |
| 2) | Eudämonie. Unter diesem Begriff der Griechen, der so viel wie »Gelingen« bedeutet, versteht man ein tugendhaftes Leben, das das eigene Potenzial ausschöpft. Das Leben »blüht auf« (engl. flourish). Die Philosophie von Sokrates, Platon und Aristoteles lassen sich diesem Glücksbegriff zuordnen. |
| 3) | Flow bezeichnet ein Engagement für eine Auf gabe, das als erfüllend erlebt wird. Man widmet sich einer Aufgabe voll und ganz, vergisst Zeit und Umgebung und geht in der Tätigkeit auf. Die Erfüllung, die auf diese Weise erlebt wird, erzeugt das Gefühl, glücklich zu sein. |
Literatur
Bierhoff, Hans-Werner; Frey, Dieter, 2011: Sozialpsychologie. Individuum und soziale Welt, Göttingen. – Frey, Dieter; Bierhoff, Hans-Werner, 2011: Sozialpsychologie. Interaktion und Gruppe, Göttingen. – Giddens, Anthony, 1991: [89]Modernity and self-identity, Stanford, CA. – Luhmann, Niklas, 1973: Vertrauen, Stuttgart. – Rohmann, Elke, 2008: Zufriedenheit mit der Partnerschaft und Lebenszufriedenheit; in: Dies. et al. (Hg.): Sozialpsychologische Beiträge zur Positiven Psychologie, Lengerich, 93–117.
Hans-Werner Bierhoff/Elke Rohmann
Einzelfallstudie
Die Einzelfallstudie (engl. case study) stellt die genaue Beschreibung eines Falls dar (Ragin/Becker 1992). Einzelfallstudien werden meist mit qualitativen, aber auch mit quantitativen Methoden durchgeführt (Yin 2009, Flick 2009). »Fall« kann sich auf Personen, Gemeinschaften (z. B. Familien), Organisationen und Institutionen (z. B. Unternehmen) beziehen. Zentral für die Beurteilung von Einzelfallstudien ist, wofür der Fall und seine Analyse stehen und was an ihm verdeutlicht werden soll: Geht es um die einzelne Person (Institution etc.)? Ist die Person typisch für eine bestimmte Teilgruppe der Studie? Steht der Fall für eine spezifische professionelle Perspektive? Nach welchen Kriterien wurde der Fall ausgesucht zur Erhebung, Analyse und Darstellung der Daten? Forschungsstrategisch entscheidend sind für Einzelfallstudien die Identifikation eines für die Untersuchung aussagekräftigen Falls und die Klärung, was zum Fall gehört und welche Methoden seine Analyse erfordert. Bei einer Einzelfallstudie zum Verlauf der chronischen Erkrankung eines Kindes: Reicht es, das Kind im Behandlungskontext zu beobachten? Sollte der Familienalltag beobachtet werden? Müssen Lehrer oder Mitschüler befragt werden? Einzelfallstudien verwenden häufig mehrere Erhebungsmethoden (z. B. Interviews, Beobachtungen, Dokumentenanalysen). Hermeneutische Interpretationen in qualitativer Forschung arbeiten oft zunächst mit Einzelfallstudien (ein Gespräch, Dokument oder Interview). Einzelfallstudien werden auch zur Illustration einer vergleichenden Studie verwendet, um Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themenbereichen zu zeigen. So findet sich eine Reihe von Einzelfallstudien neben einer thematisch gegliederten fallübergreifend vergleichenden Darstellung in einer Studie zur Gesundheit obdachloser Jugendlicher (Flick/Röhnsch 2008).
Literatur
Flick Uwe, 2009: Sozialforschung – ein Überblick für die BA-Studiengänge, Reinbek. – Flick, Uwe; Röhnsch, Gundula, 2008: Gesundheit auf der Straße. Vorstellungen und Erfahrungsweisen obdachloser Jugendlicher, Weinheim. – Ragin, Charles; Becker, Howard (Hg.), 1992: What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry, Cambridge. – Yin, Robert, 2009: Case Study Research – Design and Methods, 4th. Ed., Thousand Oaks.
Uwe Flick
Elite
Unter Elite (engl. elite) versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch eine durch besondere Merkmale aus der Gesamtbevölkerung herausgehobene Personengruppe. Man verwendet den Begriff sowohl für herausragende Sportler und Wissenschaftler als auch für Spitzenpolitiker und Topmanager. In der sozialwissenschaftlichen Eliteforschung fällt die Definition enger aus. Zur Elite zählen ihr zufolge im Wesentlichen nur diejenigen Personen, die (in der Regel qua Amt oder, im Falle der Wirtschaft, qua Eigentum) in der Lage sind, durch ihre Entscheidungen gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Die vier zentralen Eliten kommen deshalb aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz. Sie haben in dieser Hinsicht den größten Einfluss.
Der Elitebegriff (élire=auswählen), erstmals im 17. Jh. erwähnt, wurde ab dem 18. Jh. vom aufstrebenden französischen Bürgertum als demokratischer Kampfbegriff gegen die traditionellen Vorrechte von Adel und Klerus eingesetzt. Die individuelle Leistung sollte statt der familiären Abstammung zum entscheidenden Kriterium für die Besetzung gesellschaftlicher Spitzenpositionen werden. Ende des 19. Jh.s veränderte sich der Gebrauch des Begriffs grundlegend. Elite wurde nun nicht mehr als Gegenpol zum Adel, sondern als Gegenpol zur Masse verstanden. Das Bürgertum definierte Elite, als die es sich selbst begriff, in Abgrenzung zur (aus seiner Sicht) ungebildeten und unkultivierten Masse.
Die drei Soziologen Mosca, Pareto und Michels formulierten vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund ihre klassischen Elitetheorien. In dem Gegensatz von Elite und Masse sehen sie ein allgemein gültiges Prinzip der Menschheitsgeschichte. Erstere[90] verfüge über die materiellen, intellektuellen und psychologischen Fähigkeiten, die zur Ausübung von Macht und damit zur Herrschaft erforderlich seien, Letztere nicht. Die klassischen Elitetheorien bildeten eine wichtige ideologische Grundlage für den Faschismus.
Seit dem Zweiten Weltkrieg wird der Begriff Elite überwiegend funktionalistisch definiert. Der Ansatz von den Funktionseliten besagt, dass es in modernen Gesellschaften keine einheitliche Elite oder gar herrschende Klasse mehr gibt, sondern nur noch einzelne, miteinander konkurrierende funktionale Teileliten an der Spitze der wichtigen gesellschaftlichen Bereiche. Der Zugang zu diesen Eliten stehe prinzipiell jedermann offen, weil die Besetzung von Elitepositionen im Wesentlichen nach Leistungskriterien erfolge.
Die funktionalistischen Elitetheorien sind in der Soziologie allerdings nicht unumstritten. So weisen z. B. Mills und Bourdieu darauf hin, dass es auch in der heutigen Gesellschaft keine Vielzahl voneinander unabhängiger und prinzipiell gleichrangiger Teileliten gebe, sondern eine einzige Macht-Elite bzw. herrschende Klasse, die trotz ihrer internen Differenzierung einen starken inneren Zusammenhalt aufweise. Außerdem haben empirische Untersuchungen gezeigt, dass die soziale Herkunft immer noch entscheidend für den Zugang zu den Eliten ist.
Literatur
Dreitzel, Hans P., 1962: Elitebegriff und Sozialstruktur, Göttingen. – Hartmann, Michael, 2004: Elitesoziologie, Frankfurt a. M. – Ders., 2007: Eliten und Macht in Europa, Frankfurt a. M. – Mills, C. Wright, 1962: Die amerikanische Elite, Hamburg.
Michael Hartmann
Emanzipation
Emanzipation (engl. emancipation) bezieht sich im sozialwissenschaftlichen Sprachgebrauch auf jene Vielzahl historisch spezifischer, zumeist generationenübergreifender sozialer Prozesse, in denen sich Individuen bzw. Gruppen aus wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Zwangs- und Abhängigkeitsverhältnissen selbst befreien.
Emanzipationsprozesse treiben zumeist Individuen bzw. Gruppen voran, zu deren Gunsten sich das gesellschaftliche Machtgefüge im sozialen Wandel zu verändern beginnt bzw. verändert hat und die ihr Machtpotential in einer Stärkung ihrer Position nun auch realisieren wollen. Emanzipationsprozesse sind im Kern Auseinandersetzungen zwischen machtstärkeren (im Extremfall: Etablierten-) und machtschwächeren (im Extremfall: Außenseiter-, Rand-) Gruppen, bei denen die Mitglieder der Letzteren gegen ihren mehr oder minder starken Ausschluss von ökonomischen Ressourcen, sozialen Chancen, politischen Rechten und kultureller Teilhabe kämpfen. Die Kampfmittel reichen von Aufständen, Demonstrationen, Agitation, Boykott, Sabotage bis hin zum Einsatz geeigneter, die Emanzipation legitimierender Theorien, Philosophien, Utopien oder Ideologien. In dem Maße, in dem die Emanzipation einer sozialen Gruppe vorangetragen und damit die Sozialstruktur bzw. die Machtkonfiguration verändert wird, kann u. U. die Ausgangssituation für die Emanzipation einer anderen Gruppe erst geschaffen werden. Emanzipationsprozesse können evolutionären sozialen Wandel bewirken, indem sie sich funktional-integrativ noch in die bestehende Sozialstruktur einfügen. Andere Emanzipationsbewegungen zielen auf radikale Veränderung der bestehenden (z. B. Eigentums-) Verhältnisse und damit auf revolutionären sozialen Wandel ab. Analysiert man einzelne historische Emanzipationsbewegungen, hat man somit detailliert den folgenden Grundfragen nachzugehen: Welche Gruppe, Schicht oder Klasse trägt den Emanzipationsprozess und wie ist ihre Einbindung in das Machtgefüge? Warum und wohin verändert sich die Struktur dieser Konfiguration von Macht und sozialer Ungleichheit? Von welchen Machtquellen bzw. Ressourcen ist bzw. war diese Gruppe in welchem Maße ausgeschlossen und welches sind daher die Ziele des Emanzipationsprozesses? Welcher Mittel bedient sie sich zum Vorantreiben der Emanzipation?
Wie Grass und Koselleck (1975) im Einzelnen darstellen, beginnt die Karriere des Begriffs mit der Proklamation von Menschenrechten in Europa und Nordamerika, mit der Aufklärung, mit dem Kampf des Bürgertums gegen feudale, absolutistische, ständische Vorrechte in den bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jh.s. Das Bürgertum, dem zunehmend ökonomische Chancen und Funktionen zuwachsen, fordert nun Staatsbürgerrechte ohne Rücksicht auf Geburt und Stand. Verschränkt mit diesem Prozess kommt im Deutschland der ersten[91] Hälfte des 19. Jh.s auch die Emanzipation der Juden mit dem Ziel ihrer politischen, ökonomischen und religiösen Gleichstellung voran.
Die Frauenemanzipation hat ihre Ursprünge im späten 18. und frühen 19. Jh. ebenfalls darin, dass zunächst von einigen bürgerlichen Intellektuellen politische und soziale Gleichstellung für Frauen gefordert werden. Wie die Industrialisierung, verspätet sich im europäischen Vergleich in Deutschland auch der Beginn einer organisierten Frauenbewegung. Es geht zunächst und zentral um die Machtquelle des Zugangs zu Berufsausbildung, zu qualifizierterer Berufstätigkeit und den entsprechenden Arbeitsmärkten über die bestehende unqualifizierte Fabrik-Frauenarbeit hinaus. Das Frauenwahlrecht etwa folgt erst 1919.
Mit dem Entstehen der Industriegesellschaft wurde das Bürgertum in Gestalt der »sozialen Frage« mit dem Emanzipationsstreben der Arbeiterbewegung konfrontiert, die teilweise die einstmals bürgerliche Forderung nach politischer Gleichstellung (z. B. Aufhebung von Wahlrechtseinschränkungen, Koalitionsfreiheit, Mitbestimmung) aufnahm und damit auf evolutionären Wandel zur Verbesserung der eigenen Position setzte, teilweise unter Übernahme des Marxschen Emanzipationsgedankens revolutionäre Wandlungen einleiten wollte. Für Marx war die erstgenannte Emanzipationsbestrebung (»politische Emanzipation«) »allerdings ein großer Fortschritt, sie ist zwar nicht die letzte Form der menschlichen Emanzipation überhaupt, aber sie ist die letzte Form der menschlichen Emanzipation innerhalb der bisherigen Weltordnung« (Zur Judenfrage, MEW 1, 356). Die vollständige Emanzipation (»menschliche Emanzipation«) liegt für Marx jedoch erst in der Aufhebung des Privateigentums, in der Aufhebung der Entfremdung (vgl. Hartfiel 1975).
Eine wichtige Rolle (vgl. Hartfiel 1975; Greiffenhagen 1973) spielt der Begriff auch in der sozialwissenschaftlichen Theorie- und Methodologiedebatte (Kritische Theorie der Frankfurter Schule als Wissenschaft mit »emanzipatorischem Erkenntnisinteresse«), in der Entwicklungssoziologie (Emanzipation ehemaliger Kolonial- bzw. Entwicklungsländer), in der Pädagogik (»emanzipatorische Erziehung« etwa als Leitbild der Bildungsreformen der 70er Jahre; vgl. Bath 1974 m. w. N.) sowie in der Psychologie, in der Jugend- und Sozialarbeit.
Literatur
Bath, Herbert, 1974: Emanzipation als Erziehungsziel?, Bad Heilbrunn. – Claußen, Bernhard, 1983: Emanzipation; in: Mickel, Wolfgang W. (Hg.): Handlexikon zur Politikwissenschaft, München. – Grass, Karl Martin; Koselleck, Reinhart, 1975: Emanzipation; in: Brunner, Otto et al. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2, Stuttgart, 153–197. – Greiffenhagen, Martin (Hg.), 1973: Emanzipation, Harnburg. – Habermas, Jürgen, 1968: Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a. M. – Hartfiel, Günter (Hg.), 1975: Emanzipation – Ideologischer Fetisch oder reale Chance?, Opladen.
Gerhard Berger
Emergenz
Emergenz (engl. emergence) bezeichnet das Auftreten »höherstufiger« Eigenschaften eines Phänomens, die sich von den Eigenschaften der zugrunde liegenden Elemente unterscheiden. Höherstufig kann sich auf das Verhältnis von Ebenen (wie Mikro-Makro) oder von Teil und Ganzem beziehen. Emergenz findet sich vielfältig in allen Bereichen der Wirklichkeit (etwa als V-Form eines Vogelschwarms, im Bewusstsein, das auf neuronalen Prozessen beruht, die selbst nicht über Bewusstsein verfügen), aber auch in der sozialen. Bspw. besitzen Gruppen die Eigenschaft der Gruppengröße, wohingegen die einzelnen Mitglieder keine solche Eigenschaft aufweisen. In diesem Fall ist die höherstufige Eigenschaft auf einfache Weise »reduzierbar« (Gruppengröße = Zahl der Mitglieder der Gruppe). Umstritten ist, ob es Fälle gibt, in denen eine Reduktion der emergenten Eigenschaften des Phänomens prinzipiell nicht möglich ist (häufig als »starke« Emergenz bezeichnet). Wenn Soziales nicht auf biologische oder psychologische Eigenschaften reduzierbar ist, so würde dies die (klassisch von Emile Durkheim formulierte) Annahme stützen, dass soziale Phänomene solche eigener Art (»sui generis«) sind. Daher ist die Emergenzdebatte auch zentral für die Auseinandersetzung um Individualismus und Holismus.
Literatur
Greve, Jens; Schnabel, Annette (Hg.), 2011: Emergenz, Berlin. – Stephan, Achim, 2007: Emergenz, Paderborn.
Jens Greve
[92]Emotionen
Unter »Emotionen« oder »Gefühlen« (engl. emotions, sentiments, feelings) versteht man die neben dem Denken und Wollen dritte Grundfunktion des Bewusstseins, die die Eigenschaft aufweist, dass sie mit bestimmten affektiven Zuständen verbunden ist. In der Soziologie findet sich eine Vielfalt von Emotionskonzepten, die sich darin unterscheiden, ob sie Emotionen vornehmlich als physiologische, kognitive, kulturelle oder leibliche Zustände betrachten. Die Soziologie analysiert die Zusammenhänge zwischen Emotionen und sozialen Sachverhalten. Ihr Erkenntnisinteresse besteht darin, die Bedeutung von Emotionen für die Genese von sozialen Sachverhalten wie auch umgekehrt die sozialen Bedingungen der Genese von spezifischen Emotionen zu untersuchen. Schon beginnend mit der Gründungsphase der Soziologie werden die wechselseitigen Konstitutionsprozesse von emotionalem Erleben und der Selektion von Handlungen (Max Webers Idealtypus des affektiven Handelns), aber auch die Rolle von Emotionen für die Bildung bestimmter sozialer Phänomene (Durkheims Untersuchungen zur kollektiven Efferveszenz) oder Vergesellschaftungsformen in den Blick genommen (Gemeinschaft vs. Gesellschaft). Meist spielt in den klassischen Untersuchungen der Gegensatz von »Emotionalität« und »Rationalität« als zwei unterschiedlich reflexiven Formen der Handlungssteuerung eine Rolle. In der heutigen Forschung geht man hingegen oft davon aus, dass Emotionen und Kognitionen oder Emotionalität und Rationalität sich wechselseitig bedingen. Wichtige Forschungsfelder sind die Funktion von Emotionen für die Aufrechterhaltung sozialer Interaktionen (so bspw. in der »Affekttheorie des sozialen Austauschs«), die emotionale Bedeutung von sozialen Diskursen für die Handlungsmodifikation (so in der »Affekt-Kontroll-Theorie«) oder die Rolle von Emotionen bei der Genese von sozialen Bewegungen. Einen Schwerpunkt stellt die Organisations- und Arbeitssoziologie dar. Das Konzept der »Emotionsarbeit« weist darauf hin, dass zahlreiche Arbeitstätigkeiten insbesondere im Bereich der Dienstleistungsarbeit vornehmlich eine interaktive, emotionsbezogene Dimension aufweisen.
Literatur
Schnabel, Annette; Schützeichel, Rainer (Hg.), 2012: Emotionen, Sozialstruktur und Moderne, Wiesbaden. – Schützeichel, Rainer (Hg.), 2006: Emotionen und Sozialtheorie, Frankfurt a. M./New York. – Stets, Jan E.; Turner, Jonathan H. (Hg.), 2007: Handbook of the Sociology of Emotions, New York.
Rainer Schützeichel
Empirie
Der Begriff Empirie (engl. empirical, empiricism) ist aus dem Griechischen (empeiria) abgeleitet und bedeutet Sinneserfahrung. Empirie bezeichnet in den Sozialwissenschaften ein auf systematischen Erfahrungen sowie auf theoretischen Modellen basierendes Wissen. Empirische Informationen sind damit eine spezifische Form von Aussagen zur Beschreibung der Wirklichkeit. Die Gewinnung des empirischen Wissens erfolgt auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und ist nicht voraussetzungslos. Somit unterscheidet sich die Empirie sowohl von der Alltagserfahrung als auch von der Theorie und auch von der Praxis.
Empirie und Alltagserfahrung
Während man sich Alltagserfahrungen voraussetzungslos, spontan und unsystematisch aneignet, werden die empirischen Aussagen gezielt und systematisch gewonnen. Alltagserfahrungen können jedoch durchaus als Auslöser für die Gewinnung empirischen Wissens fungieren, dies z. B. dann, wenn aufgrund der Alltagserfahrung Lücken im Wissen ausgemacht werden. In den Sozialwissenschaften werden für die Gewinnung empirischen Wissens elaborierte Instrumente eingesetzt. Vor allem mithilfe solcher Methoden wie den Befragungen, den Beobachtungen, den Inhaltsanalysen und den sozialen Experimenten gelingt es, empirische Aussagen zu gewinnen. Die dabei erhobenen Daten müssen, ebenfalls im Unterschied zu den Alltagserfahrungen, bestimmten Anforderungen genügen. So sollen diese vor allem objektiv, reliabel und valide sein. Diese Eigenschaften stellen zugleich wichtige Kriterien der Wissenschaftlichkeit dar, wobei Objektivität die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Datengewinnung meint. Wenn unterschiedliche Forscher zu den[93] gleichen Befunden gelangen, so sind diese objektiv. Dritte müssen die Möglichkeit haben, die Gewinnung der Daten nachzuvollziehen. Mit Reliabilität wird die Genauigkeit bzw. die Exaktheit einer Messung und mit Validität deren Gültigkeit bezeichnet. Die Reliabilität kann ermittelt werden mithilfe der Wiederholung einer Messung unter den gleichen Bedingungen. Validität liegt dann vor, wenn bei einer Erhebung auch jener Gegenstand gemessen worden ist, der beabsichtigt war, gemessen zu werden.
Empirie und Theorie
Die Empirie steht in einem engen Zusammenhang mit der Theorie. Aufgrund empirischer Erkenntnisse kann es erstens zur Weiterentwicklung des theoretischen Wissens kommen. Opp (1995: 188) spricht von einer notwendigen »empirischen Konfrontation von Theorien.« Zweitens kann aber auch aufgrund des theoretischen Wissens und aufgrund von hier ausgemachten Defiziten gezielt nach neuen empirischen Erfahrungen gesucht werden. Die Theorie geht von daher der Empirie voraus. Dies bedeutet, dass empirische Informationen aufgrund einer gezielten, theoretisch begründeten Auswahlstrategie gewonnen werden. Da es nicht möglich ist, die Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit zu erfassen, ist eine gezielte, theoretisch begründete Selektion erforderlich. So gilt es, jene Merkmale der zu untersuchenden Objekte zu bestimmen, die für die Lösung des Problems geeignet sind. In diesem Zusammenhang kommt auch den Indikatoren eine wichtige Bedeutung zu. Sie stellen die Verbindung zwischen dem theoretischen und dem empirischen Wissen her. Auch die Indikatoren werden aufgrund theoretischer Überlegungen über das Funktionieren der Gesellschaft gebildet. Sie dienen dem Ziel, empirische Informationen zu gewinnen. Empirische Daten werden beispielsweise genutzt, um die in Hypothesen enthaltenen Vermutungen zu prüfen und diese dann schrittweise in theoretisches Wissen zu überführen. In dieser Beziehung geht nun die Empirie der Theorie voraus.
Empirie und Praxis
Schließlich gilt es auch, Theorie, Empirie und Praxis voneinander abzugrenzen. Trotz der wissenschaftlich begründeten, d. h. theoretisch fundierten Vorgehensweise bei der Gewinnung empirischen Wissens ist dieses nicht unfehlbar. Somit muss sich die Theorie (ausreichend und umfassend) in der Praxis bewähren. Eine solche Funktion kann von der Empirie nicht wahrgenommen werden. Die Empirie steht damit quasi vermittelnd zwischen Theorie und Praxis. Der Übergang von empirischem oder Erfahrungswissen zum theoretischen Wissen ist zudem fließend. Auch in dieser Beziehung geht die Empirie der Theorie voraus. Theorie und Empirie stehen damit in einem dialektischen Verhältnis. Sie bedingen einander und gehen ineinander über.
Empirismus
Unter Empirismus wird eine Denkrichtung bzw. auch eine philosophische Strömung verstanden, bei der alles Wissen lediglich als auf Erfahrungen basierend verstanden wird. Die Empirie wird hier zu der zentralen Quelle der Erkenntnis der Wirklichkeit. Zugleich ignoriert der Empirismus damit jedoch die oben beschriebene theoriegeleitete Forschung zur Gewinnung des empirischen Wissens. Der Positivismus knüpft am Empirismus an. Es lassen sich verschiedene Richtungen des Empirismus unterscheiden.
Der logische Empirismus, der vor allem von den Wissenschaftlern des Wiener Kreises (Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Herbert Feigl) entwickelt worden ist, lehnt beispielsweise – im Unterschied zum Kritischen Rationalismus – jede Induktionslogik ab. Dem Begriffsempirismus folgend sind alle gehaltvollen Begriffe Erfahrungsbegriffe, während der Aussagenempirismus davon ausgeht, dass es sich bei den gehaltvollen Aussagen um Erfahrungsaussagen handelt. Der naive Empirismus unterstellt, dass Begriffe Abbilder von Sinneserfahrungen sind, und der moderne Empirismus vertritt die Auffassung, dass die Begriffe auf Beobachtungen zurückgeführt werden können. Der reduktionistische Empirismus nimmt gegenüber dem schwachen Empirismus an, dass die Begriffe vollständig auf Beobachtungen zurückgeführt werden können. Schließlich vertritt der dogmatische Empirismus die Auffassung, die empirische Erkenntnis gewährleiste Sicherheit, während der kritische Empirismus die Fehlbarkeit empirischer Aussagen annimmt.
Literatur
Carnap, Rudolf, 1929: Abriss der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen, Wien. – Chalmers, Alan, 2007: Wege der Wissenschaft:[94] Einführung in die Wissenschaftstheorie, 6. Aufl., Berlin. – Gadenne, Volker, 2004: Empirische Forschung und normative Wissenschaftstheorie. Was bleibt von der Methodologie des kritischen Rationalismus? In: Diekmann, Andreas (Hg.): Methoden der Sozialforschung, Sonderheft 44 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Wiesbaden, 33–50. – Haller, Rudolf, 1993: Neopositivismus. Eine historische Einführung in die Philosophie des Wiener Kreises, Darmstadt. – Opp, Karl-Dieter, 1995: Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer Theoriebildung und praktischen Anwendung, Wiesbaden.
Michael Häder
Entscheidung
Wahl zwischen beziehungsweise Selektion von Alternativen. In der Soziologie werden Entscheidungen (engl. decision) in sozialtheoretischer Perspektive vorwiegend mit Blick auf das soziale Handeln der Menschen untersucht – wie (menschliche) Akteure Handlungsoptionen wählen und Entscheidungen treffen. In dieser Sicht geht es vornehmlich darum zu verstehen und zu erklären, wie das Entscheiden »funktioniert«, was genau eine Entscheidung ist, wie Handeln und Entscheiden voneinander zu unterscheiden sind und worin der Zusammenhang zwischen Entscheider/in und Entscheidung besteht. In gesellschaftstheoretischer und -diagnostischer Perspektive wird danach gefragt, wie sich Menschen in historisch-spezifischen Situationen entscheiden und wie sich die Praxis des Entscheidens unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen wandelt. In der Moderne, so beispielsweise Schimank (2005), vervielfältigen sich die Entscheidungsmöglichkeiten und -spielräume, aber auch die Zwänge, Entscheidungen zu treffen. In der soziologischen Theoriebildung werden mit Blick auf das Entscheiden unterschiedliche Ansätze vertreten.
›Entscheidung‹ in Theorien der rationalen Wahl
In der bis heute dominierenden Tradition der Theorien der rationalen Wahl wird unter einer Entscheidung der Prozess oder das Ergebnis einer Wahlhandlung verstanden: Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, eine Handlungsalternative aus mehreren im Hinblick auf ein bestimmtes Handlungsziel auszuwählen. Modellhaft besteht ein Entscheidungsprozess darin, dass der Akteur eine Entscheidungssituation wahrnimmt und deutet, das Entscheidungsproblem definiert, die Entscheidungskriterien möglichst vollständig erfasst, diese in eine stabile und widerspruchsfreie Rangfolge von Prioritäten bringt, sich aller Handlungsalternativen und ihrer Folgen vergewissert und dann im Hinblick auf die Prioritätenordnung und das vorab definierte Ziel die Handlungsoption auswählt, die am besten geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Im Anschluss an die Auswahl wird die Entscheidung kommuniziert und umgesetzt; von Beobachtern wird sie als Entscheidung interpretiert und dem Akteur als Entscheidung zugeschrieben. Betont wird dabei a) die Intentionalität der Entscheidung und b) die Nutzenorientierung des entscheidenden Akteurs.
Da die zeitlichen Ressourcen und die Informationsverarbeitungskompetenzen menschlicher Akteure begrenzt sind, kann eine vollständige Rationalität des Entscheidens unter Abwägung aller Möglichkeiten nicht erreicht werden. Die Rationalität ist vielmehr sowohl mit Blick auf die Entscheidung selbst als auch mit Blick auf das Entscheidungsverfahren begrenzt (»bounded rationality«, March/Simon): Entscheider suchen nicht nach optimalen, sondern nach zufriedenstellenden Lösungen (»satisficing«), wählen die nächstbeste Handlungsalternative (»simple minded search«) und gehen im Entscheiden inkrementalistisch vor (»muddling through«, Lindblom). An einem Entscheidungsprozess können ein oder mehrere Akteure beteiligt sein; das gemeinsame und bewusste Abstimmen einer Entscheidung wird als kollektive Entscheidung bezeichnet. Grundsätzlich bedeutet Entscheiden Handeln unter Unsicherheit – wenn das Ergebnis der Wahl von vornherein feststeht, kann man nicht mehr von einer Entscheidung sprechen: »Nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden.« (Foerster 1993, 153). Im Rahmen der Annahmen der Theorien rationaler Wahl entwerfen und analysieren spieltheoretische Modelle interaktive Entscheidungssituationen. Sie versuchen, das (rationale) Entscheidungsverhalten der Beteiligten in sozialen Konfliktsituationen zu prognostizieren.
[95]›Entscheidung‹ in weiteren theoretischen Ansätzen
Im Gegensatz zu einer akteur- bzw. handlungstheoretischen Fassung wird aus der Perspektive der neueren Systemtheorie Entscheiden nicht als mentaler Akt eines Akteurs verstanden, sondern als spezifische Form der Kommunikation. Entscheidungen sind auf Erwartungen reagierendes Verhalten, so Luhmann; sie bestehen nicht in der Auswahl einer Alternative, sondern dokumentieren sich an ihr. Nicht der Wille und Entschluss eines denkenden und handelnden Akteurs sind maßgeblich, sondern die Anschlussfähigkeit der Entscheidung an eine andere – und die Tatsache, dass eine Entscheidung ihre eigene Kontingenz thematisiert (Luhmann 1984, 1993, 2005).
Die neuere Forschung der Neurobiologie und der Psychologie betont, dass eine Entscheidung nicht notwendig als kognitive Handlungsvorbereitung zu verstehen ist. Entscheidungen fallen vielmehr automatisch, gefühlsmäßig oder intuitiv; sie sind die Folge neuronaler Vernetzungen von Handlungsimpulsen und Mustern der Handlungsdurchführung (Roth 2007). Auch der Ansatz des »Naturalistic Decision Making« weist darauf hin, dass Entscheidungen im Moment des Wiederkennens einer Situation fallen: Mit der Typisierung einer Situation fällt die Entscheidung, wie gehandelt werden soll. So gesehen, bestehen Entscheidungen nicht mehr in der Auswahl einer Handlungsoption, denn es werden keine Alternativen gegeneinander abgewogen, sondern sie fallen zusammen mit der Repräsentation der Situation (Zsambok/Klein 1997). Auch neuere, praxistheoretisch inspirierte Überlegungen zum Entscheiden diskutieren, inwieweit Entscheidungen kein klar begrenztes Ereignis und Produkt eines zielgerichteten Denkprozesses sind, sondern im Prozess des Zusammenwirkens von Akteuren im Fluss des Handelns fallen und als Entscheidung interpretiert werden (Wilz 2009). Entscheiden wird dort als bewusste oder unbewusste Handlungsvorbereitung eines Akteurs (dann ist die daraus folgende Handlung die Umsetzung der Entscheidung) und/oder als spezifische Form sozialen Handelns betrachtet.
Neben der soziologischen Theorie- bzw. Begriffsbildung wird die Entscheidungsforschung vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Organisationssoziologie, aber auch der Biographieforschung und vor allem im Feld der Wirtschaftswissenschaften betrieben.
Literatur
Diekmann, Andreas; Voss, Thomas (Hg.): 2004: Rational-Choice-Theorie in den Sozialwissenschaften, München. – Esser, Hartmut, 1991: Die Rationalität des Alltagshandelns. Eine Rekonstruktion der Handlungstheorie von Alfred Schütz; In: Zeitschrift für Soziologie 20, 430–445. – Foerster, Heinz von, 1993: KybernEthik, Berlin. – Kirsch, Werner, 1998: Die Handhabung von Entscheidungsproblemen, 5. Aufl., München. – Lindblom, Charles E., 1969: The science of »muddling through«; in: Etzioni, Amitai (Hg.): Readings on modern organizations, Englewood Cliffs, 154–166. – Luhmann, Niklas, 1984: Soziologische Aspekte des Entscheidungsverhaltens; in: Die Betriebswirtschaft 44, 591–603. – Ders., 1993: Die Paradoxie des Entscheidens; in: Verwaltungs-Archiv 83, 287–310. – Ders., 2005: Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Organisation, 4. Aufl., Opladen. – March, James G., 1994: A primer on decision making. How decisions happen, New York. – March, James; Simon, Herbert A., 1958: Organizations, New York. – Roth, Gerhard, 2007: Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten, Stuttgart. – Schimank, Uwe, 2005: Die Entscheidungsgesellschaft. Komplexität und Rationalität der Moderne, Wiesbaden. – Schmid, Michael, 2004: Rationales Handeln und soziale Prozesse, Wiesbaden. – Simon, Herbert A., 1957: Models of man – social and rational, New York. – Wilz, Sylvia Marlene, 2009: Entscheidungen als Prozesse gelebter Praxis; in: Böhle, Fritz; Weihrich, Margit (Hg.): Handeln unter Unsicherheit, Wiesbaden, 105–120. – Zsambok, Caroline E.; Klein, Gary, 1997: Naturalistic decision making, New Jersey.
Sylvia Marlene Wilz
Entwicklung
Als Entwicklung (engl. development) bezeichnet man im alltäglichen und im politischen Sprachgebrauch zumeist jeden positiven technischen oder sozialen Wandel in vor- oder frühindustriellen Gesellschaften (»Entwicklungsländer«). Wissenschaftlich brauchbarer ist es, Entwicklung als eine der Formen von Veränderung der Sozialstruktur anzusehen und sie damit von anderen Formen zu unterscheiden. Sozialer Wandel beschreibt schwerpunktmäßig die Veränderung von charakteristischen, typischen Elementen der Sozialstruktur, Fortschritt ist eine positiv beurteilte Veränderung, und Evolution eine Veränderung, die in einer quasi-genetisch determinierten Weise von einfacheren zu komplexeren Ebenen führt. Dann könnte man Entwicklung als einen Prozess definieren, durch den Elemente[96] der Sozialstruktur verändert werden und bei dem die realen Veränderungen im Verhältnis zu den objektiven Möglichkeiten gesehen werden (Endruweit, 12). Das ist die auf Natur, Technik usw. erweiterte Fassung der nur menschenbezogenen Definition von Entwicklung als »the realisation oft the potential of human personality« (Seers, 2). Damit wird der Begriff auch der nur bei diesem Wort bestehenden Vorstellung von Unter- und Überentwicklung gerecht. In Wissenschaft und Praxis werden aber auch viele andere Definitionen benutzt, oft auch im Sinne anderer Formen von Veränderung der Sozialstruktur (so Harrison, XII, i. S. von Fortschritt) oder unnützerweise wertbeladen (so z. B. Behrendt, 130; Seers, 2).
Etymologisch zeigen sowohl der deutsche Entwicklungsbegriff (dazu Kößler, 15–47) als auch viele fremdsprachige Entsprechungen, so im Frz. (développement), Span. (desarrollo), Russ. (razvitije), Schwed. (utweckling) und Türk. (gelişme), wie beim Evolutionsbegriff die Vorstellung, dass alles aus einem vorhandenen Potenzial entstehe und dadurch auch in seinen Möglichkeiten determiniert sei. Damit würde soziale, politische und ökonomische Entwicklungspraxis eine Potenzialanalyse voraussetzen, für die die methodologischen Grundlagen noch weitgehend fehlen (zum Zusammenhang von Definition und Messung von Entwicklung vgl. auch Barnett, 173–193).
Als Grundbegriff in der nicht nur auf die Entwicklungsländer zu beschränkenden Entwicklungssoziologie, aber auch in anderen Wissenschaften, ermöglicht dieser Begriff eine Untersuchung von stattfindenden, möglichen oder geplanten Veränderungen im Hinblick auf ihre Ausgangslage, Randbedingungen und mögliche Reichweite. Damit ließe sich dann u. U. auch die ungleiche Entwicklung, entweder mehrerer Gesellschaften oder verschiedener Sektoren innerhalb derselben Gesellschaft, evtl. kausal erklären oder gar vorhersagen und dann sinnvoll steuern (vgl. auch Seers bei Goetze, 187–189).
In der Allgemeinen Soziologie hat der Entwicklungsgedanke schon an ihrem Beginn, etwa bei Comte, Ferguson und Spencer, eine oft beherrschende Rolle gespielt und gar zur Aufstellung vermeintlicher Entwicklungsgesetze geführt. Dabei wurde manchmal aus Ethnozentrismus oder Ideologisierung der Geschichte der eigenen Gesellschaft deren Verlauf als alternativloses Modell dargestellt, bei dem die Möglichkeit von funktionalen Äquivalenten gar nicht erst erwogen wurde. In der Allgemeinen Soziologie weitgehend aufgegeben, setzt sich dieser Ansatz aber in manchen Entwicklungstheorien noch fort.
Der in neuerer Zeit häufig benutzte Begriff der nachhaltigen Entwicklung (engl. sustainable development) geht zurück auf den Kgl. Sächs. Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (Sylvicultura Oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht, Leipzig: J. F. Braun 1713). Er bestimmt Nachhaltigkeit für die Forstwirtschaft eindrucksvoll klar: Man holze im Wald nicht mehr ab, als in derselben Zeit nachwächst. Wenn man in diesem Sinne den obigen Entwicklungsbegriff einengt, kann man nachhaltige Entwicklung definieren als eine Entwicklung, die Dauerhaftigkeit dadurch erreicht, dass sie die notwendigen Ressourcen nie erschöpft. Nachhaltige Entwicklung überschreitet also nie die Grenze zur Überentwicklung.
Weltweite Aufmerksamkeit erhielt der Begriff der nachhaltigen Entwicklung seit einer UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. Sie baute auf dem Bericht der sog. Brundtland-Kommission über »Our Common Future« aus dem Jahr 1987 auf. Nachhaltige Entwicklung wurde darin definiert als eine Entwicklung, die weltweit die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne die Lebenschancen zukünftiger Generationen zu gefährden. Das ist ein politischer Begriff, weil er die gegenwärtige Verteilungsgerechtigkeit umfasst, für die es keinen wissenschaftlichen Maßstab gibt. Konkrete Folgerungen aus der allgemeinen Definition sind u. a.: Abkehr vom quantitativen Wachstum; Nutzung regenerativer statt fossiler Energiequellen; Schutz der Trinkwasservorräte; Einschränkung des Individual- zugunsten des öffentlichen Verkehrs; Vermeidung von Nahrungsmittelverschwendung; Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt; Vermeidung von Überfischung und Verunreinigung von Flüssen und Meeren. Das alles wurde 2002 auf einer UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung in Johannesburg bekräftigt, wird aber bisher nur minimal umgesetzt, weil es dafür am notwendigen Wandel der Wertordnung, der Verhaltensmuster und anderer Sozialstrukturelemente in den einzelnen Gesellschaften fehlt. Im Grundgesetz steht seit 1994 in Art. 20a: »Der Staat schützt auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsrechtlichen [97]Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und Rechtsprechung.«
Literatur
Barnett, Tony, 1988: Sociology and Development, London. – Behrendt, Richard F., 1965: Soziale Strategie für Entwicklungsländer, Frankfurt a. M. – Brand, Karl-Werner (Hg.), 1997: Nachhaltige Entwicklung für Deutschland. Eine Herausforderung an die Soziologie, Opladen. – Endruweit, Günter, 1986: Elite und Entwicklung, Frankfurt a. M. – Goetze, Dieter, 1976: Entwicklungssoziologie, München. – Grober, Ulrich, 2010: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit, München. – Harrison, David, 1991: The Sociology of Modernization and Development, London. – Kößler, Reinhart, 1998: Entwicklung, Münster. – Otto, Siegmar, 2007: Bedeutung und Verwendung der Begriffe Entwicklung und Nachhaltigkeit, Bremen. – Renn, Ortwin et al. 2007: Leitbild Nachhaltigkeit, Wiesbaden. – Seers, Dudley, 1977: The meaning of development; in: International Development Review 19, 2–7. – Statistisches Bundesamt (Hg.), 2008: Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2008, Wiesbaden. – European Union (ed.), 2009: Sustainable Development in the European Union, Brussels. – Umweltbundesamt (Hg.), 2002: Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Berlin.
Günter Endruweit
Entwicklungssoziologie
Der Entwicklungssoziologie (engl. sociology of development) geht es um die Analyse von Modernisierungsprozessen innerhalb der Moderne. Bis in die siebziger Jahre konnte die Frage, um was es bei Entwicklung geht und welches die Perspektive der Soziologie dabei sein könnte, relativ klar entlang zweier Paradigmen beantwortet werden: Auf der einen Seite wurde Entwicklung als nachholende Modernisierung und Überwindung traditioneller Relikte gesellschaftlicher Organisation in den Entwicklungsländern verstanden. Die »westliche« Moderne galt als Maßstab, mit der Annahme, dass früher oder später die Strukturen sich im Sinne einer universalisierten globalen Moderne angleichen. Auf der anderen Seite wurde genau diese Idee linearer Modernisierung in Frage gestellt. Demgegenüber wurde betont, dass Unterentwicklung nicht den Fortbestand von Traditionen oder vor-modernen Strukturen (feudale Formen des Großgrundbesitzes, Subsistenzproduktion usw.) bezeichnet, sondern selbst Teil der internationalen Entwicklung der Moderne ist. (Goetze 2002, 18 ff.)
Ein Kennzeichen der Modernisierungsprozesse ist, dass sie zum einen auf einer gesellschaftlichen und kulturell-ideologischen Grundlage erfolgen, die sich von der generischen Modernisierung in Westeuropa im 18. und 19. Jh. unterscheiden, und zum weiteren direkt verbunden sind mit globalen Interaktionen (Kolonialismus, Globalisierung). Diese globalen Interaktionen in Form des Kolonialismus waren gleichzeitig ein Faktor der europäischen Modernisierung wie der Transformation vor-kolonialer Gesellschaften. Industrialisierung, Ausweitung der Marktwirtschaft und Nationalismus in Westeuropa sind eng verbunden mit kolonialer Ausbeutung, bzw. diese war selbst eine Bedingung für die Entwicklung der Moderne. Gleichzeitig begrenzte Kolonialismus Transformationsprozesse in den Kolonien, was als »abhängige Entwicklung« beschrieben wurde. Unterentwicklung ist damit nicht Ergebnis fehlender oder begrenzter Modernisierung, das Fortbestehen traditionaler oder feudaler Gesellschaftsformen, sondern eine spezifische Form von Modernisierung innerhalb der Moderne.
Ebenso wie sich innerhalb Europas die Bedingungen für Modernisierung unterschieden, bestehen weitreichende Differenzen zwischen den »Entwicklungsländern« oder »Entwicklungsregionen«. Amerika wurde von Europa besiedelt, so dass sich dort eine leicht modifizierte europäische Moderne ergab. In Asien und Afrika traf koloniale Modernisierung auf lang etablierte vor-koloniale Strukturen, die in diesen Prozessen aufgehoben wurden. Deutlich äußert es sich z. B. in der Integration vor-kolonialer Eliten in die Kolonialverwaltung und Wirtschaft. Diese Differenzen spielen eine erhebliche Rolle für die entwicklungssoziologische Theoriebildung.
In der lateinamerikanischen Erfahrung stellte sich die Frage, warum der Norden sich rapide modernisierte und zu einer Weltmacht wurde, während der Süden des Kontinentes sich »unterentwickelte«. Dieses bildete die Grundfrage der Dependenztheorien seit den 1960er Jahren. Das Hauptargument dieser Theorien, von denen Wallersteins »Weltsystemtheorie« als die ausgearbeitetste Version angesehen werden kann, ist, dass Modernisierung als globaler Prozess verstanden werden muss, der durch massive Machtdifferentiale zwischen einem Zentrum und Peripherien charakterisiert ist. Da diese Machtdifferentiale [98]mit Ausbeutung verbunden sind, die durch gesellschaftliche und politische Strukturbildungen (Kompradorenbourgoisie, autoritäre Entwicklungsregimes etc.) gefestigt werden, erlauben sie Entwicklung des Zentrums und führen zur Unterentwicklung der Peripherien.
In Asien, wo viele Gesellschaften bis mindestens zum 18. Jh. in ihrer Entwicklungsdynamik durchaus vergleichbar waren mit Europa, ging es um die Frage, ob eine eigenständige Modernisierung der Gesellschaften möglich gewesen wäre, wie das Beispiel Japans belegt. Mit der Diskussion der Postmoderne wurde Moderne als universelle Kategorie in Frage gestellt. Damit wurde es möglich, eine »asiatische Renaissance« basierend auf einer islamischen oder neo-konfuzianischen Moderne zu diskutieren. (Anwar 1996) Die rapide wirtschaftliche Entwicklung Ost- und Südostasiens sowie Indiens in den neunziger Jahren, während die westliche Welt vor Wirtschaftskrisen stand, konnte als empirischer Beleg dafür gesehen werden. Mit der Asienkrise Ende der neunziger Jahre und der Vereinnahmung dieser Diskussion als Herrschaftsideologien waren Ideen einer auf »asiatischen Werten« basierenden asiatischen Moderne allerdings weitgehend diskreditiert.
Entwicklungssoziologie oder Soziologie der Entwicklungsländer?
Als vergleichende Soziologie von Modernisierungsprozessen verfolgt die Entwicklungssoziologie ein sehr breites Programm, was eine eingrenzende Bestimmung des konkreten Gegenstandes erschwert. Vor allem drei Perspektiven lassen sich unterscheiden. Als allgemeine Soziologie der Entwicklung knüpft sie an Theorien des sozialen Wandels, der Zivilisationstheorien und der Sozialgeschichte an. Ein deutlich engerer Fokus ist, Entwicklungssoziologie als Soziologie der Entwicklungsländer zu verstehen, der es darum geht, die besonderen gesellschaftlichen Formen und Dynamiken der Entwicklungsländer zu erfassen. Eine noch weitergehende Einschränkung ist Entwicklungssoziologie als Soziologie der Entwicklungsorganisationen und Entwicklungsprojekte zu definieren. Hier bilden organisationssoziologische sowie Theorien sozialer Bewegungen eine Grundlage.
Ein besonderes Feld der Entwicklungssoziologie sind Globalisierungsprozesse, in denen diese diversen Fragestellungen verbunden sind. Internationale Entwicklungsorganisationen und soziale Bewegungen sind Kernbereiche der Globalisierung. Durch Globalisierung verschwimmen regionale Differenzen wie z. B. zwischen Zentrum und Peripherie oder entwickelten und Entwicklungsländern. Nicht zuletzt durch Auslagerungen von Industrien im Rahmen der »neuen internationalen Arbeitsteilung«, die ein Faktor der rapiden Industrialisierung in den Schwellenländern und struktureller Arbeitslosigkeit in den Industrieländern darstellt, der Transnationalisierung der Medien und Informationstechnologie sowie globaler Migration haben sich diese Differenzen in die Länder und Regionen selbst verlagert. Ebenso wie es in den Entwicklungsländern höchst entwickelte Regionen gibt, finden sich in den entwickelten Ländern unterentwickelte Gebiete. Zentrum und Peripherie sind damit keine Kategorien regionaler Differenzierung, sondern finden sich als Inklusion und Exklusion überall.
Über die Analyse allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse, zu denen Globalisierungsprozesse gehören, lassen sich Prozesse der Inklusion und Exklusion auf globaler Ebene erfassen, was es erlaubt, räumliche Festlegung im Sinne von Entwicklungs- und entwickelten Ländern aufzulösen. Weiterhin gelingt es, spezifische Organisationsformen globaler Gesellschaft, nämlich transnationale Organisationen und Bewegungen zu benennen und in ihrer Bedeutung für Differenzierungen innerhalb der globalen Gesellschaft zu erfassen. Die besondere Perspektive der Analyse von Globalisierungsprozessen der Entwicklungssoziologie verbindet so lokale Dynamiken und globale Prozesse im Sinne der Lokalisierung des Globalen, was am offensichtlichsten in den Städten ist, als auch die Untersuchung der Globalisierung lokaler gesellschaftlicher Spezifika.
Entwicklungssoziologische Analyse der Entwicklungsländer
Entwicklungssoziologie als Soziologie gesellschaftlicher Entwicklung oder als Soziologie der Entwicklungsländer verbindet sich, wenn die Kreation der Entwicklungsländer selbst das Thema ist. Folgt man den statistischen Daten der Weltbank und dem Human Development Index, so zeigt sich, dass einige »Entwicklungsländer« deutlich höhere Werte aufweisen als manche Länder, die nicht als solche bezeichnet werden. Hier drückt sich eine Form von Orientalismus aus: »As much as the West itself, the Orient (or Entwicklungsländer) is an idea that has a[99] history and a tradition of thought, imagery, and vocabulary that have given it reality and presence in and for the West« (Said 1978, 4 f.). Mit der Konstruktion der Entwicklungsländer als Teil einer modernen Weltgesellschaft, ist es einerseits möglich, Prozesse der Modernisierung moderner Gesellschaften zu beschreiben und andererseits diejenigen Aspekte der Moderne, die nicht dem europäischen Idealtypus entsprechen – wie Despotie, dauerhafte Verarmung, Patronage etc. – als spezifische regionale Sonderfälle auszuklammern.
Indem in einer entwicklungssoziologischen Perspektive die Geschichte der Interaktionen und Machtdifferentiale der globalen Gesellschaft einbezogen werden, wird eine implizite Verräumlichung der Soziologie vermieden, wie sie z. B. Peters vornimmt. Nach Peters ist Gesellschaft »eine individuierte Entität mit eindeutigen Grenzen und Mitgliedschaft nach dem Muster nationalstaatlich organisierter Gesellschaften. Solche Gesellschaften werden als relativ autark betrachtet in dem Sinne, dass sie wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Selbstreproduktion erschließen« (Peters 1993, 59). In einer entwicklungssoziologischen Perspektive ist es demgegenüber möglich, die »Vielfalt der Moderne« (Eisenstadt 2002) empirisch zu untersuchen und damit auch einige der impliziten Annahmen zu relativieren. Die entwicklungssoziologisch relevante Frage ist dann nicht, wie traditionale Gesellschaften sich modernisieren, was für die Modernisierungstheorien seit den 1950er Jahren zentral war, sondern Modernisierung als globalen Prozess umstrittener Institutionalisierung zu analysieren, im Rahmen dessen besondere Differenzierungen institutionalisiert werden.
Postkoloniale und Postdevelopment-Kritik am Entwicklungskonzept
Ab der Mitte der 1980er Jahre etablierte sich eine gegenläufige Strömung zum vorherrschenden Entwicklungsparadigma. Esteva (1985) und Sachs (1992) dekonstruierten »Entwicklung« als Legitimation zum Eingriff in die Lebenswelten der »Unterentwickelten«. Auch die stetige Umdefinition von »Entwicklung« durch Anhängen von Suffixen wie grundbedürfnisorientiert, nachhaltig, partizipativ oder menschlich änderten daran nichts. Durch Escobar (1995), der in Rekurs auf Michel Foucault »Entwicklung als Diskurs« bezeichnete, ermöglicht dieser eine hegemoniale Form der Wissensproduktion (durch den globalen Norden) und damit eine Fortschreibung der Herrschaftsausübung über die »Dritte Welt«. Diese postkoloniale Perspektivierung, die in den Protagonisten E. Said (1978), G. Spivak (1988) und H. Bhabha (2000) ihre prominentesten AnhängerInnen findet, untersucht Kontinuitäten und Diskontinuitäten kolonialer Repräsentation und der darin verwirklichten Machtverhältnisse.
Eine gänzliche Ablehnung des Konzeptes »Entwicklung« ist im Anschluss an die Postdevelopment-Kritik formuliert worden, die den Entwicklungsdiskurs als eurozentrisch, entpolitisierend und autoritär bezeichnet (Ziai 2007). Durch die Zweiteilung in entwickelte und unterentwickelte Länder begreift der eurozentrische Entwicklungsdiskurs die historische Entstehung der westlichen Gesellschaften als universell und impliziert eine Fortsetzung kolonialen Überlegenheitsdenkens als ideale Norm und defizitäre Abweichung: Der Süden hat Probleme und der Norden bietet die Lösungen an. Er ist entpolitisierend, da »Entwicklung« suggeriert, ein Land habe einen gemeinsamen Lebensstandard und entwicklungspolitische Maßnahmen würden dem Allgemeinwohl dienen, wobei strukturelle Ungleichheiten, unterschiedliche Interessen der Bevölkerungsgruppen und Konflikte ausgeblendet werden. Und drittens sei »Entwicklung« autoritär, da Expert/innenwissen implizit von der notwendigen Veränderung anderer Lebensformen ausgehe und somit die Durchsetzung sozialtechnologischer Maßnahmen auch gegen den Willen der Betroffenen erlaube. Und dennoch gilt es im Sinne von Ferguson letztlich zu konstatieren: »Es erscheint uns heute nahezu unsinnig, abzustreiten, dass es ›Entwicklung‹ gibt, oder das Konzept als bedeutungslos zu verwerfen, gerade so wie es im 19. Jahrhundert schlichtweg unmöglich gewesen sein muss, das Konzept ›Zivilisation‹ abzulehnen oder im zwölften Jahrhundert das Konzept ›Gott‹.« (1994, xiii).
Literatur
Anwar, Ibrahim, 1996: The Asian Renaissance, Singapore/ Kual Lumpur. – Bhabha, Homi, 2000: Die Verortung der Kultur, Tübingen. – Eisenstadt, Shmuel N., 2002: Multiple Modernities, Brunswick, New Jersey. – Escobar, Arturo, 1995: Encountering Development: The making and unmaking of the Third World, Princeton, New York. – Esteva, Gustavo, 1985: Development. Metaphor, Myth, Threat; in: Development: Seeds of Change, No. 3, 78–79. – Ferguson, [100]James, 1994: The Anti-Politics Machine. ›Development‹, Depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis. – Goetze, Dieter, 2002: Entwicklungssoziologie. Eine Einführung, Weinheim/München. – Menzel, Ulrich, 1992: Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der großen Theorien, Frankfurt a. M. – Peters, Bernhard, 1993: Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt a. M. – Sachs, Wolfgang (Hg.), 1992: Dictionary of development, London. – Said, Edward W., 1978: Orientalism. Western Conceptions of the Orient, London/New York. – Spivak, Gayatri C., 1988: Can the subaltern speak? In: Grossberg, Lawrence; Nelson, Cary (Hg.): Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana, 271–313. – Ziai, Aram, 2007: Development Discourse and Its Critique. An Introduction to Post-Development; in: ders. (Hg.): Exploring Post-Development. Theory, Practice, Problems and Perspectives, London, 3–17.
Rüdiger Korff/Eberhard Rothfuß
Erbe-Umwelt-Theorie
Sie fragt nach dem relativen Beitrag von Erbe und Umwelt (engl. nature – nurture) auf körperliche und Verhaltensmerkmale, in denen sich Individuen derselben biologischen Art unterscheiden. Das Erbe wird dabei klassischerweise durch das von den Eltern geerbte Genom definiert. Alles andere ist Umwelt (z. B. die mütterliche Eizelle ohne Genom, die pränatale Umwelt). Die Gene (funktional definierte Abschnitte des Genoms) unterscheiden sich innerhalb einer biologischen Art fast nicht. Was variiert, sind die Allele (Varianten desselben Gens). Z. B. haben alle Menschen ein Blutgruppen-Gen, das in den Varianten A, B, 0 vorkommt. Bei Menschen lautet daher die Erbe-Umwelt-Frage: Welcher Anteil der in einem bestimmten Alter beobachtbaren Merkmalsvariation geht auf Unterschiede in den Allelen und welcher Anteil auf Unterschiede in den erfahrenen Umweltbedingungen zurück? Zur Beantwortung dieser Frage gibt es zwei völlig verschiedene Methoden.
Indirekte Schätzungen durch genetisch sensitive Designs
Hierbei wird die Ähnlichkeit von Merkmalen zwischen genetisch Verwandten ähnlichen Alters bestimmt, z. B. zwischen eineiigen Zwillingen (genetisch identisch), zweieiigen Zwillingen und biologischen Geschwistern (50 % in Allelen identisch) und Adoptivgeschwistern (0 % identisch). Eine höhere Merkmalsähnlichkeit bei genetisch ähnlicheren Paaren wird dabei interpretiert als genetischer Einfluss, wobei der genetische Anteil an der Merkmalsvarianz (die Heritabilität des Merkmals) quantitativ durch Korrelationsdifferenzen bestimmt wird (vgl. z. B. Asendorpf 2007, 336 ff. für die Methodik). Die Ergebnisse variieren u. a. mit dem Merkmal (die Heritabilität ist bei Körpergröße ca. 85 %, bei Testintelligenz ca. 50 %, bei vielen Einstellungen nahe 0 %) und mit dem Alter (z. B. beträgt sie bei Testintelligenz ca. 20 % im Vorschulalter, aber ca. 75 % im hohen Alter.
Diese relativen Einflussschätzungen verdecken die Tatsache, dass es Genom-Umwelt-Interaktionen und -Korrelationen gibt, die als »neutrale« Anteile in die Schätzungen eingehen. Bei G-U-Interaktionen hängen die Effekte genetischer Unterschiede von den Umweltbedingungen ab und umgekehrt. Bei Korrelationen häufen sich bestimmte Genome in bestimmten Umwelten, wobei dies daran liegen kann, dass bestimmte Umwelten aufgesucht oder vermieden werden (aktive G-U-Korrelation), dass andere aufsuchend oder vermeidend auf genetisch mitbestimmte Merkmale eines Individuums reagieren (reaktive G-U-Korrelation) oder dass genetisch Verwandte diese Umwelt herbeigeführt haben (passive G-U-Korrelation). Deshalb können empirisch gefundene Korrelationen zwischen Umweltbedingungen und Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. Erziehungsstil der Eltern und Aggressivität ihrer Kinder) genetisch mitbedingt sein (alle drei Korrelationsarten können dazu beitragen).
Direkte Schätzungen durch Genomanalysen
Hierbei werden weite Anteile des Genoms molekulargenetisch sequenziert und Merkmalsunterschiede mit dem Vorkommen bestimmter Allele korreliert. In derartigen genomweiten Assoziationsstudien werden typischerweise tausende von Allelen gleichzeitig untersucht, so dass das Hauptproblem die Kontrolle zufälliger Korrelationen ist. Einzelne Allele erklären bei Persönlichkeitsmerkmalen höchstens 2 % der beobachteten Unterschiede, so dass an deren Zustandekommen sehr viele Gene beteiligt sein müssen (Asendorpf 2011).
[101]Epigenetik
Letztlich ist das Vorhandensein von Allelen nur insofern relevant, als sie tatsächlich Funktionen im Stoffwechsel ausüben (Genexpression). Deshalb interessiert sich die neuere Genetik vor allem für die Epigenetik (die z. T. umweltabhängige »Programmierung« der Expression von Genen). Da es Beispiele der Vererbung umweltbedingt erworbener epigenetischer Effekte im Tierversuch gibt, gilt die Gleichsetzung Erbe = Gene heute nicht mehr (Asendorpf 2011).
Literatur
Asendorpf, Jens B., 2007: Psychologie der Persönlichkeit, 4. Aufl., Heidelberg. – Ders., 2011: Verhaltens- und molekulargenetische Grundlagen; in: Schneider, Wolfgang; Lindenberger, Ulman (Hg.): Entwicklungspsychologie, 7. Aufl., Weinheim, 81–96.
Jens B. Asendorpf
Erklärung
Im Alltagssprachgebrauch ist eine Erklärung (engl. explanation) jede Erläuterung, die zum besseren Verständnis eines Sachverhaltes oder Vorgangs dienen kann. Erklärungen sind »kommunikative Akte«, das heißt grundsätzlich eingebunden in soziale Interaktionen.
Um den Begriff der (sozial)wissenschaftlichen Erklärung existiert eine umfangreiche philosophische Debatte. Ein wichtiger Bezugspunkt dieser Debatte ist das Konzept der »deduktiv-nomologischen (DN-)Erklärung« von C. G. Hempel und P. Oppenheim (1948). Bei einer DN-Erklärung wird ein Satz über einen zu erklärenden Sachverhalt, das sog. »Explanandum« (lat: »das zu Erklärende«) dadurch erklärt, dass eine Reihe von allgemeinen Gesetzesaussagen herangezogen wird, bei deren Geltung das Explanandum-Ereignis dann notwendigerweise eintreten muss, wenn bestimmte Anfangs- oder Randbedingungen gegeben sind. Gesetzesaussagen und Sätze über Anfangsbedingungen bilden zusammengenommen das »Explanans« (lat: das »Erklärende«). Zur Erläuterung einer DN-Erklärung nach dem sog. »Hempel-Oppenheim (HO) -Schema« werden meist naturwissenschaftliche Alltagsbeispiele verwendet: Dass eine volle Bierflasche, die man zur schnellen Kühlung in eine Tiefkühltruhe gelegt und dann vergessen hat, zerbricht (das Explanandum), kann man dadurch erklären, dass Wasser (und damit auch Bier) beim Gefrieren an Volumen zunimmt (eine allgemeine Gesetzmäßigkeit) und dass das Eisfach eine Temperatur unter 0 Grad Celsius hatte und die Bierflasche vorschlossen war (die konkreten Anfangsbedingungen).
Für eine DN-Erklärung nach dem HO-Schema gelten drei sog. »logische Adäquatheitsbedingungen«: das Explanans muss erstens mindestens ein allgemeines Gesetz enthalten, das Explanandum muss sich zweitens logisch aus dem Explanans ableiten lassen und drittens empirisch überprüfbar sein. Hinzu kommt eine »empirische Adäquatheitsbedingung«: Gesetzesaussagen und Aussagen über Anfangsbedingungen müssen wahr sein. Zusammengenommen führen diese Anfangsbedingungen dazu, dass eine DN-Erklärung einer Prognose logisch äquivalent ist: Das bedeutet, dass eine Erklärung nur dann als wissenschaftliche Erklärung nach dem HO-Schema gelten kann, wenn sie sich zu einer Vorhersage nutzen lässt: Wenn man eine Flasche Bier in die Tiefkühltruhe legt und dort vergisst, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie irgendwann zerbricht. Ein Merkmal pseudowissenschaftlicher Erklärungen ist es demgegenüber, dass diese oft erst nach dem Geschehnis (»ex post«) formuliert werden und zur Prognose von Ereignissen nicht geeignet sind.
Hempel und Oppenheim vertreten in Bezug auf ihr Erklärungsschema eine einheitswissenschaftliche Position, das heißt sie legen Wert auf die Feststellung, dass das HO-Schema für alle Wissenschaften gleichermaßen gültig ist. Auch soziales Handeln, soziale Prozesse und soziale Strukturen müssten sich dementsprechend auf Gesetze zurückführen lassen, die wie die Naturgesetze raumzeitlich universell gelten. Ob solche Gesetze allerdings existieren und gefunden werden können, ist streitig. Einer Unterscheidung des Erziehungswissenschaftlers und Philosophen W. Dilthey zwischen naturwissenschaftlichem Erklären und geisteswissenschaftlichen Verstehen folgend sehen viele Autoren deshalb im Konzept des sozialwissenschaftlichen »Verstehens« eine Alternative zur DN-Erklärung, mit deren Hilfe eine spezifisch geistes- und sozialwissenschaftliche Methodologie begründet werden kann. Da aber auch das Verstehen sozialen Handelns einen Rückgriff auf allgemeinere Konzepte (etwa auf kulturell geteilte[102] Wissensbestände) voraussetzt, existiert eine sehr langdauernde und teilweise ausgesprochen komplexe philosophische Debatte in der Handlungsphilosophie über die Frage, inwieweit Verstehen und Erklären tatsächlich verschiedene Erkenntnismodi zugeordnet werden können (Wright 2008). Im Zentrum steht dabei die Frage, bis zu welchem Ausmaß Handlungsbegründungen analog zu den von den Naturwissenschaften untersuchten kausalen Ursachen von Ereignissen betrachtet werden können.
Literatur
Dilthey, Wilhelm, 1900: Die Entstehung der Hermeneutik; in: Strübing, Jörg; Schnettler, Bernt (Hg.), 2004: Methodologie interpretativer Sozialforschung. Klassische Grundlagentexte, Konstanz, 19–42. – Hempel, Carl Gustav; Oppenheim, Paul, 1948: Studies in the Logic of Explanation; in: Philosophy of Science 15, 135–175. – Wright, Georg Henrik von, 2008: Erklären und Verstehen, Frankfurt a. M.
Udo Kelle
Ernährungssoziologie (Soziologie des Essens)
Die Ernährungssoziologie (engl. sociology of food) gehört bislang nicht zu den etablierten, theoretisch und methodisch ausgearbeiteten speziellen Soziologien. Auch die soziologischen Klassiker haben sich mit dem Essen bis auf wenige Ausnahmen – etwa Norbert Elias’ Studie »Über den Prozess der Zivilisation« und Pierre Bourdieus Untersuchung »Die feinen Unterschiede« – nur punktuell befasst. Dies liegt insbesondere daran, dass das Verhältnis von Natur (Ernährung) und Kultur (Essen) für die Soziologie schwer zu fassen ist, die Befriedigung dieses Grundbedürfnisses zum Alltagsgeschehen gehört und deshalb als von geringer sozialer Gestaltbarkeit gilt. Zudem waren Beschaffung und Zubereitung von Nahrung traditionell weibliche Tätigkeiten und wurden entsprechend dem Geschlechterverhältnis gesellschaftlich abgewertet (Setzwein 2004).
Dieser geringen soziologischen Beachtung steht die enorme soziale Tragweite der Ernährung und des Essens gegenüber. Nicht nur lassen sich beinahe alle sozialen Phänomene am Beispiel des Essens studieren, das Nahrungsbedürfnis gilt zudem als Ursprung grundlegender gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse, weshalb Marcel Mauss (1990) von einem »gesellschaftlichen Totalphänomen« sprach und Claude Lévi-Strauss (1973) davon ausging, dass in der Nahrung die Gesamtheit der gesellschaftlichen Strukturen auf unbewusste Weise ausgedrückt wird. Georg Simmel (1957) führte am Beispiel der Mahlzeit aus, wie aus einem »primitiv« physiologischen Bedürfnis ein soziales »Gebilde« von »unermeßlicher Bedeutung« entsteht, für Max Weber (1990) stand fest, dass »die Entfaltung des rationalen Wirtschaftens« aus dem »Schoße der instinktgebundenen reaktiven Nahrungssuche« stammt, und George Ritzer (1997) hat am Beispiel des Essens dargelegt, was er unter der McDonaldisierung der Gesellschaft versteht. Dies sind typische Beispiele für soziologische Thematisierungen des Essens: Es wird zur Veranschaulichung allgemeiner sozialer Phänomene genutzt oder bildet den Ausgangspunkt für umfassende gesellschaftliche Analysen. Die soziale Eigenlogik des Essens wird dagegen kaum untersucht.
Für die Ausarbeitung einer speziellen Soziologie des Essens ist eine solche Vorgehensweise jedoch unzureichend. Sie steht vor der Aufgabe, sowohl der Eigenart des Gegenstands gerecht zu werden, ohne sich in Details zu verlieren, als auch zu zeigen, wie Essen in allgemeine soziale Strukturen und Prozesse eingebunden ist (Barlösius 2011). Die Soziologie des Essens ist deshalb eine spezielle Soziologie, die einerseits für ihren Gegenstand angemessene spezifische Erklärungen und Systematisierungen entwickelt und andererseits auf allgemeine soziologische Theorien zurückgreift, um ihr Sujet in größere gesellschaftliche Zusammenhänge wie Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungs-, Differenzierungsund Desintegrationsprozesse einzubetten.
Literatur
Barlösius, Eva, 2011: Soziologie des Essens, Weinheim. – Bourdieu, Pierre, 1984: Die feinen Unterschiede, 3. Aufl., Frankfurt a. M. (1979) – Elias, Norbert, 1981: Über den Prozeß der Zivilisation, Bd. 1., 8. Aufl. Frankfurt a. M. (1939). – Kiple, Kenneth; Ornelas, Connee K. (Eds.), 2000: The Cambridge World History of Food, New York. – Lévi-Strauss, Claude, 1973: Mythologie III. Der Ursprung der Tischsitten, Frankfurt a. M. – Mauss, Marcel, 1990: Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt a. M. – Ritzer, George, 1997: Die McDonaldisierung der Gesellschaft, Frankfurt a. M. – Setzwein, Monika, 2004: Ernährung – Körper – Geschlecht, Wiesbaden. – Simmel, Georg, 1957: Soziologie der Mahlzeit; ders. (Hg.): Brücke [103]und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, Stuttgart, 243–250. – Weber, Max, 1980: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen.
Eva Barlösius
Erwünschtheit, soziale
Soziale Erwünschtheit (engl. social desirability) oder auch ›Effekt der Konformität‹ bezeichnet in empirischen Umfragen eine systematische Antwortverzerrung in eine bestimmte Richtung. Soziale Erwünschtheit liegt vor, wenn der Befragte dazu neigt, seine Einstellungen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen in ein günstigeres Licht zu stellen, indem er nicht seine eigene Antwort gibt, sondern eine solche, von der er annimmt, dass sie (eher) der gesellschaftlichen Norm entspricht. Soziale Erwünschtheit basiert auf der theoretischen Annahme, dass für die vom Befragten gegebene Antwort im Prinzip ein »wahrer Wert« existiert, von der die tatsächlich gegebene Auskunft im Falle von sozialer Erwünschtheit jedoch abweicht. Liegt soziale Erwünschtheit in einer Befragung vor, ist die Gültigkeit der Aussage nicht mehr in vollem Umfang gegeben.
Grundsätzlich sind alle Fragen, die Werte und Normen der Gesellschaft betreffen, anfällig für soziale Erwünschtheit; der Grad der sozialen Erwünschtheit hängt dabei jedoch stark mit dem Thema bzw. den erfragten Merkmalen (Items) der Untersuchung zusammen, indem sie einen unterschiedlich hohen Anreiz für soziale Erwünschtheit auslösen (trait desirability). Beispiele für solche Themen sind allgemein heikle oder peinliche Themen, Umfragen zum Alkohol- oder Drogenkonsum, zur Parteipräferenz bzw. Einstellungen zu Extremparteien, Fremdenfeindlichkeit, aber auch Fragen über Fernsehsendungen (hier z. B. Aussagen hinsichtlich bevorzugter Fernsehprogramme im Vergleich zu den tatsächlichen Einschaltquoten).
Zu den Entstehungsbedingungen von sozialer Erwünschtheit zählen zum einen der persönlichkeitstheoretische Ansatz, bei dem das Verhalten auf ein generelles Bedürfnis nach sozialer Anerkennung (Need for Social Approval) zurückgeführt wird und zum anderen der handlungstheoretische Ansatz: Hierbei differenziert Esser zwischen sozial erwünschten Antworten, die eine Anpassung an gesellschaftliche Normen beabsichtigen (kulturelle Erwartungen) und solchen, die situationsspezifisch durch Merkmale wie z. B. Geschlecht oder Alter, Eigenschaften oder Verhaltensweisen des Interviewers oder die Anwesenheit Dritter verursacht werden (situationelle Erwartungen). Auch hier wird die Angabe sozial erwünschter Antworten als Strategie erklärt, eine Maximierung der sozialen Anerkennung (Verhaltensbestätigung, Vermeidung negativer Sanktionen) anzustreben.
Das tatsächliche Ausmaß bzw. der Effekt von sozialer Erwünschtheit ist nur schwer zu bestimmen. Nach Paulhus (1984) werden die beiden Dimensionen Selbsttäuschung und Fremdtäuschung unterschieden, wobei nur die Fremdtäuschung als eine absichtliche, bewusste Täuschung verstanden werden kann; bei der Selbsttäuschung handelt es sich dagegen um eine »Tendenz, die Realität in einer optimistischen Weise verzerrt wahrzunehmen« (Winkler et al. 2006, 3); dabei zeichnet »ein gewisses Maß an Selbsttäuschung ein psychisch gesundes Individuum aus« (ebd.).
Maßnahmen, um soziale Erwünschtheit in Umfragedaten zu vermeiden bzw. gering zu halten, sind während der Interviewsituation z. B. geschickte Frageformulierungen, der Einsatz von Skalen oder die sog. Randomized-Response-Technik, wodurch der Anteil der ehrlichen Antworten geschätzt werden soll, sowie nachträgliche statistische Kontrollprozeduren (einen Überblick zu den Gegenmaßnahmen bietet Diekmann 2010, 446 ff.).
Literatur
Diekmann, Andreas, 2010: Empirische Sozialforschung, Reinbek. – Esser, Hartmut, 1991: Die Erklärung systematischer Fehler in Interviews; in: Wittenberg, Reinhard (Hg.): Person – Situation – Institution – Kultur, Berlin, 59–78. – Paulhus, Delroy L., 1984: Two-Component Models of Socially Desirable Responding; in: Journal of Personality and Social Psychology 46, 598–609. – Schnell, Rainer et al., 2011: Methoden der empirischen Sozialforschung, 9. Aufl., München. – Winkler, Nils et al., 2006: Entwicklung einer deutschen Kurzskala zur zweidimensionalen Messung von sozialer Erwünschtheit, Berlin (DIW).
Silke Kohrs
[104]Ethnomethodologie
Die Ethnomethodologie (engl. ethnomethodology) ist ein von Harold Garfinkel (1967) begründeter wissenssoziologisch-konstruktivistischer Forschungsansatz, der sozialtheoretische Fragestellungen mit Hilfe empirischer Untersuchungen sozialer Praktiken verfolgt. Der Ausdruck ›Ethnomethodologie‹ leitet sich vom Begriff Ethnoscience her, einem Ansatz in der Ethnologie, der sich für das Wissen interessiert, mit dem die Angehörigen einer fremden Kultur die Dinge ihrer Welt wahrnehmen, definieren, klassifizieren und ihnen so eine Bedeutung zuschreiben. Diese ›Ordnung der Dinge in den Köpfen der Leute‹ umfasst etwa ihre Ethnokosmologie, Ethnobiologie und Ethnomedizin. Von dort führen drei Verschiebungen zur Ethnomethodologie als (1.) kulturbeobachtendem, (2.) reflexivem und (3.) praxistheoretischem Ansatz:
Was heißt Ethnomethodologie?
1 Der Ethnomethodologie geht es um das Wissen in der eigenen Gesellschaft. Diese wird also einem ethnologischen Blick ausgesetzt. Einen solchen Blick muss man sich erarbeiten. Die Ethnomethodologie entwickelt daher ähnlich wie Erving Goffman eine Reihe von Strategien der Verfremdung des soziologischen Gegenstands und der Entfremdung und Distanzierung des soziologischen Beobachters (s. u.).
2 Der Ethnomethodologie geht es um die Ethno soziologie: das Alltagswissen über Gesellschaft in der Gesellschaft, das man soziologisch kennen muss, um zu verstehen, warum die Leute tun, was sie tun. Damit betreibt sie zugleich eine reflexive Aufklärung von Denkvoraussetzungen der Soziologie. Sie kritisiert an deren szientistischen Überwindungsversuchen des Alltagswissens, dass sie dessen Prämissen verhaftet bleibt. Eine professionell betriebene Soziologie dürfe nicht laufend als Denkmittel und Ressource einsetzen, was doch ihr primärer Gegenstand sei, den sie sich vor Augen führen müsse: das Alltagswissen vom Sozialen. Sonst entstünde nur ›folk-sociology‹, distanzlos verwachsen mit den kulturellen Selbstverständlichkeiten des Untersuchungsfeldes.
3 Dieses Alltagswissen unterscheidet sich in drei Hinsichten von sozialwissenschaftlichem Wissen:(1) Seine sprachlichen Ausdrücke sind äußerst ungenau, sie bekommen ihre Eindeutigkeit nur in den jeweiligen Umständen ihres situativen Gebrauchs. Garfinkel sieht eben diese Vagheit (im Einklang mit der Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins) als etwas Rationales: Sie ist essentiell für das Funktionieren alltäglicher Sozialität.(2) Das Alltagswissen besteht, wie schon Alfred Schütz in seiner Sozialphänomenologie betonte, wesentlich aus stillschweigenden Annahmen, Glaubensüberzeugungen und Unterstellungen, die zu selbstverständlich sind, als dass darüber gesprochen würde: ein implizites Wissen. (3) Es ist z. T. überhaupt nicht sprachfähig, eher ein stummes körperliches Können, ein praktisches Wissen, etwas zu beherrschen, ohne genau sagen zu können, wie wir es vollziehen: etwa ein Gespräch führen (das Thema der ethnologischen Konversationsanalyse: Atkinson/Heritage 1984), eine Frau darstellen (ein Thema der ethnologischen Gender Studies: West/Zimmerman 1987), ein Klavier spielen (Sudnow 1978, eines von vielen Themen der ethnologischen studies of work: Garfinkel 1986) oder einen Text zu formulieren und zu gebrauchen (der Fokus der ethnologischen Diskursanalyse: Smith 1986). Eben diese Form des Wissens ist der Grund, von Ethnomethodologie zu sprechen. Gemeint sind die praktischen Methoden der Leute, ihre Alltagswelt hervorzubringen, ihr praktisches Wissen, Handlungen zu vollziehen. Mit diesem praktischen Wissen, wie etwas zu tun ist, vollziehen sie (wir) zugleich ihre (unsere) kulturellen Annahmen darüber, woraus die soziale Welt besteht. Die rationalitätskritische Betonung der Implizität praktischen Wissens teilt die Ethnomethodologie dabei mit anderen praxistheoretischen Ansätzen (etwa von Erving Goffman, Pierre Bourdieu oder Clifford Geertz).
Forschungstechniken der Befremdung
Im Versuch, stillschweigendes und körperlich vollzogenes Wissen empirisch beobachtbar zu machen, entwickelten ethnologische Studien unterschiedliche Befremdungstechniken. Fünf seien hier genannt:
1 Die sogenannten Krisenexperimente arrangieren eine Störung der sinnhaften Normalität von Situationen durch ein Fehlverhalten, das es ihren Teilnehmern unmöglich macht zu begreifen, was gerade [105]vor sich geht, und ihre Sinnwelt wieder zu ordnen. Garfinkel forderte etwa seine Studenten auf, ihre Eltern einen Tag lang zu siezen. Das Ziel war, auf diese Weise sichtbar zu machen, welch fundamentale Erwartungen unsere Interaktionen regulieren. Die Krisenexperimente sollten dabei nicht Personen, sondern Situationen verwirren und ›verrückt‹ machen. Es stellte sich aber heraus, dass es zu den elementaren Reparaturmaßnahmen gehört, die Verwirrtheit der Situation Personen zuzuschreiben. Die Zurechnung auf Personen (»entweder der spinnt oder ich«) ist bereits eine Normalisierungsmaßnahme, mit der wir die Sinnstörung einer Situation auf Personen abschieben.
2 Der Rückgriff auf ›Fremde in der eigenen Kultur‹ nutzt diese als Beobachtungsexperten für Normalität. Das gilt etwa für Behinderte (in den Disability Studies), die ein geschärftes Bewusstsein von der Rolle des Körpers in Arbeitsvollzügen und Kommunikation haben (etwa Länger 2002), und es gilt für Garfinkels klassische Studie über eine Transsexuelle: Ihre Außenseiterposition wirkte wie ein Vehikel, das dem Soziologen die Distanzierung von seinen erlernten Denkgewohnheiten erleichterte. Wer sich selbst nicht für normal halten kann (keinen Platz in vorgefundenen kulturellen Kategorien findet), kann auch seine Umwelt nicht so betrachten. Und die Soziologie profitiert von der Krisenhaftigkeit dieser Weltwahrnehmung durch ›unfreiwillige Soziologinnen‹.
3 Die Konversationsanalyse arbeitet mit einem Befremdungseffekt, der durch die gewaltige Entschleunigung realzeitlicher Abläufe entsteht: Wenn sekundenkurze Sprechereignisse ›unter die Lupe genommen‹ werden, wird etwas so Vertrautes wie ein Gespräch zu einem staunenswerten Koordinationskunstwerk. Wer sich selbst einmal auf einem Tonband anhörte, alle Stotterer, Räusperer und Satzabbrüche transkribierte und deren Funktionen analysierte, versteht schnell, warum sich manche Ethnomethodologen auch Molekularsoziologen nennen und beanspruchen, wie Molekularbiologen Grundlagenforschung zu betreiben.
4 Eine begriffsstrategische Verfremdungsmaßnahme (ähnlich Goffmans Theatermetapher) schlug Harvey Sacks, ein Kollege Garfinkels, vor, um die soziologische Aufmerksamkeit beharrlich auf die Prozesshaftigkeit und praktische Vollzugsbedürftigkeit aller sozialen Tatsachen zu lenken. Soziologen sollten alle von ihnen wahrgenommenen Zustände mit der heuristischen Annahme betrachten, sie seien methodisch hervorgebracht: ein ›doing being‹. Wenn Soziologen z. B. jemanden als »wütend« wahrnehmen, also eine spontane Motivzuschreibung vornehmen, machen sie einfach nur von Alltagskompetenzen der Dechiffrierung eines Gesichtsausdrucks Gebrauch. Sacks empfiehlt, zur Verlangsamung dieses alltäglichen Verstehens die Unterstellung dazwischenzuschieben, dass dieses Wütendsein getan wird. Wir sollen uns also fragen, wie »doing being angry« geht, wie man das also macht. Wer einen Professor vor sich sieht, sollte sich fragen, wie »doing being a professor« geht, wie man es also bewerkstelligt, als ein solcher zu erscheinen und spontan erkannt zu werden. Das ›doing‹ ist also die methodologische Maxime der Praxisforschung der Ethnomethodologie: Betrachte jedes Phänomen so, als würde es gerade erst gemacht.
5 Gewissermaßen in Summierung dieser und anderer Techniken haben insbesondere die ethnologischen Science Studies (Lynch 1991, 1993) zu einer beträchtlichen Steigerung soziologischer Reflexivität beigetragen. Auf der Basis einer unbefangen ›ethnologischen‹ Beobachtungshaltung, einer temporären Indifferenz gegenüber Geltungsansprüchen und mit einer schamlos empiristischen Neugier auf soziale Praktiken lassen sich selbstverständlich auch soziologische Forschungspraktiken empirisch untersuchen, einschließlich der Schreib- und Formulierungspraktiken beim Verfassen eines Lexikonartikels und eines Satzes wie diesem.
Theoretische Positionierung
Sozialtheoretisch grenzte sich Garfinkel zunächst von Émile Durkheim ab, der soziale Tatsachen als Sachverhalte betrachtete, die unabhängig vom Erleben und Handeln gegeben sind. Die Ethnomethodologie soll genau dieses Erleben von der Faktizität des Sozialen hintergehen und das, was die Handelnden als objektiv gegeben wahrnehmen, als deren eigene praktische Hervorbringungen aufdecken. Für die Ethnomethodologie ist soziale Wirklichkeit eine reine Vollzugswirklichkeit, sie wird laufend ›verwirklicht‹. Die soziale Welt, in der wir handeln, ist die, die wir uns ›erhandeln‹ – die wir herbeireden, zurechtinterpretieren, [106]körperlich durchführen, uns gegenseitig zeigen und bestätigen.
Gegen die strukturell-funktionale Theorie von Talcott Parsons wandte Garfinkel ein, dass dieser die Akteure als »Beurteilungstrottel« erscheinen lasse, als Marionetten, die nur mehr auszuführen haben, was ihnen ein »kulturelles System« vorschreibt. Er ignoriere damit jene Sinnstiftungsleistungen, mit denen Handelnde kulturelle Regeln laufend situieren und interpretieren, was erforderlich ist, weil Regeln die Art ihrer Befolgung nicht selbst festlegen können. Das Problem sozialer Ordnung ist für Garfinkel daher ein Dauerproblem des »Ordnens«, das Interaktionsteilnehmer stets neu zu lösen haben.
Sie bewerkstelligen dieses beständige Ordnen, indem sie mit ihren Handlungen nicht nur die soziale Wirklichkeit einer Situation herstellen (etwa eine Warteschlange formen), sondern zugleich zum einen den Kontext dieser Situation anzeigen (etwa eine Warteschlange ›vor dem Bankschalter‹ und nicht etwa ›an der Bushaltestelle‹), zum anderen diese Praxis selbst als solche kenntlich (›accountable‹) machen (als Warteschlange und nicht als Pulk, zufällige Aufreihung, Polonaise o. Ä.). Menschliches Handeln ist insofern immer reflexiv auf sich selbst bezogen, als es immer auch metakommunikativ anzeigt, als was es verstanden sein will. Nicht nur in reflexiven ›Auszeiten‹ und nicht nur in sprachlichen Ausdrücken, die explizit bezeichnen, was man tut (z. B. »ich warne dich, das zu tun!«), auch schon in der einfachen körperlichen Orientierung beim Gehen tun Handelnde mehr als bloß eine Richtung zu nehmen: Sie zeigen an, dass sie es tun, und tragen so zur lokalen Produktion einer für alle beobachtbaren sozialen Ordnung bei.
Einordnung der Ethnomethodologie
Die Ethnomethodologie ist zum großen Teil eine empirische Umsetzung der Phänomenologischen Soziologie von Alfred Schütz. Zugleich hat sie mit deren bewusstseinsphilosophischen Prämissen gebrochen. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt nicht beim Subjekt, sondern in der sozialen Situation. Während Schütz den Sinn einer Handlung im vorangehenden subjektiven Entwurf des Handelnden suchte, zeigten ethnologische Studien, dass der Sinn ihrer Äußerungen erst ex post in der Interaktion mit dem Gegenüber festgelegt wird. Insofern hat die Ethnomethodologie die soziologische Aufmerksamkeit von der Intersubjektivität auf die Interaktivität verschoben. Dabei verweisen Handlungen und Äußerungen auch beständig und unvermeidlich auf den situativen Kontext, in dem sie gerade ablaufen. Sinn, so Garfinkel, ist daher ein öffentliches, beobachtbares Phänomen, es liegt nicht »unter der Schädeldecke«, sondern vollständig und ausschließlich in der Verhaltensumgebung einer Person. Garfinkel sieht die Soziologie also wie George Herbert Mead und Erving Goffman als Verhaltenswissenschaft.
Die Grenzen der Ethnomethodologie liegen vor allem in ihrer Beschränkung auf eine empirische Mikrosoziologie. Ein Ansatz, der in großem Respekt vor den Handelnden deren interpretative und performative Leistungen beschreibt und analysiert, bleibt reserviert gegenüber theoretischen Ansprüchen, neben der Interaktivität in sozialen Situationen auch die Intersituativität des Sozialen zu denken. Jüngere Autor/innen in der Nachbarschaft und Nachfolge der ethnomethodologischen Tradition (etwa Karin Knorr Cetina und Bruno Latour) verweigern sich daher auch weiterhin makrotheoretischen Abstraktionen. Stattdessen öffnen sie ihren Denkstil ›posthumanistischen‹ Überlegungen, die die Beteiligung von Artefakten, Medien und Körpern an Handlungsketten für die Soziologie zu erschließen versuchen.
Literatur
Einführend: Bergmann, Jörg, 2000: Ethnomethodologie; in: Flick, Uwe et al. (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Reinbek, 118–135. – Zimmerman, Don H.; Pollner, Melvin, 1976: Die Alltagswelt als Phänomen; in: Weingarten, Elmar; Sack, Fritz (Hg.): Ethnomethodologie, Frankfurt a. M., 64–104. / Weiterführend: Atkinson, Paul; Heritage, John, 1984: Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis, Cambridge. – Garfinkel, Harold, 1967: Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, NJ. – Ders., 1986: Ethnomethodological Studies of Work, London. – Länger, Caroline, 2002: Im Spiegel von Blindheit. Eine Kultursoziologie des Sehsinnes, Stuttgart. – Lynch, Michael, 1991: Pictures of Nothing? Visual Construals in Social Theory; in: Sociological Theory 9, 1–21. – Ders., 1993: Scientific Practice and Ordinary Action, Cambridge. – Smith, Dorothy, 1986: The Active Text. Texts as Constituents of Social Relations; in: dies. (ed.): Texts, Facts, and Femininity. Boston, 120–158. – Sudnow, David, 1978: Ways of the Hand. The Organization of Improvized Conduct, London. – West, Candace; Zimmerman, Don, 1987: Doing Gender; in: Gender and Society 1, 125–151.
Stefan Hirschauer
[107]Ethnologie
von gr. ethnos (ἔθνος) »Volk, Völkerschaft« und logos »Lehre«. Als Sozial- und Kulturwissenschaft hat Ethnologie zum Ziel, das Handeln von Menschen in der gesamten Breite des dem Menschen Möglichen zu verstehen und in seinen natürlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen und Zusammenhängen zu erklären. Aufgrund des allgemeinen, vergleichenden Ansatzes ist im englischen Sprachraum die Bezeichnung social anthropology (GB) bzw. cultural anthropology (USA) üblich. Zentrale methodologische Grundannahme ist, dass sich das Erkennen anthropologischer Gemeinsamkeiten und Unterschiede vor allem in der Auseinandersetzung mit anderen Gesellschaften und Kulturen bildet (daher »Wissenschaft vom kulturell Fremden«).
Wandel der Forschungsperspektive
Das Erkenntnisinteresse der Ethnologie als akademische Disziplin hat sich seit ihrer Entstehung im 19. Jh. stark verschoben. Als spezifischer Gegenstand der Ethnologie wurden lange Zeit Gesellschaften verstanden, die sich vermeintlich grundlegend von der eigenen, d. h. modernen, unterschieden: Naturvölker vs. Kulturvölker, primitive vs. zivilisierte, schriftlose vs. alphabetisierte, traditionelle vs. moderne, nichtstaatliche vs. staatliche, vorindustrielle vs. industrialisierte, unterentwickelte vs. entwickelte etc. Derartige universale Dichotomien haben sich durchweg als pseudowissenschaftliche Konstrukte erwiesen, die teilweise kolonialen Grundideen verpflichtet blieben, in deren Kontext sich die Ethnologie als Fach etabliert hatte. Sie bestätigten den »höheren Stand« der eigenen Gesellschaft und legitimierten den Imperialismus.
Als allgemein vergleichende Wissenschaft des Kulturellen und Sozialen konstituierte sich die Ethnologie erst sukzessive im 20. Jh. Im Laufe dieses Prozesses erwies sich auch die zweite Grundüberzeugung der Ethnologie, d. h. die wissenschaftliche Darstellbarkeit fremder sozialer Realität, als zunehmend zweifelhaft. Die folgende Krise der Repräsentation hat die Ethnologie seit den 1970er Jahren in einen tiefgreifenden Prozess der Selbstreflektion und Aufklärung geführt. Er lässt sich als verspätete Entkolonialisierung deuten, hängt aber auch mit anderen intellektuellen Strömungen der Zeit, v. a. der Postmoderne, zusammen. Die Ethnologie ist seitdem themenoffen und nicht auf einen bestimmten Typus von Gesellschaften fixiert. Als Anthropologie geht es ihr um die Aufklärung dessen, was den Menschen in allen Gesellschaften als soziales Wesen auszeichnet.
Ethnos und Ethnizität
Auch der Ethnos als Gegenstand der Ethnologie hat seine Selbstverständlichkeit verloren. Es hat sich gezeigt, dass ein primordiales Verständnis von Ethnien als geschlossene soziale Formationen mit eigener Sprache, Herkunft, Geschichte, Territorium, sozialer Organisation und Kultur sowie darauf rekurrierender Identität mehr imaginiert ist, als dass es auf historische oder gesellschaftliche Tatsachen verweist. Kulturelle Differenz und die Konstitution eigener Identität werden vielmehr durch den Austausch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren erst geschaffen. Die als unwandelbar imaginierte eigene Identität wächst mithin aus einem diskursiven Prozess, dessen Akteure je eigene Interessen verfolgen und der nur politisch zu verstehen ist. Ethnizität in diesem konstruktivistischen Sinne ist die regelmäßige Kommunikation sozialer und kultureller Unterschiede. Als Gegenstand einer diskursiven Formation ist sie trotz ihrer grundsätzlichen Formbarkeit nicht frei wählbar oder volatil und in der Regel mit der Ausübung von Macht oder Herrschaft verknüpft. Ethnizität kann in allen sozialen Figurationen entstehen, früheren wie zeitgenössischen. In modernen Staaten hat sie sich vielfach mit einem restriktiven Verständnis von Nationalität verschränkt und deren politische Instrumentalisierung befördert.
Methodischer Ansatz
Trotz wichtiger Beiträge zu politischen Debatten in der eigenen Gesellschaft bleibt die Auseinandersetzung mit fremden Lebenswelten zentral für die Identität der Ethnologie. Um essentialistische, notwendig normative Gegenstandsdefinitionen zu umgehen, definierte sich die neuere Ethnologie mehr über ihren methodischen Ansatz. Im Zentrum standen und stehen partizipative Methoden, die seit B. Malinowski (1922) unter dem Begriff Teilnehmende Beobachtung zusammengefasst werden. Spezifikum der Ethnologie als empirische Sozialwissenschaft ist, dass sich dabei der Ethnograph physisch und psychisch in die andere Gesellschaft einbringt. Elementar sind dichte Teilnahme am Leben der anderen Menschen[108] über einen langen Zeitraum, Beherrschung ihrer Sprache, Erwerb von Handlungsroutinen etc., die zur Integration in den Alltag führen. Dabei sollen auch jene als selbstverständlich hingenommenen Teile des fremden Alltags erfasst werden, die nicht reflektiert werden und sich folglich nur unzureichend mittels der Sprache und Interviews erfassen lassen. Obwohl Teilnahme und Beobachtung unterschiedlichen Modi der Erfahrung verpflichtet sind und unterschiedliche Daten generieren, treffen sie sich in einem grundsätzlich induktiven Vorgehen, welches in einem zirkulären Verfahren allfällige Hypothesen ständig hinterfragt und revidiert.
Ziel ist, die Außenperspektive des Ethnographen, d. h. die etische Sichtweise des Sozialen zu überschreiten und ihr die Binnenperspektive der Akteure, die emische Sicht, entgegenzusetzen. Erst aus dem Kontrast beider lassen sich sowohl das Eigene wie das Fremde erkennen. Diese gegenseitige Artikulation lässt sich als Kern einer ethnologischen Perspektive beschreiben. Theoretische Grundlage bleibt die Annahme, dass sich soziale und kulturelle Unterschiede nur aufgrund einer allen Menschen gemeinsamen anthropologischen Grundlage erkennen lassen. Quantitative Methoden spielen v. a. dort eine Rolle, wo die Ethnologie thematisch in den Bereich der Naturwissenschaften hineinreicht.
Neuere Ansätze
Universalien und anthropologische Konstanten auf der einen Seite sowie Kulturrelativismus auf der anderen Seite waren lange Zeit Gegenstand ethnologischer Debatten. In der jüngeren Ethnologie hat die Auseinandersetzung zwar an theoretischer Relevanz verloren, aber an politischer gewonnen. V.a. die fortlaufenden Auseinandersetzungen, ob Menschenrechte universal definiert werden können oder kulturell gebunden sind, haben erkennen lassen, dass es einmal mehr um eine diskursive Formation geht, in der die einzelnen Positionen sich eng mit Interessen der Akteure verknüpfen. Als ethnologische Denkfigur ist der Relativismus aber wirkungsmächtig geblieben, da er oft als methodologische Voraussetzung für die Überwindung des relativ natürlichen Ethnozentrismus ausgewiesen wird.
Die Ethnologie hat sowohl zu allgemeinen wie zu thematischen Sozialtheorien beigetragen. Neben den Kerndebatten um Ethnizität und Interkulturalität hat die Ethnologie spezifische Theorien vor allem im Bereich der Kultur, der sozialen Organisation und Verwandtschaft, der staatenlosen Gesellschaften, der Rolle dieser im kolonialen und postkolonialen Staat, der Gabe und des Tausches, des Rituals und der Kognition entwickelt. In der jüngeren Ethnologie sind u. a. allgemeine Beiträge zu Migration, Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen sowie Konfliktforschung hinzugekommen. Die theoretischen und methodischen Beziehungen zwischen der Soziologie und der Ethnologie sind vielfältig. So hat die Ethnologie maßgeblich die Reflexivitätsdebatte in der Soziologie beeinflusst, oder in neuerer Zeit die Netzwerkanalyse bereichert. Der Ort der Ethnologie ist die vergleichende Perspektive, indem sie die Auseinandersetzung mit dem Fremden in den Mittelpunkt von spezifischen und allgemeinen Erkenntnis- und Deutungszusammenhängen rückt.
Literatur
Barnard, Alan, 2000: History and Theory in Anthropology, Cambridge. – Eriksen, Thomas Hylland, 2001: Small Places, Large Issues: An introduction to social and cultural anthropology. London. – Fischer, Hans; Beer, Bettina (Hg.), 2003: Ethnologie: Einführung und Überblick, Berlin. – Kohl, Karl-Heinz, 1993: Ethnologie, die Wissenschaft vom kulturell Fremden, München.
Till Förster/Lucy Koechlin
Ethnozentrismus
Ethnozentrismus (engl. ethnocentrism) ist eine weltweit verbreitete, in der Entwicklungsgeschichte des Menschen angelegte und angesichts des Aufwachsens in einer bestimmten sozialen Umwelt unvermeidbare Neigung, Fremdes zuerst einmal nach dem Maßstab der eigenen Gesellschaft, Schicht, Berufsgruppe usw. zu erfassen und zu beurteilen. Damit ist er oft die Grundlage für Vorurteile, wenn man diese wertfrei als Urteile ohne gründliche »Beweiserhebung« ansieht. Erst wenn solche Neigungen und Einstellungen resistent gegen Korrekturen werden, die Wahrnehmung von Gegeninformationen verhindern und in Ideologie übergehen, werden sie zur Grundlage von Selbsttäuschung, Desorientierung und Konflikt. Dann wird die Eigengruppe überschätzt und jede Fremdgruppe abgewertet.
Angesichts der Unausweichlichkeit von Ethnozentrismus beim erstmaligen Wahrnehmen und[109] Überdenken von sozialen Phänomenen sind sowohl Alltags- als auch wissenschaftliche Theorien in ihrem Anfangsstadium häufig ethnozentrisch. Werden sie ohne Überprüfung auf ihre Richtigkeit auch in einer anderen Kultur dort zur Grundlage von praktischen Maßnahmen gemacht, können sie zu schwersten Schäden führen. »Die meisten Studien aus der ›Comparative Management‹ Schule sind amerikanisch-ethnozentrisch. Um den Ethnozentrismus zu beschränken, ist es unentbehrlich, dass Kulturforscher Toleranz für abweichende Werthaltungssysteme entwickeln und dass sie versuchen, ihre eigenen Werthaltungen explizit zu machen. Es ist wünschenswert, dass die Forschungsgruppen Forscher verschiedener Kulturen umfassen und/oder zwei- oder mehrkulturelle Forscher, d. h. Personen, die in mehr als einer Umweltkultur erzogen sind, gelebt und/oder gearbeitet haben« (Hofstede, Sp. 1176).
Gesellschafts- oder Kulturvergleich sind unabdingbarer Bestandteil der Theorieprüfung, wenn die Theorie nicht nur für eine einzige Gesellschaft gelten soll. Dabei sind Idealtypen ein Instrument zur Vermeidung von Ethnozentrismus, ebenso die automatische Suche nach funktionalen Äquivalenten oder überhaupt funktionale Analysen, möglichst noch in mathematischer Formulierung. Die kleine Schwester des Ethnozentrismus ist die persönliche Voreingenommenheit (engl. bias). Ansätze zur Vermeidung des intrasozietären Ethnozentrismus bieten etwa die Verstehende Soziologie (vgl. Max Webers Begriff des Handelns) und die Ethnomethodologie. Das Gegenteil von Ethnozentrismus und für die Validität der Ergebnisse genauso schädliche Abweichen von der wissenschaftlichen Objektivität ist das »going native« (Lamnek, Bd. 1, 49, 235; Bd. 2, 259).
Literatur
Forbes, Hugh Donald, 1985: Nationalism, Ethnocentrism, and Personality, Chicago/London. – Hofstede, Geert, 1980: Kultur und Organisation; in: Grochla, Erwin (Hg.): Handwörterbuch der Organisation, 2. Aufl., Stuttgart, Sp. 1168–1182. – Lamnek, Siegfried, 1993 bzw. 1989: Qualitative Sozialforschung, Bd. 1, 2. Aufl., Bd. 2, 1. Aufl., München.
Günter Endruweit
Evaluation
Evaluation (engl. evaluation) steht nicht nur für spezifisches Handeln, das die Bewertung von empirisch gewonnenen Informationen zum Ziel hat, auf deren Basis rationale Entscheidungen getroffen werden können, sondern auch für das Ergebnis dieses Prozesses. Wissenschaftlich durchgeführte Evaluationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie (a) auf einen klar definierten Gegenstand bezogen sind; (b) dass für die Informationsgewinnung objektivierende empirische Datenerhebungsmethoden eingesetzt werden und dass (c) die Bewertung anhand präzise festgelegter und offengelegter Kriterien, (d) mit Hilfe systematisch vergleichender Verfahren vorgenommen wird. Die Evaluation wird (e) in der Regel von dafür besonders befähigten Personen (Evaluatoren) durchgeführt, um (f) auf den Evaluationsgegenstand bezogene Entscheidungen zu treffen.
Damit das Nutzungspotenzial von Evaluationen möglichst optimal ausgeschöpft wird, hat sich jede professionell durchgeführte Evaluation mit folgenden fünf Fragen auseinanderzusetzen: 1) Was (welcher Gegenstand), wird 2) wozu (zu welchem Zweck), 3) anhand welcher Kriterien, 4) von wem, 5) wie (mit welchen Methoden) evaluiert?
1) Gegenstand: Im Prinzip gibt es bei der Wahl des Evaluationsgegenstands kaum Einschränkungen. Objekte der Bewertung können Gesetze, Produkte, Dienstleistungen, Organisationen, Personen, Prozesse sowie soziale Tatbestände jedweder Art oder gar Evaluationen selbst sein. Häufige Evaluationsgegenstände sind allerdings Reformmaßnahmen, Projekte, Programme oder Policies.
2) Funktionen: Evaluationen können folgenden vier unterschiedlichen, aber miteinander verknüpften Funktionen dienen: (a) Der Gewinnung von Erkenntnissen, um die Prozessabläufe oder die Wirkungszusammenhänge in einem Programm zu verstehen. (b) Um Kontrolle auszuüben, indem festgestellt wird, ob die in der Planung festgelegten Ziele erreicht wurden. (c) Um Lernpotenziale zu eröffnen, die für die Weiterentwicklung von Programmen genutzt werden sollen. (d) Um Programme zu legitimieren, indem öffentlich belegt wird, wie nützlich, wirksam oder nachhaltig sie waren.
Da Evaluationen mittlerweile als Ausdruck mo derner, »evidence based policy« gelten, werden[110] Evaluationen mitunter auch missbraucht, indem sie dazu verwendet werden, politisch bereits getroffene Entscheidungen nachträglich mit Hilfe von Evaluationsergebnissen zu legitimieren. Diese »taktische« Funktion von Evaluation lässt sich jedoch nicht mit ihrem eigentlichen Zweck begründen, sondern stellt eher ihre pathologische Seite dar.
Die Festlegung auf eine prioritäre Funktion steu ert die Herangehensweise und bestimmt das Design und die Durchführung von Evaluationen. Diese können nicht nur verschiedene Funktionen erfüllen, sondern im Rahmen der einzelnen Phasen der Programmentwicklung auch unterschiedliche Analyseperspektiven und Erkenntnisinteressen verfolgen. Evaluationen können dazu genutzt werden, (a) die Planung eines Programms oder einer Maßnahme zu verbessern (ex-ante Evaluation), (b) die Durchführungsprozesse zu beobachten (ongoing Evaluation) oder (c) die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Interventionen ex-post zu bestimmen (ex-post Evaluation).
Evaluationen können demnach mehr formativ, d. h. aktiv-gestaltend, prozessorientiert, konstruktiv und kommunikationsfördernd angelegt sein, oder mehr summativ, d. h. zusammenfassend, bilanzierend und ergebnisorientiert.
Die Begleitforschung kann als eine besondere Form der Evaluation gelten, die sich ex-ante mit den Voraussetzungen bzw. der Planung oder (ongoing) mit der Implementation von Programmen beschäftigt. Anders als die meisten Evaluationen wird sie nicht nur punktuell, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Programmverlauf eingesetzt, sondern kontinuierlich – programmbegleitend. Dadurch können Längsschnittdaten gewonnen werden, die nicht nur kontinuierlich über Veränderungsprozesse informieren, sondern auch Ursache-Wirkungszuschreibungen erleichtern.
Eine besonders wichtige Form der Evaluation stellt die Wirkungsevaluation dar, die zum einen darauf abzielt, (idealerweise) möglichst alle beabsichtigten (intendierten) und nicht-intendierten Wirkungen zu erfassen und die zum anderen mit größtmöglicher Zuverlässigkeit feststellen soll, welche Ursachen (die Programminterventionen oder andere Faktoren) dafür verantwortlich sind. Diese Aufgabe stellt eine der größten Herausforderungen einer Evaluation dar. Dies liegt vor allem daran, dass die soziale Welt einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, d. h. die meisten sozialen Phänomene auf vielen Ursachen basieren. Interventionen haben zudem in der Regel nur einen geringen Eingriffsspielraum und ein niedriges Veränderungspotenzial. Oft sind die Programm- oder Leistungswirkungen nur schwach ausgeprägt, und es besteht selbst bei professionellem Einsatz von Auswertungsverfahren die Gefahr, dass sie im allgemeinen ›Rauschen‹ gar nicht erkannt werden.
3) Kriterien: Im Unterschied zu Normenreihen (wie ISO, oder EFQM) kann Evaluation nicht auf einen fixierten Kanon von Bewertungskriterien zurückgreifen. Sehr häufig orientieren sich die Bewertungskriterien allerdings am Nutzen eines Gegenstands, Sachverhalts oder Entwicklungsprozesses für bestimmte Personen oder Gruppen. Die Festlegung der Kriterien kann durch den Auftraggeber (direktiv), durch den Evaluator (wissens-/erfahrungsbasiert) oder durch alle Stakeholder (partizipativ) erfolgen, um möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen.
4) Evaluierende Akteure: Evaluationen können prinzipiell von internen oder externen Experten durchgeführt werden. Als intern werden Evaluationen bezeichnet, wenn sie von der gleichen Organisation vorgenommen werden, die auch das Programm oder das Projekt durchführt. Wird diese interne Evaluation von Mitarbeitern der Abteilung (dem Referat) durchgeführt, die gleichzeitig mit der operativen Durchführung des Programms betraut sind, dann wird von ›Selbstevaluation‹ gesprochen.
»In-house«- Evaluationen haben den Vorteil, dass sie rasch und mit geringem Aufwand durchgeführt werden können, dass die Evaluatoren in der Regel über eine hohe Sachkenntnis verfügen und dass die Ergebnisse sich unmittelbar umsetzen lassen. Schwächen der internen Evaluation werden vor allem darin gesehen, dass die Evaluierenden zumeist nicht über eine ausreichende Methodenkompetenz verfügen, dass es ihnen an Unabhängigkeit und Distanz mangelt und dass sie möglicherweise so sehr mit ihrem Programm verhaftet sind, dass sie aussichtsreichere Alternativen nicht erkennen.
Externe Evaluationen werden von Personen durchgeführt, die nicht dem Fördermittelgeber oder der Durchführungsorganisation angehören. In der Regel weisen externe Evaluatoren deshalb[111] eine größere Unabhängigkeit, eine profunde Methodenkompetenz und professionelles Evaluationswissen auf und kennen das Fachgebiet, in dem das Programm bzw. das Projekt angesiedelt ist. Zudem können externe Evaluationen reformerischen Kräften innerhalb einer Organisation zusätzliche Legitimität und Einflussstärke verleihen, die sie benötigen, um Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.
5) Methodische Ansätze: Grundlegend für die Frage, wie evaluiert wird, ist die Wahl des Forschungsparadigmas. Grob kann zwischen zwei Hauptrichtungen unterschieden werden. Die einen betrachten Evaluation als ein empirisch-wissenschaftliches Verfahren, das der kritisch-rationalen Forschungslogik folgt und prinzipiell alle bekannten empirischen Forschungsmethoden für einsetzbar hält. Evaluation ist somit als angewandte Sozialforschung zu verstehen, die besondere Forschungsbedingungen zu berücksichtigen und ein spezifisches Erkenntnis- und Verwertungsinteresse hat, bei dem der Nutzen der Evaluationsergebnisse für die ›Praxis‹ im Vordergrund steht. Die zweite Hauptrichtung verbindet mit Evaluation einen anderen Anspruch und geht von anderen Voraussetzungen aus. Das Vorhandensein einer real existierenden Welt, die prinzipiell erkannt und »objektiv« mit Hilfe empirisch-wissenschaftlicher Verfahren erfasst werden kann, auch wenn diese Instrumente unvollständig und teilweise fehlerhaft sein können, wird bestritten. Stattdessen wird angenommen, dass »Realität« aus verschiedenen Perspektiven sozial konstruiert ist, die in Konflikten zueinander stehen können. Deshalb fordern die Anhänger dieses Ansatzes ein ›qualitatives‹ Denken, um die verschiedenen Sichtweisen und Interpretationen der ›Realität‹ erfassen zu können. Je nach wissenschaftstheoretischer Ausrichtung werden unterschiedliche Designs und Verfahren angewendet. In der Evaluationspraxis wird häufig ein sogenannter Methodenmix angewendet, der aus qualitativen und quantitativen Verfahren besteht. Dadurch sollen die Schwächen einzelner Ansätze durch die Stärken anderer ergänzt werden.
Literatur
Fitzpatrick, Jody L. et al., 2004: Program Evaluation. Alternative Approaches and Practical Guidelines, 3. Aufl., Boston u. a. – Rossi, Peter H. et al., 2004: Evaluation. A systematic Approach, Thousand Oaks u. a. – Shaw, Ian F. et al. (Hg.), 2006: The SAGE Handbook of Evaluation, Thousand Oaks u. a. – Stockmann, Reinhard, 2006: Evaluation und Qualitätsentwicklung, Münster. – Ders. (Hg.), 2007: Handbuch zur Evaluation, Münster. – Ders.; Meyer Wolfgang, 2010: Evaluation. Eine Einführung, Opladen/Farmington Hills.
Reinhard Stockmann
Evolutionstheorie
(engl. evolution theory)
Zur Evolution des Evolutionsbegriffes
Wenn man erklären will, wie etwas entstanden ist, brauchen wir eine Theorie, die diese Genese erklärt. Solche Entstehungsgeschichten gehören zum universalen Erklärungsrepertoire des Menschen. Meist handelt es sich dabei um die Erzählung einmaliger Ereignisse, die mit einem oft religiös begründeten Schöpfungsakt einhergehen und eine zeitlose, statische Welt zum Ergebnis haben. Bemerkenswerterweise sind hingegen evolutionäre Ideen, also Gedanken über langfristige, kontinuierliche und graduelle Prozesse der Veränderung oder Entwicklung erst recht spät in der Wissenschaftsgeschichte entstanden. Vorsokratikern wie Thales und Anaximander wurde zwischenzeitlich der Verdienst zugeschrieben, erste evolutionäre Ideen wie die der naturalistischen Erklärung des Lebens, der Anpassung und der gemeinsamen Abstammung aller Lebewesen formuliert zu haben (Osborn 1894). Aus biophilosophischer Sicht können all diese Ansätze jedoch nicht als Vorläufer eines Evolutionskonzeptes angesehen werden, da ihnen noch ein Selektionsmechanismus und die geschichtliche Idee des immerwährenden Wandels fehlt (Mayr 1984). Eine geschichtliche Dimension der Evolution kam erst mit dem in der Aufklärung aufkeimenden Fortschrittsglauben hinzu. Die historische Dimension wurde auch von H. Spencer (1862) aufgegriffen. Dessen Idee des »survival of the fittest« und seine teleologische Missinterpretation des evolutionären Geschehens als zielgerichtete Vervollkommnung hin zu einem idealen Endzustand sind jedoch irreführend, wurden allerdings unter dem Begriff des Sozialdarwinismus gefasst und in den Sozialwissenschaften teilweise bis zum heutigen Tage fälschlicherweise Darwin zugeschrieben. Als echter Vorläufer,[112] der als Erster eine konsequente Theorie evolutionären Wandels formulierte, kann Lamarck (1809) gelten, allerdings erlag er dem Irrtum, den evolutiven Mechanismus in der Vererbung erworbener Eigenschaften zu suchen. Praktisch alle soziologischen Evolutionstheorien zeigen eine gewisse Affinität zu diesem Konzept der intergenerationalen Weitergabe erlernter Eigenschaften. Dies zeigt sich am prägnantesten darin, der biogenetischen Weitergabe von Information einen tradigenetischen Transmissionmodus gegenüberzustellen und neben der biologischen eine soziokulturelle Evolution zu postulieren (dual inheritance theory; Boyd/Richerson 1985, 2005). Diese dualistische Sicht führte zu unterschiedlichen Auffassungen über deren Beziehung, deren einer Pol für die völlige Unabhängigkeit oder gar Emanzipation der soziokulturellen Evolution steht, bei der die soziokulturelle der biologischen Evolution gewissermaßen enteilt ist und bei dessen Gegenpol die biogenetische Evolution in einer Art Basis-Überbau-Beziehung das Primat über die soziokulturelle Evolution hat. Der aktuell interdisziplinär favorisierte Ansatz scheint jedoch eher darin zu bestehen, von zwei parallel verlaufenden Evolutionsprozessen auszugehen, die koevolvieren und über epigenetische Regeln miteinander verbunden sind. Dieser Ansatz, bei dem der Organismus sich in gewisser Weise seine Umgebung selbst definiert, geht auf das ökologische Konzept der »niche construction« zurück (Odling-Smee et al. 2003; Dawkins 1982; zur Grundidee bereits Darwin 1881).
Eine Art, den Unterschied zwischen biogenetischer und tradigenetischer Transmission von Information (Boyd/Richerson 1985, 2005) zu verdeutlichen, liegt in der Kontrastierung zum individuellem Lernen: Während Letzteres schnelle Anpassungen erlaubt, indem es eine unmittelbare, aktualgenetische Adaptation auf veränderte Bedingungen ermöglicht und genetische Veränderungen (genetisches »Lernen«, Dennett 1995) mit etwa 100 Generationen langsam vonstatten gehen, gelingen Anpassungen an soziokulturelle Veränderungen in der Regel innerhalb einer Generation (Berry et al. 2011). Werden diese unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten typologisiert, indem man ihnen unterschiedliche Transmissionseinheiten zuordnet, erfolgt eine unzulässige Reifikation des prozeduralen Geschehens, da kein Unterschied in dem, was letztlich übermittelt wird, vorliegt: Das zugrunde liegende Substrat, das letzlich Informationen übermittelt, ist sowohl beim bio- und tradigenetischen »Lernen« als auch beim individuellen Lernen nur das Gen. Dementsprechend ist eine befriedigende Definition, geschwiege denn Identifikation exogenetischer Transmissionseinheiten trotz intensiver interdisziplinärer Debatte seit dem Dawkinschen Mem-Postulat (1976) immer noch nicht gefunden (Aunger 2007). Die Debatte über den Platzhalter-Status des Mems erinnert hier stark an den von »Kultur« in der kulturvergleichenden Psychologie (Chasiotis 2007, 2011b).
Die Evolutionstheorie der natürlichen Selektion
Darwins (1844 bzw. Wallace 1858) Evolutionstheorie stellt genaugenommen eine Integration mehrerer untergeordneter Theorien mit geringerem Geltungsbereich dar, mit der Theorie der natürlichen Selektion als ihrem charakteristischen Bestandteil (neben Phylogenese, Speziation, gemeinsamer Abstammung und Gradualismus, Mayr 1984). Die drei zentralen Annahmen der modernen Evolutionstheorie sind Reproduktion, Vielfalt und Selektion (Campbell 1970; Dennett 1995). Darwin ging bei der Formulierung seiner Evolutionstheorie davon aus, dass der formgebende Mechanismus im Evolutionsgeschehen die natürliche Selektion sei, welche die einzelnen, genetisch einzigartigen Varianten (Individuen) danach ausliest, wie erfolgreich sie sich fortpflanzen. Diese Schlussfolgerung basierte auf der Beobachtung, dass innerhalb einer Art eine individuelle Vielfalt der Erbeigenschaften besteht. Wenn einige Eigenschaften eher zur Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit beitragen, breiten sich diese erblichen Eigenschaften in der Population aus, so dass sich im Laufe der Zeit die Verteilung der erblichen Merkmale in der Population einer Art verändern. Diesen Prozess nannte er natürliche Selektion durch differentielle Reproduktion. Die biologische Evolution erfolgt zufällig oder durch Neukombination entstehende, geringfügige und meistens unauffällige genetische Änderungen (Mutation, Gen-Drift, Migration) an der Genmenge eines Individuums bzw. der Gesamtpopulation. Durch diese Selektion ist die Evolution nicht – wie noch bis Mitte der 1960er Jahre angenommen – ein arterhaltender, sondern ein artenschaffender Prozess. Kriterium dieser in der Regel individuellen Selektion ist die Güte der Anpassung neuer Merkmalsausprägungen an die Umweltbedingungen, d. h. an die ökologische Nische und beim Menschen in besonderer [113]Weise an die soziale Komplexität der Umwelt. Da neue, durch zufällige genetische Änderungen auftretende Eigenschaften eines Lebewesens in der Regel keine Vorhandenen ersetzen, sondern den bestehenden hinzugefügt werden, zeichnet sich der Mensch wie alle anderen Lebewesen durch eine »geschichtliche Natur«, d. h. durch in seiner stammesgeschichtlichen Vergangenheit erworbene genetische Programme aus, die unsere gegenwärtigen phänotypischen Eigenschaften bestimmen (Mayr 1984, 2000). Tinbergen (1963) hat vorgeschlagen, zwischen phylogenetischen (ultimat-funktionalen), ontogenetischen (distalen) und aktualgenetischen (proximaten) Fragen zu unterscheiden. Die Differenzierung von Fragen nach den unmittelbaren Ursachen (»Wie kommt dieses augenblickliche Verhalten zustande?«) und solchen nach den stammesgeschichtlichen Ursachen (»Welche stammesgeschichtliche Anpassung erfüllt dieses Verhalten?«; zur Unterscheidung Mayr 1984, 2000) wurde zum zentralen Charakteristikum moderner evolutionärer Ansätze. Die Einbeziehung der Funktionslogik des Entstehens bietet eine völlig neue Perspektive auch für soziologische Fragestellungen (Berry et al. 2011; Brown et al. 2011). So gelang Lamba und Mace (2011) in einer neueren Untersuchung, in der sie intrakulturelle Varianz mitberücksichtigten, der Nachweis, dass Kooperationsverhalten eher von demographischen und ökologischen Faktoren abhängt als von kulturellen Normen. Sie interpretieren diesen Befund explizit als empirisches Gegenargument zu gruppenselektionistischen Annahmen zur Evolution von Kooperation auf gesellschaftlicher Ebene.
Evolutionstheorien in der Soziologie
Die Evolutionstheorien in der Soziologie, die sich über Weber bis hin zur Theorie des sozialen Wandels in den 1960er Jahren erstrecken, gehen zumeist auf H. Spencer zurück und beinhalten dementsprechend mehr oder weniger explizit die Untersuchung von Selektionsmechanismen und einen gerichteten Fortschrittsgedanken. Problematisch ist neben dem Postulat einer Fortschritts- oder Steigerungsdynamik des sozialen Wandels die fehlende Anbindung an das individuelle Verhalten (Schmid 1998). Als ein Gegenentwurf können funktionalistische Theorien angesehen werden, deren Abwehr gegen den teleologischen Historizismus der Spencerschule darin bestand, Nützlichkeitserwägungen zur Erklärung sozialer Strukturen heranzuziehen. Beispiele dieses Funktionalismus sind vor allem die Theorien von Durkheim (z. B. zur sozialen Funktion der Religion, 1915), Parsons (1977) und in neuerer Zeit Luhmann (1984, 1997). Problematisch daran ist, aristotelisch gesprochen, Zweckursachen heranzuziehen, wo Wirkursachen gefragt sind: der Funktionalismus erklärt, warum eine soziale Institution ein Problem löst, kann aber nicht erklären, wie diese Institution entstanden ist. Ein weiteres Problem, das der Funktionalismus mit dem Strukturalismus teilt, ist seine Zeitlosigkeit. In gewisser Weise das Kind mit dem Bade ausschüttend, wurde der zielgerichtete Zeitpfeil nicht durch weniger teleologische Entwicklungsmodelle, sondern durch eine Wiederkehr des Immergleichen ersetzt, die am ehesten der aristotelischen Formursache entspricht (Bischof 1985, 2008). Das Hauptproblem in der Rezeption des Evolutionskonzepts in der Soziologie sind seine Gleichsetzung bzw. fehlende Abgrenzung von a) Entwicklung durch die Konfundierung von Phylo- und Ontogenese (Parsons 1977; s. auch das Autopoiese-Konzept von Luhmann 1983) und von b) Geschichte und somit von schlichtem historischen Wandel (Schmid 1998; Wortmann 2010). Diese fehlende Differenzierung zeigt sich auch bei der Beschreibung externer Einflussgrößen auf das Sozialverhalten; eine adäquate Umwelttheorie, die etwa Adaptationsleistungen auf der phylogenetischen (Selektion), ontogenetischen (Alimentation) und aktualgenetischen Ebene (Stimulation) zu unterscheiden vermag (Bischof 2008; Chasiotis 2010), ist schlichtweg nicht vorhanden.
Als Fazit ist Wortmanns Diktum (2010) somit zuzustimmen, dass es sich bei der Evolutionstheorie des Sozialen immer noch nur um ein, wenn auch vielversprechendes, Desideratum handelt. Laut Mayr (1984, 2003) bestand bis zum Beginn des 21. Jh.s das größte Hindernis auf dem Weg zu einer hinreichenden Wissenschaftsphilosophie darin, den Unterschied zwischen einer physikalistischen und biologischen Auffassung von Evolution nicht herausgearbeitet zu haben. So wäre der Versuch einer essentiellen Typologie menschlicher Gesellschaften laut Mayr (1984, 2003) physikalistisch. Diese auf Pythagoras und Platon zurückgehende Denkweise, deren ungünstige Einflüsse auf die abendländische Philosophie (Mayr 1991), vor allem auf die biologische (Mayr 1984), aber auch auf die psychologische Gedankenwelt (Bischof 2008) noch nicht gänzlich überwunden sind, geht davon aus, dass es in der[114] Wissenschaft darum geht, den zugrunde liegenden unveränderlichen »Typus«, die »Idee« oder »Essenz« eines veränderlichen Phänomens zu identifizieren (Chasiotis 2010, 2011b). Evolutionistische Theorien in der Soziologie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in typisch essentialistisch-physikalistischer Weise entweder alle Individuen als identisch, austauschbar und somit ignorierbar ansehen oder keine befriedigende Verhaltenstheorie für Individuen aufweisen (Wortmann 2010). Was Darwin jedoch im Wirken der artenschaffenden Evolution erkannt hat, ist das »Populationsdenken«, d. h. die Art nicht als zu erhaltenden Typus, sondern als variable Population zu betrachten. Damit postulierte er, die historisierte Einzigartigkeit der Individuen als Grundlage der Wissenschaft des Lebens zu betrachten. Dies ist ein Vermächtnis, dessen Implikationen immer noch erst in Ansätzen eingelöst worden sind.
Literatur
Aunger Robert, 2007: Memes; in: Dunbar, Robin; Barrett, Louise (eds.): Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford, UK, 599–604. – Berry, John W. et al., 2011: Cross-cultural psychology. Research and applications, 3rd ed., Cambridge, UK. – Bischof, Norbert, 1985: Das Rätsel Ödipus, München. – Ders., 2008: Psychologie, München. – Boyd, Robert; Richerson, Peter J., 1985: Culture and the evolutionary process, Chicago. – Dies., 2005: The origin and evolution of cultures, New York. – Brown, Gillian et al., 2011: Evolutionary accounts of human behavioral diversity. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 366, 313–324. – Campbell, Donald, 1970: Natural Selection as an epistemological model; in: Naroll, Raoul; Cohen, Ronald (eds.), A handbook of method in cultural anthropology, NY, 51–85. – Chasiotis, Athanasios, 2007: Evolutionstheoretische Ansätze im Kulturvergleich; in: Trommsdorff, Gisela; Kornadt, Hans-Joachim (Hg.): Kulturvergleichende Psychologie, Band I, Göttingen, 179–219. – Ders., 2010: Developmental Psychology without dualistic illusions; in: Frey, Ulrich J. et al. (eds.): Homo novus – A human without illusions, Berlin, 147–160. – Ders., 2011a: Evolution and culture. Online Readings in Psychology and Culture, Unit 9. Retrieved from http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol9/iss1/1, 1–15. – Ders., 2011b: An epigenetic view on culture. What evolutionary developmental psychology has to offer for cross-cultural psychology; in: van de Vijver, Fons J. R. et al. (eds.): Fundamental questions in Cross-Cultural Psychology, Cambridge, 376–404. – Darwin, Charles, 1844: Essay. The foundations of the origin of species by Charles Darwin, Cambridge, UK (zuerst veröffentlicht von F. Darwin, 1909). – Ders., 1881: The formation of vegetable mould through the action of worms, with observations on their habits, London. – Dawkins, Richard, 1976: The selfish gene, Oxford, UK. – Ders., 1982: The extended phenotype, Oxford, UK. – Durkheim, Emile, 1915: The elementary forms of religious life, London. – Mayr, Ernst, 1984: Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt. Berlin. – Ders., 2003: Das ist Evolution, München. – Lamarck, Jean-Baptiste, 1909: Zoologische Philosophie, Leipzig (1809). – Lamba, Shakti; Mace, Ruth, 2011: Demography and ecology drive variation in cooperation across human populations. Proceedings of the National Academy of Science, Early edition. Doi: 10..1073/pnas.1105186108. – Luhmann, Niklas, 1983: Evolution – kein Menschenbild; in: Riedl, Rupert; Kreuzer, Franz (Hg.), Evolution und Menschenbild, Hamburg, 193–205. – Ders., 1984: Soziale Systeme, Frankfurt a. M. – Ders., 1997: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. – Odling-Smee, F. John et al., 2003: Niche construction: The neglected process in evolution, Princeton. – Osborn, Henry F., 1894: From the Greeks to Darwin, NY. – Parsons, Talcott, 1977: Social systems and the evolution of action theory, NY. – Schmid, Michael, 1998: Soziologische Evolutionstheorien; in: Preyer, Gerhard (Hg.), Strukturelle Evolution und das Weltsystem, Frankfurt a. M., 387–411. – Spencer, Herbert, 1862: First principles, London. – Tinbergen, Nikolaas, 1963: On aims and methods of ethology; in: Zeitschrift für Tierpsychologie 20, 410–433. – Wallace, Alfred, 1958: On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type; in: Journal of the Proceedings of the Linnean Society (Zoology) 3, 53–62. – Wortmann, Hendrik, 2010: Zum Desiderat einer Evolutionstheorie des Sozialen, Konstanz.
Athanasios Chasiotis
Experiment
Das Experiment (lateinisch: experimentum für »Versuch«, »Probe«; engl. experiment) ist eine methodisch kontrollierte Vorgehensweise, die in allen empirischen Wissenschaftsdisziplinen eingesetzt wird, um aus Theorien abgeleitete Kausalhypothesen (»T bewirkt Y«) zu überprüfen. In einem Experiment liegt eine Situation vor, in der die unabhängige Variable (T), also die vermutete Ursache eines Phänomens, systematisch variiert wird und Veränderungen der abhängigen Variablen (Y) gemessen werden. Zu einem idealen experimentellen Versuchsaufbau gehören im einfachsten Fall drei Elemente: die Aufteilung in eine Experimental- (oder engl. Treatment-) Gruppe und eine Kontrollgruppe, die zufällige Aufteilung der Versuchsobjekte des Experiments auf diese beide Gruppen (sog. Randomisierung) und das[115] kontrollierte Setzen des Treatments, also die Manipulation durch die Versuchsleiter. Ronald A. Fisher (1935) hat in seiner Abhandlung »The Design of Experiments« die wesentliche Grundlage für die statistische Behandlung von experimentell erhobenen Daten geschaffen. Wenn die genannten drei Voraussetzungen erfüllt sind, können, je nach Anzahl der Versuche bzw. Versuchspersonen, durch die Wahrscheinlichkeitstheorie abgesicherte Schlüsse gezogen werden.
Experimentelle Designs
Experimentelle Studien werden vor allem in den Naturwissenschaften, sehr häufig in der Psychologie und seltener in den empirischen Sozialwissenschaften eingesetzt. In den letzten Jahren hat sich das Experiment jedoch in der verhaltenswissenschaftlichen Ökonomik (behaviorial economics) als Methodik zur Datengenerierung verbreitet (Fehr/Gintis 2007). In der Soziologie werden experimentelle Designs vergleichsweise selten verwendet. Ein von Soziologen durchgeführtes Experiment stellt zum Beispiel die Studie von M. Salganik, P. Dodd und D. Watts (2006) dar, in der Ungleichheit und die Prognostizierbarkeit von Erfolg auf Märkten für kulturelle Güter untersucht wurden. Die Teilnehmer dieses Experiments sollten Musikdownloads unbekannter Bands bewerten, entweder mit (Treatmentgruppe) oder ohne Information (Kontrollgruppe) über die Bewertungen anderer. Ein wichtiges Ergebnis des Experiments war, dass vorhandene Information über Präferenzen anderer die Ungleichheit des Erfolgs deutlich erhöht. Der Vorzug eines methodisch kontrollierten Experiments gegenüber anderen Wegen, Daten zur Prüfung von Zusammenhängen zu erheben, liegt darin, die schwierige Aufgabe kausalen Schließens in idealtypischer Weise zu lösen. Voraussetzung ist allerdings, dass alle drei aufgeführten Elemente eines Experiments eingesetzt werden. Gegeben, dass die Randomisierung auf die Treatment- und Kontrollgruppe erfolgreich war und das Treatment nur durch die Versuchsleiter manipuliert wird, geht die Variation der abhängigen Variablen (Y) nur auf das Treatment (T) zurück und ein Kausalschluss »T bewirkt Y« wird möglich. Der Unterschied von Y (etwa im Mittelwert) zwischen beiden Gruppen wird Treatmenteffekt genannt. Sind einzelne Elemente eines Experiments nicht oder nur unvollständig gegeben, dann ist ein Kausalschluss nicht mehr zulässig.
Experimentelle Versuchspläne können auch wesentlich komplexer ausfallen. So ist es oft von Interesse, durch Vergleiche von Vorher- und Nachhermessungen in Treatment- und Kontrollgruppen zeitliche Veränderungen zwischen t1 und t2 zu erfassen. Der Treatmenteffekt wird in solchen Fällen mittels der Differenz zwischen den Gruppen und den zwei Messzeitpunkten berechnet. Solche Designs sind angebracht, wenn man davon ausgeht, dass auch ohne Setzen eines Treatments messbare Veränderungen (z. B. Reifung, Lernen) stattfinden. Außerdem ist es möglich, dass man den Zweigruppenvergleich systematisch erweitert. So können mehrere Treatment-Gruppen miteinander verglichen werden, etwa wenn verschiedene Treatment-Stärken eingesetzt werden. In den berühmten Milgram-Experimenten zur Gehorsamkeit gegenüber Autoritäten wurde etwa die Distanz-Nähe-Beziehung zu den vermeintlichen Opfern variiert und hinsichtlich der gezeigten Reaktionen verglichen (Milgram 1963, 1974). Außerdem ist häufig von Interesse, mehrere Bedingungen (mehrere unabhängige Variable) zugleich systematisch zu variieren und dabei jeweils mehrere Ausprägungen von Treatments zu berücksichtigen. Man spricht dann von mehrfaktoriellen Designs, wobei hier häufig sog. Moderatoreffekte erforscht werden: Je nach Ausprägung einer Drittvariable Z fällt der Zusammenhang von T und Y anders aus. Beispielhaft sind etwa Studien zum sog. Stereotype-Threat zu erwähnen. Nach der Theorie des Stereotype-Threat ist die Aktivierung eines negativen Selbstbilds, das dann nachfolgend zur Leistungsverschlechterung in Testsituationen führt, von situationalen Faktoren (z. B. der konkreten Aufgabenstellung) abhängig (Aronson et al. 1999).
Qualitätskriterien
Qualitätskriterien der mittels Experiment gewonnenen Daten sind die interne und die externe Validität (oder Gültigkeit). Von interner Validität spricht man, wenn die Randomisierung und das Setzen des Treatments durch die Versuchsleiter den Anforderungen entsprechend erfolgt. Die Zufallsaufteilung von Versuchsobjekten (in den Sozialwissenschaften: Probanden) ist deswegen elementar, weil nur so weitere, unkontrollierte Einflussfaktoren in ihrer Wirkung ausgeschaltet werden können. Man geht davon aus, dass durch die Randomisierung mögliche Störgrößen zufällig auf Treatment- und Kontrollgruppe [116]verteilt werden und sich in ihrer Wirkung aufheben. Damit dies wahrscheinlich wird, ist eine gewisse Mindestbesetzung beider Gruppen notwendig. Weiterhin kann die Setzung des Treatments misslingen oder beeinträchtigt werden. In diesem Fall ist die interne Validität nicht gegeben. Externe Validität bezieht sich auf die Verallgemeinerbarkeit des Treatmenteffekts aus der experimentellen Situation, häufig in Laboren, auf nicht-experimentelle Situationen.
Ein allgemeines Problem experimenteller Forschung ist die mögliche Reaktivität der Erhebungssituation auf die Probanden. Sie reagieren nicht nur auf das gegebene Treatment, sondern unkontrolliert auf die Randbedingungen der Durchführung des Experiments. Bekannt sind etwa Versuchsleitereffekte. Je nachdem, wer die Experimente durchführt, zeigen sich andere Resultate. Wenn Probanden oder Versuchsleiter über die Forschungshypothese Bescheid wissen oder nur meinen, Bescheid zu wissen, kann dies die Ergebnisse beeinflussen. Diesbezüglich werden Doppeltblindversuche, bei denen weder Probanden noch Versuchsleiter wissen, wer in der Treatment- und wer in der Kontrollgruppe ist, empfohlen. Außerdem sind in vielen Experimenten die Probanden eine selektierte Gruppe, oftmals handelt es sich um Studierende. Selbst wenn man diese Probanden zufällig auf Treatment- und Kontrollgruppe verteilt, sind die Ergebnisse des Experiments hinsichtlich der Generalisierbarkeit oft stark beeinträchtigt.
Feld- und natürliche Experimente
Man kann neben Laborexperimenten auch sog. Feldexperimente durchführen, die in für die Versuchspersonen gewöhnlichen (Alltags-)Kontexten stattfinden. Bei Feldexperimenten wissen die Probanden in der Regel nicht, dass sie an Experimenten teilnehmen. In solchen Fällen sind Feldexperimente nicht reaktiv. In den letzten Jahren haben sich zur Aufdeckung von Diskriminierung sog. Audit-Studien und Korrespondenztests etabliert (Überblick bei Pager/ Sheperd 2008). Dabei variiert man in realen Bewerbungssituationen etwa in Anschreiben und Lebensläufen den ethnischen Hintergrund von Bewerbern und analysiert die Reaktionen der Adressaten. Hier stellt sich die Frage der externen Validität nicht, allerdings müssen die Forscher den erzielbaren Wissensfortschritt gegenüber ethischen Bedenken abwägen. Von Feldexperimenten, bei denen die Versuchsleiter in einer gewohnten Umgebung experimentelle Bedingungen herstellen, sind natürliche Experimente zu unterscheiden, bei denen ein exogenes (oft natürliches, nicht vorhersehbares) Ereignis eine Randomisierung in Treatment- und Kontrollgruppe bewirkt. Joshua Angrist und William Evans wollten beispielsweise die Auswirkungen eines dritten Kinds auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern untersuchen (1998). Sie betrachteten die Geschlechtermischung von Familien mit zwei Kindern als eine Art von Zufallsaufteilung, weil der Geschlechtermix nicht manipulierbar erscheint. Bei zwei gleichgeschlechtlichen Kindern ist die exogen (d. h. nicht durch Präferenzen oder Arbeitsmarktchancen) beeinflusste Wahrscheinlichkeit größer, ein drittes Kind zu bekommen, als bei Familien mit zwei gegengeschlechtlichen Kindern. Die Ergebnisse natürlicher Experimente müssen besonders sorgfältig daraufhin geprüft werden, ob die gewünschte Zufallsaufteilung nicht durch kaum zu bemerkende Selektionsprozesse unterlaufen wurde. In diesen Fällen wäre der Kausalschluss wiederum gefährdet.
Experimente in der Evaluationsforschung
Ein wichtiges Anwendungsfeld experimenteller Forschung in den Sozialwissenschaften ist die methodisch kontrollierte Evaluationsforschung. Selten kann in Evaluationsstudien (»was bewirkt eine bestimmte Maßnahme«?) ein reines Experiment durchgeführt werden. Etwa ist eine wirkliche Randomisierung auf die Treatment- und Kontrollgruppe nicht möglich. Man spricht dann von sog. Quasi-Experimenten. In der Evaluationsforschung haben sich verschiedene Methoden etabliert, die experimentelle Idealsituation möglichst gut anzunähern. So wird etwa über das sog. Propensity-Matching, eine statistische Technik zur Bildung von Treatment- und Kontrollgruppe, angestrebt, in beiden Gruppen möglichst ähnliche Verteilungen hinsichtlich gemessener Störgrößen zu erreichen. Solche Verfahren waren in den letzten Jahren sehr hilfreich, die Logik experimenteller Designs mit dem Ziel kausalen Schließens auch in der empirischen Soziologie zu verbreiten (Gangl 2010). Hauptprobleme in Evaluationsstudien sind die Selbstselektion in die Treatment- und Kontrollgruppe. Dies kann man sich leicht an Hand der in vielen Universitäten üblichen Evaluation der Lehrveranstaltungen [117]verdeutlichen. Die Studierenden verteilen sich nicht zufällig auf die unterschiedlichen Veranstaltungen. Präferenzen nach Fach bzw. Wahloder Pflichtveranstaltung oder Rahmenbedingungen der Veranstaltungen (Uhrzeit, Gruppengröße, etc.) machen einen Vergleich der Resultate pro Veranstaltung schwierig bis unmöglich.
In der Praxis der (quasi-)experimentellen Forschung muss man sich mit dem Problem der Randomisierungsverzerrung beschäftigen. Es sollte ausgeschlossen sein, dass mit der Teilnahme an der Treatmentgruppe (und nicht durch das Treatment) eine Veränderung gegenüber der Kontrollgruppe einhergeht. Weiterhin sollte vermieden werden, dass Probanden, die der Treatmentgruppe zugeordnet wurden, aus systematischen, also nicht-zufälligen Gründen das Treatment verweigern. Eine Substituierungsverzerrung tritt auf, falls Mitglieder der Kontrollgruppe das nicht erhaltene Treatment ersetzen.
Der Einsatz von Experimenten in der Soziologie
Der vergleichsweise seltene Einsatz von Experimenten in der Soziologie hat mit ihren Forschungsgegenständen zu tun. Die in der Soziologie interessierenden sozialen Prozesse lassen sich vielfach nicht sinnvoll in Laboren nachstellen – etwa wenn es um die Wirkung von Bildung auf berufliche Chancen geht. Selbst wenn man hinsichtlich der institutionellen Variation von Bildungssystemen, in denen Probanden beschult wurden, von einer angenäherten Randomisierung ausgehen könnte (allerdings unter der Annahme: Eltern und ihre Kinder wählen das Bundesland, in dem sie wohnen, nicht nach dem Schulsystem), sind doch zu viele unkontrollierte Faktoren bedeutsam, etwa die wirtschaftliche Situation der Bundesländer, die dadurch ausgelöste regionale Mobilität etc. Oder: Bei der Untersuchung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede kann man nicht davon ausgehen, dass sich Männer und Frauen randomisiert auf unterschiedliche Treatment-Bedingungen verteilen – etwa in den öffentlichen Dienst und die Privatwirtschaft. Es bleiben bei der Auswertung von sog. ex post facto Daten nur die nachträglichen Versuche, die Probleme durch Selektionsprozesse und (beobachtete und unbeobachtete) Störgrößen durch geeignete statistische Verfahren möglichst zu reduzieren bzw. auszuschalten.
Dennoch gibt es neben der verhaltenswissenschaftlichen Ökonomik Bereiche, in denen experimentelle Designs in der empirischen Soziologie an Bedeutung gewinnen. Z. B. integriert man experimentelle Versuchsaufbauten in die Umfrageforschung. In Umfragestudien werden spieltheoretische Experimente integriert (Naef/Schupp 2009). Weiterhin finden sich interessante Studien zu stated preferences in sog. Choice Experimenten. Probanden werden mit hypothetischen Alternativen konfrontiert, die sich hinsichtlich verschiedener Dimensionen systematisch unterscheiden (Auspurg/Liebe 2011). Ähnlich werden in faktoriellen Surveys Situationsbeschreibungen, etwa zur Geltung von Normen und zu Prinzipien von Gerechtigkeit, manipuliert (Jasso 2006). In diesen Anwendungen werden zunächst die Entscheidungsalternativen bzw. Situationsbeschreibungen experimentell variiert, dann erfolgt eine Randomisierung der Entscheidungsalternativen bzw. Situationsbeschreibungen auf die ausgewählten Befragten, die im Idealfall eine Zufallsstichprobe aus der Bevölkerung darstellen. Beide Verfahren können damit die Beschränkungen herkömmlicher Experimente auf die üblichen Probanden vermeiden (Mutz 2011).
Auswertung experimenteller Daten
Die Auswertung von experimentellen Daten ist im Vergleich zu anderen Designs verhältnismäßig einfach (Brown/Melamed 1990; Kirk 1982). Es müssen – sofern echte Experimente vorliegen – keine Drittvariablenkontrollen in komplexen statistischen Modellen eingesetzt werden. Es genügen einfache Tests, etwa Mittelwertvergleiche (sog. T-Tests bei metrischen Variablen). Sofern Daten mittels mehrfaktorieller Designs erhoben wurden, arbeitet man meist mit der Varianzanalyse (ANOVA), um die erwähnten Moderatoreffekte (die Wirkung von T auf Y fällt je nach Ausprägung der Drittvariablen Z anders aus) zu identifizieren und sie besonders anschaulich darzustellen. Bei der Auswertung ist zu beachten, ob vollständig randomisierte Designs oder sog. Blockdesigns umgesetzt wurden. Bei Blockdesigns sind bestimmte Faktoren bewusst nicht randomisiert, die Probanden werden auf Grund von Vorwissen bestimmten Faktorgruppen zugewiesen. Ein Vorteil der Blockbildung liegt in der größeren statistischen Power. Es sind weniger Probanden nötig, um einen Treatmenteffekt statistisch signifikant schätzen zu können. Dies verweist auf die generell von Fisher vorgeschlagene Methode des Signifikanztests,[118] welche in der großen Mehrheit der experimentellen Forschung Anwendung findet. Wenn eine explizite Nullhypothese formuliert wurde, bevor das Experiment geplant und durchgeführt wurde, kann diese Hypothese zwar nicht bestätigt, aber mit einer akzeptablen Irrtumswahrscheinlichkeit (i. d. R. unter 5 %) zurückgewiesen werden. Die Publikation experimenteller Forschungsergebnisse unterliegt der Gefahr einer Verzerrung. Wann immer die statistische Signifikanz die Chancen der Rezeption der Ergebnisse beeinflusst, liegt ein sog. publication bias vor (Auspurg/Hinz 2011).
Ethische Fragen
An den meisten Experimenten in den Sozialwissenschaften nehmen menschliche Versuchspersonen teil. Damit sind besondere ethische Fragen aufgeworfen. Die empirischen Wissenschaften haben sich auf die Einhaltung eines Ethik-Codex verständigt. Die Teilnahme an Experimenten ist freiwillig, die Probanden willigen explizit in die Teilnahme und die Möglichkeit der Datenauswertungen ein, die Probanden können jederzeit abbrechen, eine angemessene Kompensation für die Teilnahme ist üblich, und die Versuchspersonen dürfen nicht getäuscht bzw. geschädigt werden. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist in bestimmten Fällen nicht möglich – gerade in Feldexperimenten oder in der Sozialpsychologie, in der die tatsächlichen Forschungsinteressen mitunter verschleiert werden. Wie man an den bekannten Milgram-Experimenten sieht, liegt in der vorübergehenden Täuschung von Probanden die Chance auf besonderen Erkenntnisgewinn. In solchen Fällen sind Beratungen von Ethik-Kommissionen vorgesehen und für die Teilnehmer an den Experimenten immerhin eine nachträgliche Aufklärung.
Literatur
Angrist, Joshua; Evans, William N., 2005: Children and their parents’ labor supply: Evidence from exogenous variation in family size; in: American Economic Review 88, 450–477. – Aronson, Joshua et al., 1999: When White Men Can’t Do Math: Necessary and Sufficient Factors in Stereotype Threat; in: Journal of Experimental Social Psychology 35, 29–46. – Auspurg, Katrin; Hinz, Thomas, 2011: What Fuels Publication Bias? Theoretical and Empirical Analyses of Risk Factors Using the Caliper-Test; in: Journal of Economics and Statistics 235, 630–660. – Auspurg, Katrin; Liebe, Ulf, 2011: Choice Experimente und die Messung von Handlungsentscheidungen in der Soziologie; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 63, 301–314. – Brown, Steven R.; Melamed, Lawrence E., 1990: Experimental Design and Analysis, Newbury Park. – Fehr; Ernst; Gintis Herbert, 2007: Human Motivation and Social Cooperation: Experimental and Analytical Foundations; in: Annual Review of Sociology 33, 43–64. – Fischer, Ronald A., 1935: The Design of Experiments, Oxford. – Gangl, Markus, 2010: Causal Influence in Sociological Research; in: Annual Review of Sociology 36, 21–47. – Jasso, Guillermina, 2006: Factorial Survey Methods for Studying Beliefs and Judgments; in: Sociological Methods & Research 34, 334–423. – Kirk, R. E., 1982: Experimental Design. Procedures for the Behavorial Sciences, 2. Aufl., Belmont. – Milgram, Stanley, 1963: Behavorial Study of Obedience; in: Journal of Abnormal and Social Psychology 67, 371–378. – Milgram, Stanley, 1982: Das Milgram Experiment. Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität, Rowohlt (zuerst: Obedience to Authority. An Experiment View, New York, 1974). – Mutz, Diana C., 2011: Population Based Survey Experiments, Princeton. – Naef, Michael; Schupp, Jürgen, 2009: Measuring Trust. Experiments and Surveys in Contrast and Combination, SOEP Papers 167, Berlin. – Pager, Devah; Sheperd, Hana, 2008: The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets; in: Annual Review of Sociology 34, 181–209. – Salganik, Matthew J. et al., 2006: Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market; in: Science 311, 854–856.
Thomas Hinz
Explorationsstudie
Explorationsstudien (engl. exploratory study) sind einerseits relevant, wenn das existierende Wissen (über ein Feld, eine Zielgruppe, ein Thema, einen Zusammenhang) nicht ausreicht, Hypothesen zu formulieren und zu testen und standardisierte Instrumente (z. B. Fragebogen mit einer begrenzten Anzahl vorgegebener Antwortmöglichkeiten) zu verwenden. Eine Explorationsstudie stellt dann eine Vorstudie einer solchen Studie mit dem Ziel der Entwicklung von Hypothesen und Methoden dar. Explorationsstudien stellen anderseits einen eigenständigen Forschungsansatz dar, bei dem es darum geht, Neues in einem wenig bis nicht erforschtem Feld zu entdecken und aus der Studie eine gegenstandsbegründete Theorie (Grounded Theory, Strauss 2007) zu entwickeln.
[119]In Explorationsstudien werden häufig qualitative Methoden (teilnehmende Beobachtung, Interviews) verwendet, um dem Untersuchten möglichst offen gegenüberzutreten. Ethnographische Studien sind i. d. R. als Explorationsstudie angelegt. Bei komplexen Datensätzen können Explorationsstudien zur Entdeckung von bislang unbekannten Zusammenhängen in den Daten mit statistischen Methoden durchgeführt werden (Tukey 1977). Relevant für die Beurteilung von Explorationsstudien ist: Handelt es sich tatsächlich um einen noch zu explorierenden Gegenstand? Ist der methodische Zugang offen und sensibel genug konzipiert, so dass das Neue im Untersuchten sichtbar werden kann? Fragestellungen und Methoden werden bei Explorationsstudien oft erst im Laufe der Studie (weiter) konkretisiert. Für die Bedeutung als eigenständiger Untersuchungsansatz ist bei Explorationsstudien zentral, inwieweit sich die Ergebnisse nicht nur auf die Entwicklung von Instrumenten für eine Folgeuntersuchung beschränken, sondern auch Erkenntnisse über das untersuchte Feld bzw. den Gegenstand etwa in einer aus dem empirischen Material entwickelten Typologie oder Theorie darstellen.
Literatur
Flick Uwe, 2009: Sozialforschung – ein Überblick für die BA-Studiengänge, Reinbek. – Ders., 2011: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, 4. Aufl., Reinbek. – Strauss, Anselm, 2007: Grundlagen qualitativer Sozialforschung, Stuttgart. – Tukey, John, 1977: Exploratory Data Analysis, Reading, MA.
Uwe Flick