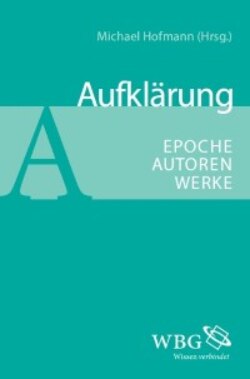Читать книгу Aufklärung - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Briefsteller: Empfindsame Selbstreflexionen
ОглавлениеIn Gellerts „Briefen, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen“, die 1751 erschienen, spiegeln sich Ansätze empfindsamer Positionen in ästhetischen Betrachtungen über die „natürliche Schreibart“.19 Gellert, für den der Brief „die Stelle eines Gesprächs vertritt“, ist auch hier im Sinnzusammenhang jener empfindsamen Anschauungen zu verstehen, die im Spannungsfeld von Vernunft und Gefühl zu einem Ausgleich dieser divergierenden Paradigmen streben, dessen typisierende Gefühlsäußerungen aber gleichwohl ritualisierten Mustern folgen.20 Die Einsamkeit des Schreibenden, die mit der Einsamkeit des Lesenden korrespondiert, ermöglicht dem einzelnen eine selbstreflexive Vergewisserung der Empfindungen, die zugleich das Fühlen des anderen antizipiert. Die Konjunktion von Einsamkeit und Gemeinschaft, die dem Brief als Kommunikationsform eigen ist, die Gleichzeitigkeit von intimer Nähe und distanzierter Betrachtung, entspricht der Dialektik von Vernunft und Gefühl, reflexiver Erwägung und emotionaler Hingabe.21
Die dreiundsiebzig Briefe seiner Sammlung spiegeln nicht nur die Beziehungen des Verfassers zu den Empfängern der Schreiben, sondern thematisieren ebenso die Bedeutung und die Funktion der Freundschaft in diesen frühen empfindsamen Diskursen. Dieses zentrale Thema zeichnet sich bereits in dem Brief „An den Herrn Rittmeister von B****“ ab, welcher der Auswahl vorangestellt ist. In dem Scheiben findet sich eine Feststellung, die die gesamte Auswahl programmatisch charakterisiert: „Können die Verliebten in ihren Briefen, ohne es überdrüßig zu werden, von nichts, als von Liebe, reden: so müssen auch gute Freunde von der Freundschaft reden können, ohne dabey müde zu werden.“22 Wenn die Korrespondenz „die Stelle eines Gesprächs vertritt“, wie Gellert erläutert, wirft das Schreiben die Frage auf, inwiefern eine Antwort auf das hier formulierte emphatische Bekenntnis überhaupt möglich ist.23 Müsste die Replik nicht den gleichen Ton aufnehmen, nicht mit vergleichbaren Worten ein Gelöbnis unverbrüchlicher Freundschaft aussprechen?
Bereits dieser erste Brief zeigt daher, dass Gellerts epistolographisches Programm das dialogische Modell des Briefes unterläuft. Der Brief wird zum Ausdruck eines Gefühls, das in der Einsamkeit der Niederschrift in Nuancen und Abstufungen introspektiv ergründet und in der Nachempfindung geläutert und intensiviert wird. Das selbstreflexive Moment, das für den Prozess des Schreibens konstitutiv ist, gerinnt in einem Text, der das Gefühl übersteigernd in die Selbstreferentialität abzugleiten droht. Der empfindsame Brief ist nicht der individuelle Ausdruck eines spontanen Erlebens, das, dem Adressaten übermittelt, den Schreiber eine Antwort erwarten lässt, vielmehr liegt seine Bedeutung in einer auf den Verfasser selbst bezogenen Funktion, die über den Prozess der Kommunikation hinaus auf das Subjektive, bereits Vereinzelte und Monologische weist.
Dies zeigt sich auch in den folgenden Schreiben. Der zweite Brief berichtet in humoristischem Ton von einer Fahrt mit der „Landkutsche“.24 Die hier vorgetragene Geschichte hält die Balance zwischen epischer Erzählung und epistolarem Bericht. Der retrospektiv resümierende Gestus des Schreibens vergegenwärtigt zwar die Unannehmlichkeiten einer Reise und berichtet von den erlittenen Beschwernissen, gleichwohl entschuldigt sich Gellert am Ende des Briefes mit den Worten: „Vergeben Sie mir, daß ich Ihnen schon so viel erzählt habe.“25 Das Erleben wird reflexiv gebrochen und in dem dialektischen Prozess einer erzählten Erinnerung zu einem konstitutiven Bestandteil des Selbstentwurfes des Schreibenden. Dieser Selbstentwurf jedoch oszilliert zwischen einer Dialogizität, die durch das Medium des Briefes vorgegeben ist, und dem Soliloquium eines Tagebuches. Die Lektüre des Briefes ermöglicht nicht die unmittelbare Teilhabe an dem geschilderten Geschehen, sondern lässt den Leser an der Erinnerung des Schreibers teilnehmen.
Der dritte und der vierte Brief, die beide an den Herrn von P*** gerichtet sind, sind ebenfalls Ausdruck dieser Haltung. „Was machen Sie? Was macht Ihre liebe Gemahlinn?“, fragt der Schreiber einleitend, um an sich selbst gewandt mit der rhetorischen Frage fortzufahren: „Doch kann ich mir diese Frage nicht selber beantworten?“26 Es schließt sich ein lyrischer Einschub an, der über das Glück einer erfüllten Paarbeziehung reflektiert.27 Indem Gellert an die Zeit erinnert, da er Zeuge des vertrauten Umganges der Eheleute geworden ist, entsteht eine Spannung, welche die Gemeinschaft des Paares mit der Einsamkeit des Schreibenden kontrastiert und den Brief als eine schmerzhafte Betrachtung über die eigene als defizitär empfundene Lebenssituation ausweist.28 Dem Schreiben ist zugleich ein kompensatorisches Moment immanent. Die Imagination einer Gemeinschaft zwischen Mann und Frau tritt hier an die Stelle der erlebten Wirklichkeit, übertrifft diese sogar, denn Gellert schließt mit der Aufforderung: „Schreiben Sie mir nur, daß Sie beide noch nach meinem Wunsche leben […].“29
In dem nachfolgenden Kondolenzschreiben erfährt der Leser von dem Tod der Gattin des Herrn von P***. Indem der Brief den Schmerz des Ehemanns antizipiert („Weinen Sie, liebster Freund, ich weine zugleich.“30), betont Gellert nicht nur seine freundschaftliche Verbundenheit und die christliche Tugend des Mitleids, sondern zugleich eine empfindsam übersteigerte Bereitschaft zur Teilhabe an den Gefühlsregungen des anderen, welche die Empfindungen und Erfahrungen des Gegenübers dem eigenen Erleben anverwandelt.31
Dieses gesteigerte Moment der Selbstreferentialität wird in dem sich anschließenden Brief „An den Herrn von E***“ ironisch gebrochen.
Halb ist es Rache, daß ich Ihnen so spät antworte, und halb Beschäfftigung. Rache? werden Sie sagen; Ist nicht mein langes Stillschweigen durch eine Menge verdrießlicher und trauriger Zufälle entschuldigt genug? Nein, mein lieber Herr von E – – Sie mußten doch Ihre Noth iemanden klagen warum haben Sie mich nicht dazu erwählt? Warum haben Sie mir nicht das traurige Vergnügen gemacht, mit Ihnen zu fühlen, indem ich Sie aufgerichtet hätte?32
In den ersten Briefen der Mustersammlung entsteht auf diese Weise ein zweifaches Spannungsverhältnis, das in jedem der dreiundsiebzig Schreiben erneut variiert wird. Zum einen werden die Gefühle und Leidenschaften des Schreibenden in dem reflexiven Prozess, welcher der Niederschrift vorausgeht, nicht nur in dem Sinne geläutert, die der englische Dichter William Wordsworth als „emotion recollected in tranquillity“ beschrieben hat33, sie werden zugleich gesteigert und überformt, so dass der niedergelegte Ausdruck der Leidenschaft nuancierter, intensiver und reichhaltiger ist als das reale Erleben, in dem er seinen Ursprung genommen hat.
Zum anderen liegt die Bedeutung des Briefes nicht in seiner Funktion als Medium, das Ereignisse oder gemachte Erfahrungen dem Korrespondenzpartner mitteilt, sondern im Prozess des Schreibens. Die Wirklichkeit ist nur noch Anlass und Ausgangspunkt einer schreibenden Erkundung des Selbst. Indem aber die subjektive Reflexion Gegenstand und Absicht des Briefes ist, erfüllt sich seine Aufgabe in dem Augenblick, da die Niederschrift abgeschlossen ist. Damit befreit Gellert den Brief aus dem Zwang der traditionellen rhetorischen Epistolographie und konstituiert eine originär literarische Gattung. Der aus der Subjektivität erwachsenen Selbstreferentialität haftet jedoch bereits ein Moment jener Vorstellung von der Autonomie des Kunstwerkes an, die für das Dichtungsverständnis der nachfolgenden Generationen programmatisch werden sollte.
Im achtundvierzigsten Brief der Sammlung wird dieser Gedanke in besonderer Weise betont. Das Schreiben ersetzt den Dank, den es abzustatten anhebt, durch eine Betrachtung über den Wert der Freundschaft.
Ein jeder neuer Freund ist mir ein neues Glück, für das ich dem Himmel danke. Ich weis mir überhaupt kein edler Vergnügen zu machen, als wenn ich meine Freunde in Gedanken sammle, und mich mit diesen rechtschaffnen Männern so betrachte, als ob wir eine eigne Familie in der Welt ausmachten. Wie freue ich mich, wann ich von einem zu dem andern gehe, bey jedem verschiedne Gaben und Verdienste, und doch bey allen einerley guten Geschmack, bey allen ein empfindliches und großes Herz antreffe!34
Die Vorstellung tritt an die Stelle der realen Begegnung. Die gedachte Zusammenkunft der Freunde in der Imagination ist nur auf die Gefühlsregungen des schreibenden Subjekts gerichtet, das sich der freundschaftlichen Verbindungen bewusst wird, in diesem Bewusstsein aber nicht mehr zu und mit seinem Briefpartner spricht, sondern diesem nur noch von derjenigen Vorstellung berichtet, die in der Reflexion über die Freundschaft in ihm aufsteigt.
Während der Brief als Gebrauchstext Informationen übermittelt, eröffnen die literarischen Briefe Gellerts die Teilhabe an den Empfindungen des Verfassers. Der Leser antizipiert nicht die Wirklichkeit des Schreibenden, sondern die Reflexion über dessen subjektive Wahrnehmung der Wirklichkeit. Zudem entsteht die Gemeinschaft nicht in der unmittelbaren Zweisamkeit einer Begegnung, sondern vermittelt durch eine Lektüre. Der Text, der diese Gemeinschaft im imaginären Raum inszeniert, wird zu einem Substitut für eine als defizitär empfundene Wirklichkeit, ist eine Chiffre für die Sehnsucht nach der im Diskurs der Aufklärung verloren geglaubten Ganzheit. Der Widerspruch dieser Denkfigur liegt in dem unbedingten Glauben an die Möglichkeit, die empfindsame Seelengemeinschaft in einem künstlerisch durchformten und deshalb bereits zu Literatur gewordenen Text vollziehen zu können und so die Erfahrung von Getrenntheit durch die Trennung zu überwinden.35
Der Prozess der Kommunikation verlagert sich auf diese Weise in den psychischen Innenraum, wird zu einer sich steigernden Wechselrede empfindender Seelen, die als Gemeinschaft zweier Einsamkeiten auf eine paradoxe Weise zwischen Monolog und Dialog changiert und deshalb bereits ein Moment desjenigen entfremdeten Selbst- und Weltbezuges in sich trägt, der in der deutschen Literatur nach Johann Wolfgang von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ wirkungsmächtig werden sollte.