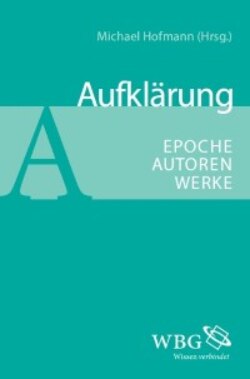Читать книгу Aufklärung - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Friedrich Gottlieb Klopstock und die Aufklärung
ОглавлениеKevin F. Hilliard
In der Nacht vom 21. zum 22. Dezember 1759 gab es in Kopenhagen ein Erdbeben. Es dauerte nur kurz. Immerhin schepperten bei Klopstocks die Kupferstiche „laut genug“ an der Wand.1 Am 04. Januar 1760 berichtete der Dichter in der moralischen Wochenschrift „Der nordische Aufseher“ davon, wobei er eine Verbindung herstellte zu der gleichzeitigen Genesung des Königs, Friedrichs V. von Dänemark, von einer Krankheit. In beiden Ereignissen sei die Hand Gottes zu erkennen:
Kann man sich überreden, dass Gott [das Erdbeben] ohne Ursache in diesen Tagen habe kommen lassen? Wir sollten desto feuriger für die Erhaltung des Königs danken können, weil wir zugleich für unsere eigne zu danken hatten.2
Da es unmöglich sei, „den Dank für solche Gnaden zu oft [zu] wiederholen“, habe er eine „Ode“ gedichtet, die seinen Lesern eine Anleitung dazu gibt.3 In diesem „Danklied für die Genesung des Königes von den Blattern“ heißt es:
Mengen erlagen!4
Doch Ihn berührte
Sanft deine Hand nur!
[…]
[I]n der Stunde deiner reichen Gnaden,
Da Du ihn erhieltest,
Da rührtest Du auch uns mit sanfter Hand an.
Vater, die Erde
Bebt’, und wir leben!
[…]
Des Richters Arm, der über andre Völker
Fürchterlich sich ausstrekt!
Die Städt’ erschütert, dass sie im Erdbeben
Donnern, und fallen,
Unterzugehen!
Der itzt die Völker,
Dass es sie würge,
Dem Schwerte zuführt!
Der Arm wird über unserm Haupt erhoben,
Ach, dass er uns segne!
Und, dass wir, auf des Segens Fülle, merken!
Wecket er sanft uns
Auf aus dem Schlummer!5
Alle bekannten Ereignisse, in denen Gott seinen Zorn über die Menschen ausgeschüttet hatte, ließen die dem dänischen Reich erzeigte Gnade desto stärker hervortreten. Mit dem gegenseitigen „Würgen“ der „Völker“ war der Dritte Schlesische Krieg gemeint, der 1759 schon im vierten Jahre stand6; und der Hinweis auf die Heimsuchung „andrer Völker“ durch Erderschütterungen erinnerte an das Lissabonner Erdbeben vom 01.November 1755.7
Diese Katastrophe hatte manchem Zeitgenossen, so dem sechsjährigen (!) Goethe, „die Güte Gottes einigermaßen verdächtig“ gemacht.8 Klopstock dagegen war empört gewesen, dass viele darin nur die nachteiligen Folgen für den Handel und nicht ein „überaus merckwürdiges Gericht des allmächtigen Regierers der Welt“ erkennen wollten.9 Das Kopenhagener Beben vier Jahre später war eine willkommene Gelegenheit, sie zur Besinnung zu bringen. Die Gleichzeitigkeit von Krieg im Ausland, Frieden zuhause, einem von den Blattern verschonten König und einer von einem Erdbeben verschonten Stadt lasse sich nur als Wink der göttlichen Allmacht verstehen, aufzumerken und „des Segens Fülle“ in Demut zu empfangen.
Dass die Kopenhagener dabei „aus dem Schlummer“ aufwachten, mag der schlichten Tatsache entsprechen, dass das Erdbeben während der Nacht stattfand. Wo aber alles seine Bedeutung hat, hat auch diese Einzelheit eine theologische Dimension. Das Leben, belehrt uns Klopstock in einem 1758 für den „Aufseher“ verfassten Aufsatz, lässt sich in „eigentlichen Schlaf“, „Schlummer“ und „wirkliches Wachen“ einteilen. „Das wirkliche Wachen“ ist nicht etwa der Alltagszustand zwischen Aufstehen und Zubettegehen. Es ist vielmehr „derjenige glückliche Zustand unsrer Seele, da wir […] Gott denken“.10 In diesem Sinne war das Erdbeben als ein Denkanstoß zu werten. Es sollte die Menschen aus Körper- und Seelenschlaf zum „Denken“, zur Andacht, wecken. Und wer das wirkliche Erdbeben verschlafen hatte, sollte wenigstens durch die Ode wachgerüttelt werden.
Nun übersteigen alle Gedanken von Gott und seinem Verhältnis zu den Menschen in mehr als einer Hinsicht den Verstand. Alle „Kräfte“ der Seele müssen aufgeboten werden, um solchen erhabenen Gedanken gerecht zu werden. Über manches, was dem kalten Verstand als „unbegreiflich“ erscheint, muss man sich hinwegsetzen. Die Sprache versagt fast bei dem Versuch, das Gedachte auszudrücken; es ist ein „Gedränge“ von „schnellfortgesetzten Gedanken“, die das Auffassungsvermögen überwältigen.11
So scheint sich dem Impuls, allen Menschen zu dem wachen Bewusstsein Gottes zu verhelfen, das Hindernis entgegenzustellen, dass dem Gemüt dabei Anstrengungen abverlangt werden, zu denen nicht alle in gleichem Maße fähig sind. Dieser an sich „niederschlagend[en] und traurig[en]“ Erkenntnis trägt Klopstocks Dichtungsbegriff Rechnung, indem er zwischen „heiligen Gedichten“ zweierlei Art unterscheidet. Den von ihm so genannten „Gesängen“, womit seine eigenen freirhythmischen Oden gemeint sind, werden schlichtere geistliche „Lieder“ gegenübergestellt. Zeichnen sich jene durch eine schwierige, „erhabne Schreibart“ aus, sind diese in Gedanken und Stil „gemildert“ und damit dem Auffassungsver mögen der Menge angepasst.12
Wir sind gewohnt, in Lyrik vor allem Ich-Aussprache zu suchen. Manchen Lesern ist Klopstock in der steilen Erhabenheit seiner „Gesänge“ und des „Messias“ wie ein Solitär erschienen, der sich von Klagen über die „Dunkelheit“ seines Stils13 nicht beirren ließ, den eigenen Weg zu gehen, und damit einen noch für George und Rilke verbindlichen, elitären Dichtertypus schuf.14 Klopstocks eigenem Dichtungsverständnis wird das nur halb gerecht. Die Beschwörung einer vornehm-empfindsamen Gemeinschaft „weniger Edler“15 war selbst in seiner weltlichen Dichtung eine vorübergehende Erscheinung, die sich sozialpsychologisch aus der unsicheren Versorgungslage einer Gruppe von jungen Männern zwischen Studium und Beruf erklären lässt. In der geistlichen Dichtung aber war ein konsequent elitäres Denken ausgeschlossen. Da gebot die Pflicht, alle Mitmenschen an ihre wahre Bestimmung zu erinnern. Dem „Vorwurf“, „es […] nicht gethan“ zu haben16, mochte und durfte der Dichter sich nicht aussetzen.
Das gilt in der Praxis auch für die freirhythmischen Oden, obwohl sie nach Klopstocks theoretischer Beschreibung an einen kleineren Kreis gerichtete „Gesänge“ sind, die der Dichter auch noch „zu sich erheben“ müsse, bevor sie „erhabner denken“ lernten.17 Dazu scheint zu passen, dass die Aufnahmebereitschaft für bestimmte Wahrheiten offenbar nur bei wenigen vorausgesetzt werden kann. In „Dem Allgegenwärtigen“ klagt Klopstock, dass
Wenige nur, ach, wenige sind
Deren Aug in der Schöpfung
Den, der geschaffen hat, sieht!
[…]
Wenige Herzen erfüllt
Mit Ehrfurcht und Schauer
Gottes Allgegenwart!18
Damit hat es aber nicht sein Bewenden. Gerade die „Allgegenwart“ Gottes predigt dessen Absicht, alle Menschen aus dem Seelenschlaf zu erwecken und der Gnade teilhaftig werden zu lassen. Und so versucht auch Klopstocks Ode, sich über die eigene pessimistische Einschätzung (und über Matthäus 22,14: „Denn viel sind beruffen, aber wenig sind auserwählt“) performativ hinwegzusetzen, indem sie zwar von den wenigen spricht, sich aber an alle wendet. Die „Vielen“19 sollten lesen und sich betroffen fühlen, um schließlich die Zahl der „Wenigen“ so weit anwachsen zu lassen, bis diese Bezeichnung sich selbst aufhöbe. Klopstock hat sich immer gefreut, wenn seine „Arbeiten“ bei „Ungelehrte[n]“ Wirkung zeigten.20 Die Verbreitung in einer moralischen Wochenschrift – wie die anderen freirhythmischen Oden erschien auch „Dem Allgegenwärtigen“ zuerst im „Nordischen Aufseher“ – war in diesem Sinne folgerichtig.21 Auch das „Danklied für die Genesung des Königes“ gehört selbstverständlich hierher. Zu Klopstocks zweitem Typus des „Lieds“ gehörig und daher von vorneherein auf die „Meisten“ zugeschnitten22, bekam es einen weiteren medialen Anschub dadurch, dass ihm sowohl zur Beförderung der Eingängigkeit als auch zur Erleichterung der Wiederholung die Melodie eines bekannten Kirchenlieds untergelegt wurde.23
Klopstock legte überhaupt Wert auf Wiederholung. Zu den „Betrachtungen über die Allgegenwart Gottes“ (noch der Fettdruck des Originals leistet Überzeugungsarbeit) meinte er, dass sie zu den „grossen Gedanken“ gehören, an die „[m]an […] sich und andre nie zu oft erinnern“ kann.24 In einem weiteren Beitrag zum „Aufseher“ schlachtete er – nach dem Grundsatz, dass „[w]ir […] die Schwäche unsers Danks durch öftere Wiederholung desselben […] ersetzen [müssen]“25 – das in der Genesungs-Ode besungene Wunder noch einmal aus; und diese selbst war schon Wiederholung des Danks gewesen. Woher kommt aber dieses beharrliche, durch mediale Multiplikatoren verstärkte Einreden auf die Leser? Das hypertrophe nie zu oft – dem ein nie zu eindringlich als Summe der poetologischen Aufsätze hinzuzufügen ist26 – woher kommt es?
Die naheliegende Antwort, das Gebot christlicher Nächstenliebe, greift zu kurz. Wenn die christliche Botschaft über Katechismus, Gottesdienst und Predigt hinaus der Verstärkung bedurfte, musste sie vorher geschwächt worden sein; wenn die Lektion ständig wiederholt werden musste, standen ihrer Erlernung offenbar hartnäckige Hindernisse im Weg; wenn das Erinnern solche Mühe bereitete, musste das Vergessen starke Fürsprecher haben; wenn viele ihr Leben im halbwachen Schlummer verbrachten, musste der Schlaf mächtige Reize besitzen. Die binnentheologische Begründung „das Fleisch ist schwach“27 mag als Ausdruck von Klopstocks eigenem Gefühl hingehen; als historische Erklärung ist sie ungenügend. Auf der Suche nach den wahren Ursachen müssen wir über das Ich des Dichters, über die konzentrischen Kreise der „wenigen“, der „vielen“, ja der „meisten“, die sein Publikum bildeten, hinaus, und nach den anderen fragen, die außerhalb standen: Denn von dieser dunklen Masse ging der Sog aus, von dem die Glaubensgemeinschaft bedroht war.
Von diesen anderen ist bei Klopstock sehr wohl die Rede; nur seine Kommentatoren haben sich bisher kaum darum gekümmert, welche Rolle sie in seinem Denken spielten. Seine Dichtung aber ist um eine wichtige Dimension verkürzt, wenn man nicht erfasst, in welchem Ausmaß er sie zu einer Gegenoffensive gegen den Unglauben seiner Zeit mobilisierte. Und erst von hier aus lässt sich sein Verhältnis zu den geistigen Strömungen seiner Zeit und vor allem zur Aufklärung verstehen.
Gleich zwei der „Geistlichen Lieder“ von 1758 haben den Titel „Die Feinde des Kreuzes Christi“.28 Beide greifen die Gegner des Christentums an, die in „ihres Grübelns Täuscherey“ behaupten, dass „kein Versöhner Gottes sey“, und die mit dieser „Pest“ auch die Gläubigen vergiften, „die zu sicher schlummern“.29 „Dieser Lehre Pest“
Schleicht itzo nicht im Finstern mehr!
Am Mittag, Herr! bricht sie hervor!
Sie herrscht durch Grosse dieser Welt!
Herr, Herr! wenn uns dein Arm nicht hält;
So reißt sie uns zum Tod auch fort!30
Die Leugner des „Versöhners“ sind die Deisten und Freigeister, die zwar das Dasein Gottes anerkennen, nicht aber die Göttlichkeit Christi. Klopstock äußert die Vermutung (und legt sie im Lied der Gemeinde mitten im Gottesdienst in den Mund!), dass deistische Grundsätze in den höheren Kreisen der Gesellschaft Wurzel gefasst hatten, wenn sie sich nicht gar allerhöchster Protektion erfreuten – ein Verdacht, der im Hinblick etwa auf das Preußen Friedrichs II., der in ganz Europa gerade deswegen von sich reden machte, durchaus seine Berechtigung hatte.
Ähnliche Klagen waren vielerorts zu hören. Ebenso sann man überall auf Abhilfe. Wenn die Freigeisterei weite Teile der Gesellschaft erfasst hatte, der Offenbarungsglaube in Bedrängnis war, die Kanzel aber versagte, musste man andere publizistische Mittel mit einer größeren Breitenwirksamkeit ergreifen. Solche Überlegungen waren es, die in Kopenhagen die Verfasser des „Nordischen Aufsehers“ zusammen treten ließen.31
Schon der Blick auf das Inhaltsverzeichnis macht deutlich, worum es ging. Einmal wird „das Vorurtheil von der Rechtschaffenheit ohne Religion“ widerlegt. Dann werden die „Einwürfe wider die Religion, und [die] Regeln, wie sie beurtheilt werden müssen“, behandelt. Ein fingierter Brief stellt die „Prahlerey einiger Freygeister“ an den Pranger. Die „moralische Güte der Glaubensgeheimnisse“ wird verteidigt. Die irrige Meinung, „daß die Offenbarung nicht gegeben sey, rechtschaffene Menschen zu machen“, wird berichtigt.32 Die „besondere“, d.h. die sich in Einzelfällen als Wunder äußernde „Vorsehung Gottes“ wird vindiziert.
Aber auch andere, zunächst unverfänglich scheinende Beiträge haben oft einen theologischen Einschlag. In einer Art Ratgeberkolumne beantworten z.B. einige fiktive Mitarbeiterinnen die Gewissensfrage einer jungen Frau, ob sie „einen Freygeist heirathen“ dürfe, den sie „zu einem Christen zu machen hoff[t]“. Wenn sie sich, so die Antwort, einmal klargemacht hat, „daß ein Freygeist aufs höchste nur einige scheinbare gute Eigenschaften haben kann“, wird sie einsehen, dass sie es unterlassen müsse. „Lernen Sie ihn ganz kennen: So werden Sie aufhören, ihn zu lieben.“33
Dieses letzte Stück ist von Klopstock.34 Wie er hier in die Rolle eines weiblichen Ratgeberkollektivs schlüpft, sind seine sonstigen Beiträge – 26 von insgesamt knapp 200 – zugleich realiter als seine eigenen Werke anzusehen (und sind im Inhaltsverzeichnis als solche gekennzeichnet), als auch, auf der fiktionalen Ebene, als die des als Sohn von „Nestor Ironside“ aus dem „Guardian“ von Richard Steele (1713) sich ausweisenden „nordischen Aufsehers“.35 Durch die Fiktion des alleinigen Autors bzw. Herausgebers werden die wirklichen Autoren auf eine gemeinsame Identität und auf eine gemeinsam vertretene Linie eingeschworen.
Was der Leser zu erwarten hat, macht auf der ersten Seite ein Stich deutlich, auf dem man eine schreibende Figur erkennt, die zu Füßen der allegorischen Gestalt der christlichen Religion sitzt; weitere Unterweisung gibt ein dazugetretener Engel.36 Die darauf folgenden Ausführungen „Arthur Ironsides“ bestätigen den Eindruck. Aus England habe er „die grossen Grundsätze der besten Religion“ in seine neue, „nordische“ Heimat mitgebracht.37 Sein „Vorsatz“ laute, „alle Menschen zu überführen, wie sehr es ihr eigner Vortheil erfodere, […] an der Erhaltung und Ausbreitung der Gottseeligkeit […] [und] der Tugend […] zu arbeiten“.38 Was letztere betrifft, werde er sich von der Überlegung leiten lassen, dass die „Moral“ ihre Arbeit immer „zu den Füßen der Religion“ verrichte.39 In dem Vater habe man „einen Mann“ gefunden, der eben deshalb ein energischer „Bestreiter des Unglaubens“ gewesen sei.40 Ihm werde der Sohn nacheifern. Deswegen werde es ihm ein besonderes Anliegen sein, „Warnungen vor Schriften“ auszusprechen, „in denen entweder das Genie oder der Witz gemisbraucht sind, die Religion zu bestreiten oder verdächtig zu machen“.41
Gewiss wird man diese programmatischen Worte zuallererst auf die Rechnung des tatsächlichen Herausgebers Johann Andreas Cramer setzen müssen. Dessen wissenschaftliches Hauptwerk ist die 1748 in erster Auflage erschienene, ausführlich kommentierte Übersetzung von Bossuets „Discours sur l’histoire universelle“ (1682).42 Die Stoßrichtung gegen die „Freygeister“ ist bei Bossuet wie bei seinem Übersetzer deutlich.43 Es gibt jedoch keinen Grund zu glauben, dass Klopstock anders dachte. Er stand Cramer über Jahre hinweg nahe.44 Dieser war als einer der „Bremer Beiträger“ für das Erscheinen der ersten drei Gesänge des „Messias“ 1748 mit verantwortlich gewesen und hatte sich in der anschließenden Kontroverse für Klopstock eingesetzt.45 Im Gegenzug vermittelte dieser Cramers Berufung an eine Hofpredigerstelle in Kopenhagen.46 Dort hörte Klopstock regelmäßig seine Predigten47 (u.a. eine „starcke Predigt“ über das Lissabonner Erdbeben48). Als seine Frau 1758 starb, suchte er bei Cramer Trost und bat ihn, ihm „seine Gedanken über die Absichten Gottes bey einer so ausserordentlichen Prüfung mitzutheilen“.49 Wenn also der „nordische Aufseher“ Arthur Ironside zunächst eine Maske Cramers ist, so passt sie ebenso gut auch auf Klopstock: Auch er ist damit in emphatischem Sinne „Bestreiter des Unglaubens“.
Von den Beiträgen zum „Aufseher“ wären hier neben den alsbald berühmt gewordenen freirhythmischen Oden besonders die „Betrachtungen über Julian den Abtrünnigen“ anzuführen, in denen Klopstock die Demontage einer Galionsfigur des freigeistigen 18. Jahrhunderts unternimmt.50 Von den geistlichen Liedern ist bereits die Rede gewesen. Auch die biblischen Dramen, „Der Tod Adams“, „Salomo“ und „David“, die in den Kopenhagener Jahren entstanden sind, waren nicht als bloßes „Musenspiel“ gedacht, sondern wollten die „ Würkung der Religion“ in Szene setzen und den Spöttern „Baile, Morgan, Voltaire“ eins auswischen, wie Herder zurecht bemerkte.51 Noch in Klopstocks beiden Entwürfen für eine weltliche Gelehrtenrepublik werden die Freigeister als Feinde des Gemeinwesens in Acht und Bann getan.52
In erster Linie ist aber in diesem Zusammenhang selbstverständlich sein Epos „Der Messias“ (1748–1773) zu nennen. Es war, wie ein anderer „Aufseher“-Beiträger zu Recht bemerkte, „ein Werk zur Verherrlichung der Religion“.53 Mit seinen 20 Gesängen und fast 20.000 Versen sollte es schon durch Masse wirken; noch mehr durch das Prestige, das ein in der Tradition des antiken Epos stehendes Gedicht beanspruchen durfte. Es ist vor allem aber die Konzeption, die im Ganzen und im Einzelnen auf eine Wiederherstellung des Offenbarungsglaubens ausgerichtet ist. Wenn die Wühlarbeit der Freigeister die Offenbarung in „einen großen Schauplatz von Trümmern“ zu verwandeln drohte, sollte sie der „Messias“ wieder zum „majestätischen Tempel“ machen.54
Wie dieses Vorhaben durchgeführt wird, kann hier nicht in allen Einzelheiten ausgeführt werden. Bernd Auerochs hat das Richtige getroffen, indem er auf die apologetische „Frontstellung“ des Werks und dessen Erbauungsfunktion sowie auf die dieser Absicht dienende theologische Durchsättigung der Erzählung hinweist55; und auch Johann Anselm Steigers These ist zuzustimmen, wonach „der Messias durch und durch in Dichtung gesetzte Dogmatik ist“ und eine „poetische Metakritik an der […] Aufklärungstheologie“ vornimmt.56
Festmachen lässt sich die Absicht des „Messias“ zunächst an dem die Handlung beherrschenden Motiv des Triumphes.57 Das Leiden Christi bis zu seinem Tod am Kreuz in den ersten zehn Gesängen ist nur die dunkle Folie zu seiner umso glanzvolleren „Erhöhung“ (XIII, 842). Nur weil er einen „Sieger“ (XIII, 717) brauchte, ist überhaupt verständlich, warum Klopstock das epische Gedicht zur Einkleidung seiner Erzählung wählte. Wie die Helden des antiken Epos leistet sein Christus „große Taten“ (XIII, 875), um schließlich als „Überwinder“ (XVIII, 261; XIX, 245) aus dem Kampf mit seinen Feinden hervorzugehen; und wie ein christlicher Aeneas begründet er in dem diesen Triumph besiegelnden Weltgericht ein neues, großes, ja ewiges Reich.58 War noch innerhalb der irdischen Handlung mit den „Zweiflern“ abgerechnet worden59, werden auf dem überirdischen Schauplatz nicht nur die zeitlos-mythologischen Figuren, der Teufel oder die historischen Feinde Christi, sondern auch die philosophischen „Göttererfinder“ (XVIII, 657; vgl. 642–654), die „Spötter“ (XVIII, 253) und die „geistlichstolzen Halbchristen“60 (XIX, 35–87) verdammt: Die Repräsentanten also der freigeistigen oder von freigeistigen Strömungen erfassten Zeitgenossen Klopstocks.61
Bezeichnenderweise besteht die allererste Heldentat Christi, der erste „leise Tritt“ zu seiner „Erhebung“ (XIII, 874–875), in der Verdammung eines toten heidnischen Tyrannen (XIII, 856–874). Handlungslogisch und offenbarungsdogmatisch war das Gericht über die Sünder eine Notwendigkeit. Da nützt es nichts, dass im gleichen Augenblick Christus auf den auferstandenen Adam „liebend“ herabsieht (XIII, 855); oder dass Klopstock selber die Doktrin der Ewigkeit der Höllenstrafen bestritt und zum Zeichen davon im „Messias“ den reuigen Teufel Abbadona begnadigen ließ (XIX, 91–235).62 Das Gericht lässt sich nicht wegräsonnieren. Selbst für den mit Gott Versöhnten ist die Liebe nur der zurückgehaltene Zorn. Beim Kopenhagener Erdbeben war es nicht anders gewesen: Gottes Liebe erwies sich dort darin, dass sein Zorn an seinen Auserwählten vorüberging, um sich sichtbar an den Sündern zu entladen. Ohne dass an den anderen tatsächlich eine Strafe vollstreckt wurde, kann es kein Bewusstsein davon geben, dass man selber aus Liebe verschont wurde. Ebenso wie seine theologischen Zeitgenossen scheitert Klopstock „an der biblischen Dialektik von Zorn und Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“.63 Der Widerspruch im „Messias“ – oder, wenn man will, das sich der Einsicht des Menschen noch entziehende Geheimnis64 – bleibt unaufgelöst stehen. Den Spielraum, der sich dabei ergab, konnte Klopstock aber in den üppig ausgemalten Gerichtsszenen der kulminierenden Gesänge ausnützen, um in einer Zeit realer Gefährdung wenigstens im Glauben und in der Fiktion Christi Sieg über die Feinde zu feiern und auszukosten.
Das andere apologetische Moment des „Messias“ liegt in der konsequent nach typologischen Gesichtspunkten durchgeführten Verzahnung des Passionsberichts und der Himmelfahrt aus dem Neuen mit den Verheißungen aus dem Alten Testament.65 Das Geschehen wird von Anfang bis Ende von den wieder zum Leben erweckten Patriarchen und Propheten des Alten Bundes begleitet und kommentiert, die in dem leidenden, auferstandenen und triumphierenden Christus die Erfüllung des ihnen nur dunkel Offenbarten erleben. Zusammen mit den gleichfalls auftretenden Engeln und Teufeln erfüllen sie die Forderung des Epos nach übernatürlicher „Maschinerie“.66 Es ist jedoch vor allem die theologische Absicht, die hier bestimmend ist. Durch die Rückführung der Religion Christi auf die Anfänge der Schöpfung soll bewiesen werden, dass das Christentum keine menschliche Erfindung ist, wie die Freigeister behaupteten.67 Und durch das gegenseitige Abbildungsverhältnis von Altem und Neuen Testament will Klopstock noch einmal den Beweis der Göttlichkeit der Bibel führen: Denn muss nicht ein Werk göttlich sein, in dem Weissagung und Erfüllung so genau zueinander passen?68 Dass diese Verzahnung ein Artefakt willkürlicher Exegese und einer bewusst auf die Weissagungen hin berechneten messianischen Erwartungshaltung bei Protagonisten wie Redaktoren des Neuen Testaments sein könnte, wie die Bibelkritik es nahelegte, kommt ihm nicht in den Sinn.
Was ist von all dem aufklärerisch? Für den Freund der Aufklärung und Bewunderer Klopstocks muss die Antwort ernüchternd ausfallen. Natürlich ist Aufklärung nicht mit Anti-Christentum zu verwechseln. Wenn aber auch innerhalb der Theologie und der Religion Skepsis, Bibelkritik, Aufkündigung der unbedingten Offenbarungshörigkeit und die Abkehr von orthodoxen Deutungsmustern (etwa bei Erdbeben!) zur Aufklärung gehören, kann bei Klopstock davon nicht die Rede sein.69
Gewiss: Nicht alle Facetten seines Schaffens sind damit erfasst.70 In erster Linie wollte Klopstock aber geistlicher Dichter sein71, und als solcher ist er hier behandelt worden. Ein christliches Epos sollte seinen Ruhm begründen.72 Wie der Messias den rechten Glauben in die Welt brachte, wollte die „Messiade“ helfen, ihn zu erhalten. Seinen Lesern rief er ein „wachet auf“73, kein „sapere aude!“ zu; als „Aufseher“ wollte er weiter die „Oberaufsicht“ über sie führen, anstatt sie aus der Vormundschaft in die „Mündigkeit“ zu entlassen.74 Das lässt freilich alle Fragen nach der dichterischen Qualität seines Schaffens noch offen.
1 Friedrich Gottlieb Klopstock: Oden, in: Ders.: Werke. Historisch-kritische Ausgabe, hg. von Horst Gronemeyer, Elisabeth Höpker-Herberg, Klaus Hurlebusch und Rose-Maria Hurlebusch, 23 Bde., Berlin/New York 1974ff. [fortan zitiert unter der Sigle ‚HKA‘], Abteilung Werke [fortan zitiert unter der Sigle ‚HKAW‘], Bd. I.1:Oden. Text, hg. von Horst Gronemeyer und Klaus Hurlebusch, Berlin/New York 2010, S. 205.
2 Ebd., S. 200.
3 Ebd.
4 Von 4000 Erkrankten starb jeder vierte: so Klopstock an Salomon Geßner vom 02.01.1760, in: HKA, Abteilung Briefe [fortan zitiert unter der Sigle ‚HKAB‘],Bd. IV.1: Briefe 1759–1766. Text, hg. von Helmut Riege, Berlin/New York 2003, S. 58.
5 HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 200–207, hier S. 204 und 206.
6 Klopstock verfolgte das Kriegsgeschehen aufmerksam: vgl. Meta Klopstock an ihre Schwestern, 16.10.1756, in: Meta Klopstock. Es sind wunderliche Dinger, meine Briefe. Briefwechsel 1751–1758, hg. von Franziska und Hermann Tiemann, München 1980, S. 37f.
7 Vgl. HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 205.
8 Johann Wolfgang Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, in: Ders.:Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hg. von Erich Trunz, Hamburg 1948ff. (ab 1972 im Verlag C.H.Beck, München), Bd. 9: Autobiographische Schriften, München 1981, S. 47; vgl. ebd., S. 29–31.
9 Klopstock an seine Eltern, vor dem 26. und am 26. oder 28. Dezember 1755, in:HKAB, Bd. III: Briefe 1753–1758, hg. von Helmut Riege und Rainer Schmidt, Berlin/New York 1988, S. 30.
10 Friedrich Gottlieb Klopstock: Von der besten Art über Gott zu denken, in: Der nordische Aufseher, 3 Bde., Kopenhagen und Leipzig 1758–1761 [fortan zitiert unter der Sigle ‚NA‘], Bd. 1, S. 213–220, hier S. 213. Der Aufsatz ist in der Forschung mehrfach diskutiert worden. Zusammenfassend Dietmar Till: „Der Gräber Todesnacht ist nun nicht mehr! erwacht!“ Pietismus, Neologie und Empfindsamkeit in Klopstocks Bearbeitung von Nicolais ‚Wächterlied‘, in: Aufklärung 13, 2001, S. 70–102, hier S. 95–98; und Katrin Kohl: Die „beste Art über Gott zu denken?“ Auseinandersetzungen um das religiöse Potential der Dichtung im 18. Jahrhundert, in: Literatur und Theologie im 18. Jahrhundert. Konfrontationen – Kontroversen – Konkurrenzen, hg. von Hans-Erwin Friedrich, Wilhelm Haefs und Christian Soboth, Berlin/New York 2011, S. 225–242 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung 41).
11 Klopstock [Anm. 10], S. 218f.
12 HKAW, Bd. III.1: Geistliche Lieder. Text, hg. von Laura Bolognesi, Berlin/New York 2010, S. 3–5.
13 Werner Küster: Das Problem der „Dunkelheit“ von Klopstocks Dichtung. Ein Beitrag zur Geschichte des Verstehens von Dichtung im 18. Jahrhundert, Köln 1955.
14 Joachim Jacob: Klopstock – Ursprung des deutschen Ästhetizismus. Die Klopstock-Rezeption im George-Kreis, in: Wort und Schrift – Das Werk Friedrich Gottlieb Klopstocks, hg. von Kevin Hilliard und Katrin Kohl, Tübingen 2008, S. 255–272 (Hallesche Forschungen 27). Katrin Kohl: „Ruf-Stufen hinan“: Rilkes Auseinandersetzung mit dem Erhabenen im Kontext der deutschen Moderne, in: Rilke und die Moderne, hg. von Adrian Stevens und Fred Wagner, London 2000, S. 165–180. Ich-Bezug und „elitäre[s] […] Dichtungsverständnis“ diagnostiziert auch Hans-Georg Kemper in: Ders.: Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, Bd. 6.1: Empfindsamkeit, Tübingen 1997, S. 484–492. Vgl. auch: Klaus Hurlebusch: Klopstock, Hamann und Herder als Wegbereiter autorzentrischen Schreibens. Ein philologischer Beitrag zur Charakterisierung der literarischen Moderne, Tübingen 2001 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 86).
15 Friedrich Gottlieb Klopstock: Auf meine Freunde (1747), in: HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 6–30, hier S. 28.
16 Friedrich Gottlieb Klopstock: Vorrede zum Erstdruck des „Allgegenwärtigen“, in:HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 144.
17 HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 3.
18 Friedrich Gottlieb Klopstock: Dem Allgegenwärtigen, in: HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 144–158, hier S. 146.
19 HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 3.
20 An J. A. Ebert u.a., 03.09.1776, in: HKAB, Bd. VII.1: Briefe 1776–1782. Text, hg.von Helmut Riege, Berlin/New York 1982, S. 55.
21 Auf „Dem Allgegenwärtigen“ (1758) folgten im zweiten Jahrgang 1759 „Das Anschaun Gottes“, „Die Frühlingsfeyer“, „Der Erbarmer“ und „Die Glückseligkeit Aller“ (hier nach den in späteren Ausgaben festgelegten Titeln benannt).
22 HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 3.
23 HKAW, Bd .I.1 [Anm. 1], S. 200.
24 Vorrede zu „Dem Allgegenwärtigen“ im Erstdruck der „Oden“ [Anm. 1], S. 144.
25 Friedrich Gottlieb Klopstock: Gespräch von der Glückseligkeit, in: NA, Bd. 3,S. 164–174 und 187–210, hier S. 205.
26 Zur Poetologie vgl. Klopstock [Anm. 10] (zur dichterischen Anwendung vgl. die einleitenden Worte zu „Der Erbarmer“ in: HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 182); Friedrich Gottlieb Klopstock: Einleitung zu den Geistlichen Liedern, in: HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 3–8; Friedrich Gottlieb Klopstock: Von der heiligen Poesie, in: Ders.: Ausge wählteWerke, hg. von Karl August Schleiden, 2 Bde., München 1981, Bd. 2, S. 997–1009.
27 Klopstock: Dem Allgegenwärtigen, in: HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 144, nach Markus 14,38.
28 HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 20f. und 66f.
29 Ebd., S. 20.
30 Ebd., S. 66.
31 Vgl. Andre Rudolph: Klopstock und der Nordische Aufseher (1758–1761). Antideistische Apologetik und christliche Poesie im Zeichen Edward Youngs, in: Hilliard/Kohl (Hg.) [Anm. 14], S. 21–40, hier S. 23–26. Zur Konjunktur des apologetischen Schrifttums um die Jahrhundertmitte vgl. Bernd Auerochs: Die Entstehung der Kunstreligion, Göttingen 2006, S. 239f. (Palaestra. Untersuchungen zur deutschen und skandinavischen Philologie 323)
32 Dieses Stück ist eine Replik auf Lessings Kritik des „Aufsehers“ im 49. der „Briefe,die neueste Litteratur betreffend“ (1759).
33 Auszug aus dem Protocolle der Unsichtbaren, in: NA, Bd. 2, S. 787–799, hier S. 790 und 792.
34 Und ist womöglich ein Stich gegen Lessings „Der Freigeist“, wo die fromme Juliane zuletzt den Freigeist Adrast heiratet. Das Lustspiel war 1755 in Bd. 5 von Lessings „Schrifften“ erschienen, die Klopstock wahrscheinlich kannte: vgl. HKA, Abteilung Addenda, Bd. 2: Arbeitstagebuch, hg. von Klaus Hurlebusch, Berlin/New York 1977, S. 233f.
35 NA, Bd. 1, S. 3–8.
36 Ebd., S. 3.
37 Ebd., S. 6. Zum kontroverstheologischen Sinn der englischen Einkleidung vgl. Rudolph [Anm. 31], S. 23f.
38 NA, Bd. 1, S. 8.
39 Ebd., S. 16. Der Kupferstich auf S. 3 ist womöglich als bildliche Ausdeutung dieser Stelle zu verstehen.
40 Ebd., S. 8.
41 Ebd., S. 14. Allein im ersten Jahrgang werden Voltaire, Bolingbroke, Hume, die Deisten Woolston, Tindal, Morgan und Chubb sowie La Mettrie namentlich angegriffen (S. 145f., 163 und 518).
42 Jacob Benignus Bossuets […] Einleitung in die allgemeine Geschichte der Welt bisauf Kaiser Carln den Großen […] uebersetzt […] von Johann Andreas Cramer, 2. Auflage, Leipzig 1757. Die stark erweiterte 7. Auflage erschien 1786.
43 Ebd., S. 448f.
44 Diese Nähe wiegt m. E. schwerer als die in der Forschung seit Gerhard Kaiser immer wieder beschworene Affinität zur so genannten Neologie: vgl. Gerhard Kaiser:Klopstock. Religion und Dichtung, Gütersloh 1963, S. 28–104 (Studien zu Religion,Geschichte und Geschichtswissenschaft 1); Kemper [Anm. 14], S. 493; Till [Anm. 10];Walter Sparn: „Der Messias“. Klopstocks protestantische Ilias, in: Protestantismus und deutsche Literatur, hg. von Jan Rohls und Gunther Wenz, Göttingen 2004, S. 55–80 (Münchener theologische Forschungen 2). Vgl. dagegen Johann Anselm Steiger: Aufklärungskritische Versöhnungslehre. Zorn Gottes, Opfer Christi und Versöhnung in der Theologie Justus Christoph Kraffts, Friedrich Gottlieb Klopstocks und Christian Friedrich Daniel Schubarts, in: Pietismus und Neuzeit 20, 1994, S. 124–172 (hier S. 163f., Anm. 109). Klopstock sah sich als Vertreter der „wahre[n] Orthodoxie“ (HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 97) – womit freilich zugleich gesagt ist, dass es für ihn auch eine falsche gab. Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die entsprechenden Nuancen zu klären.
45 Vgl. Auerochs [Anm. 31], S. 135.
46 Klopstock [Anm. 34], S. 236.
47 Ebd., S. 10, 32, 36 und 46.
48 HKAB, Bd. III [Anm. 9], S. 30.
49 Brief von Gottlieb Benedikt Funk an Klopstock, 18.12.1758, in: HKAB, Bd. III [Anm. 9], S. 118.
50 NA, Bd. 1, S. 145–162.
51 Rezension des „David“ in der „Allgemeinen deutschen Bibliothek“ (1773), zit.nach HKAW, Bd. V: Biblische Dramen, hg. von Monika Lemmel, Berlin/New York 2005, S. 372–373. Vgl zum „Salomo“ auch Kevin F. Hilliard: Der Skeptizismus in der deutschen Aufklärung und die literarischen Folgen, in: German Life and Letters 62, 2009, S. 1–20, hier S. 15f.
52 Klopstock [Anm. 34], S. 11 („Freygeisterey ist Hochverrat“); HKAW, Bd. VII.1:Die deutsche Gelehrtenrepublik. Text, hg. von Rose-Maria Hurlebusch, Berlin/New York 1975, S. 174f. („Gesez zur Steurung der Freygeisterey“) und S. 190–198 (Auffliegen eines ausländischen Komplotts zur Gründung einer „Kirche für die Freygeister in Deutschland“).
53 Funk [Anm. 49], S. 121.
54 Klopstock: Von der heiligen Poesie [Anm. 26], S. 1009. Vgl. Auerochs [Anm. 31],S. 204f.
55 Auerochs [Anm. 31], S. 119–260, bes. S. 205–242.
56 Steiger [Anm. 44], S. 164 und 167.
57 HKAW, Bd. IV.1,2: Der Messias. Text, hg. von Elisabeth Höpker-Herberg, Berlin/New York 1974. Fortan zitiert im Text nach Gesang und Zeile. Vgl. den „Triumphgesang“ des XX. Gesangs (HKAW, Bd. IV.3: Der Messias. Text/Apparat, hg. von Elisabeth Höpker-Herberg, Berlin/New York 1996, S. 67–87).
58 Christus übersteigt dabei den römischen Helden, ebenso wie Klopstock mit dem „Messias“ die „Aeneis“ überwindet. Vgl. Auerochs [Anm. 31], S. 210f. und 220.
59 Vgl. Kevin F. Hilliard: Freethinkers, Libertines and Schwärmer. Heterodoxy in German Literature, 1750–1800, London 2011, S. 63–66.
60 So die in der Ausgabe von 1773 dem Gesang vorangestellte Inhaltsangabe: HKAW,Bd. IV.3 [Anm. 57], S. 160.
61 Die „Deutsche Gelehrtenrepublik“ hat auf der weltlichen Ebene einen ähnlich „judizialen Charakter“ (Kommentar des Herausgebers, in HKAW, Bd. VII.2: Die deutsche Gelehrtenrepublik. Text/Apparat, hg. von Klaus Hurlebusch, Berlin/New York 2003,S. 522): Nach diversen Säuberungen (u.a. der Freigeister: siehe oben) kulminiert die Handlung in einem neuen Bund zur Eroberung eines geistigen Reichs – auch dieses in Abgrenzung zur Romania. Dass Klopstocks Patriotismus christlich-apologetische Wurzeln hat, macht Klaus Hurlebusch anhand der Hermann-Dramen deutlich: vgl. Hurlebusch: Friedrich Gottlieb Klopstock, in: Deutsche Dichter, Bd. 3: Aufklärung und Empfindsamkeit, hg. von Gunter E. Grimm und Frank Rainer Marx, Stuttgart 1988, S. 150–176, hier S. 161–163.
62 Brief an Carl Friedrich Cramer vom 11.01.1791, in: HKAB, Bd. VIII.1: Briefe 1783–1794. Text, hg. von Helmut Riege, Berlin/New York 1994, S. 215.
63 Steiger [Anm. 44], S. 146.
64 Klopstock: Von der heiligen Poesie [Anm. 26], S. 1006f.
65 Vgl. Jörn Dräger: Typologie und Emblematik in Klopstocks „Messias“, Göttingen 1971; Auerochs [Anm. 31], S. 150–182.
66 Ebd., S. 124f.
67 Vgl. Bossuet [Anm. 42], S. 457.
68 Ebd., S. 448f.
69 Auch die Begnadigung Abbadonas zählt nicht. Die „Wiederbringung aller“ (ὰποκἀστασις πἀνον) ist nicht aufklärerisches, sondern heterodox-häretisches Gedankengut (vgl. Gerhard Kaiser [Anm. 44], S. 174–184).
70 Dazu Kevin F. Hilliard: Klopstock, Friedrich Gottlieb, in: Encyclopedia of the Enlightenment, hg. von Alan Charles Kors, 4 Bde., Oxford 2003, Bd. 2, S. 333–335; Kemper [Anm. 14], S. 422–440 und 448–457.
71 Vgl. Klopstock an seinen Vater, zwischen dem 3. und 6. November 1756, in: HKAB, Bd. III [Anm. 9], S. 52.
72 Klopstock: An Freund und Feind, in: HKAW, Bd. I.1 [Anm. 1], S. 383–385.
73 HKAW, Bd. III.1 [Anm. 12], S. 29f. und 197–199. Vgl. Till [Anm. 10].
74 Immanuel Kant: „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ [1784], in: Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen, hg. von Ehrhard Bahr, Stuttgart 1981, S. 9–17, hier S. 9.