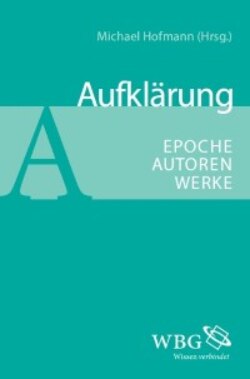Читать книгу Aufklärung - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gellert: Unaufgelöste Widersprüche
ОглавлениеWenngleich die Empfindsamkeit erst in den siebziger und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts als literarisches wie soziales Phänomen wirkungsmächtig wird, sind ihre Anfänge bereits in philosophischen und ästhetischen Diskursen ab 1740 zu bestimmen.48 Gellert gehört als Verfasser von Fabeln, Lustspielen, geistlichen Liedern, brieftheoretischen und moralphilosophischen Schriften zu den einflussreichsten Schriftstellern seiner Zeit. Indem seine Werke das paradoxe Nebeneinander widerstreitender Strömungen des aufklärerischen Diskurses abbilden, dokumentieren sie auch die Genese der Kultur der Empfindsamkeit in Deutschland. Seine poetologischen Positionen sind einerseits dem vernunftbetonten Dichtungsverständnis Gottscheds verpflichtet.49 Andererseits spiegelt sich in seinem Werk noch einmal jener im 17. Jahrhundert in Frankreich ausgebildete und bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts nachwirkende Ansatz, demzufolge die Wissenschaften und Künste, die Erkenntnis und die Schönheit, komplementäre Paradigmen sind. Sein Werk hat damit Anteil an jenem Diskurs, welcher mit der frühen Aufklärung anhob, die verschiedenartigen Manifestationen des menschlichen Geistes und die diesen immanenten Möglichkeiten nicht nur zu entfalten, sondern auf das Ziel einer neuen Anthropologie auszurichten. Während jedoch das rationalistische Weltbild im Verlauf der philosophischen Debatten des 18. Jahrhunderts zu jenem Materialismus radikalisiert wurde, der die Materie als alleinige Substanz aller Wirklichkeit betrachtete, unternimmt Gellert – beeinflusst von den Schriften des englischen Sensualismus – den Versuch, Verstand und Gefühl als interdependente Manifestationen menschlicher Weltaneignung im Sinne eines ganzheitlichen Systementwurfes zu begreifen. Auf diese Weise zeigt sein Denken die Empfindsamkeit als eine der Tendenzen des Projektes der Aufklärung.
Mit den Versuchen, den emphatisch-gefühlvollen und zugleich bereits ironisch gebrochenen Ton der Dichtungen Laurence Sternes in Deutschland nachzuahmen, mit Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und Millers „Siegwart. Eine Klostergeschichte“, die „literarische Höhepunkte“ der empfindsamen Strömung markieren, gewinnt die Literatur jene ästhetische Autonomie, die das Verständnis des literarischen Kunstwerkes bis in die Gegenwart bestimmt.50 Demgegenüber verbindet Gellert die normative, von den Grundsätzen der Vernunft, der Moral und des durch die Tradition herausgebildeten Geschmacks bestimmte Regelpoetik mit sensualistischen Positionen. Zwischen der rhetorischen Auffassung von Poesie, der Gefühlskultur der Empfindsamkeit und dem emphatischen Subjektivismus des Sturm und Drang beruht das Problematische und damit literarhistorisch Relevante seiner Dichtungen und Schriften darauf, diese Spannungen nicht auflösen zu können.
1 Gotthold Ephraim Lessing: Gesammelte Werke [in zehn Bänden], hg. von Paul Rilla, Berlin 1954ff., Bd. 9: Briefe, Berlin 1957, S. 282.
2 Vgl. hierzu Gerhard Sauder: Empfindsamkeit. Bd. 1: Voraussetzungen und Elemente, Stuttgart 1974, S. 4–7.
3 Christoph Martin Wieland: Empfindungen eines Christen: Lobe den Herrn du meine Seele, Zürich 1757.
4 Christian Fürchtegott Gellert: Briefwechsel, hg. von John F. Reynolds, 5 Bde., Berlin/New York 1983ff., Bd. 2, Berlin 1987, S. 109.
5 Johann Jacob Breitinger: Critische Dichtkunst. Worinnen die Poetische Mahlerey in Absicht auf die Erfindung im Grunde untersuchet und mit Beyspielen aus den berühmtesten Alten und Neuern erläutert wird, 2 Bde., Zürich 1740, Bd. 1, S. 128f.
6 Gellert [Anm. 4], Bd. 1, Berlin 1983, S. 272.
7 Ebd.
8 Goethes Werke [Weimarer Ausgabe], hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, Abt. I-IV, 133 Bde. in 143 Tln., Weimar 1887–1919, Abt. I, Bd. 27, Weimar 1889, S. 296.
9 Vgl. Wilhelm Große: Studien zu Klopstocks Poetik, München 1977, S. 24–62.
10 Jochen Schmidt: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur,Philosophie und Politik 1750–1945, Heidelberg 2004, Bd. 1, S. 9 (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte 210).
11 Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst, durchgehends mit den Exempeln unserer besten Dichter erläutert, Leipzig 1751, S. 109f.
12 Christian Garve: Vermischte Anmerkungen über Gellerts Moral, dessen Schriften überhaupt, und Charakter, in: Der Philosoph für die Welt, hg. von Johann Jakob Engel,Leipzig 1775, Erster Theil, S. 198–252, hier S. 199f.
13 Vgl. ebd., S. 209.
14 Ebd., S. 199. Vgl. Friedrich Koch: Christian Fürchtegott Gellert. Poet und Pädagoge der Aufklärung, Weinheim 1992, S. 144f.
15 Christian Fürchtegott Gellert: Gesammelte Schriften. Kritische, kommentierte Ausgabe, hg. von Bernd Witte, 7 Bde., Berlin/New York 1988–2008 [fortan zitiert unter der Sigle ‚GS‘+Band- und Seitenzahl], Bd. 6: Moralische Vorlesungen, moralische Charaktere, Berlin 1992, S. 7.
16 Garve [Anm. 12], S. 225. Vgl. Jan Engbers: Der „Moral-Sense“ bei Gellert, Lessing und Wieland. Zur Rezeption von Shaftesbury und Hutcheson in Deutschland, Heidelberg 2001, S. 59–63 (Germanisch-romanische Monatsschrift, Beiheft 16).
17 Vgl. Sikander Singh: Das Glück ist eine Allegorie. Christian Fürchtegott Gellert und die europäische Aufklärung, München 2012, S. 17–21.
18 GS, Bd. 6 [Anm. 15], S. 13.
19 GS, Bd. 4: Roman, Briefsteller, Berlin 1989, S. 107.
20 Ebd., S. 111. Vgl. Wilhelm Vosskamp: Dialogische Vergegenwärtigung beim Schreiben und Lesen. Zur Poetik des Briefromans im 18. Jahrhundert, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45, 1971, S. 80–116, hier S. 82.
21 Vgl. Uwe Hentschel: „Besuche in Briefen“. Die epistolare Praxis der Anakreontiker und Gellerts Briefreform, in: Orbis litterarum 56, 2001, S. 378–395.
22 GS, Bd. 4 [Anm. 19], S. 155.
23 Ebd., S. 111.
24 Ebd., S. 155.
25 Ebd., S. 158.
26 Ebd.
27 Ebd., S. 159.
28 Ebd.
29 Ebd., S. 160.
30 Ebd., S. 161.
31 Vgl. die „Moralischen Vorlesungen“, GS, Bd. 6 [Anm. 15], S. 223.
32 GS, Bd. 4 [Anm. 19], S. 161f.
33 William Wordsworth: The Prose Works, hg. von W. J. B. Owen und Jane Worthington Smyser, 3 Bde., Oxford 1974, Bd. 1, S. 148.
34 GS, Bd. 4 [Anm. 19], S. 199f.
35 „Die empfindsame Gemeinschaft stiftet sich wesentlich als eine textuelle, in der Lektüre und durch sie, und zehrt doch zugleich von der Vorstellung eines absolut transparenten, nicht-medialen Selbst im kommunikativen Austausch.“ (Susanne Komfort-Hein: Die Medialität der Empfindsamkeit. Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ und Lenz’ „Der Waldbruder. Ein Pendant zu Werthers Leiden“, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 2002, S. 31–53, hier S. 36.)
36 Wolfgang Bunzel: Gellerts Roman „Das Leben der schwedischen Gräfinn von G***“: Erzählstruktur und Wirkungsabsicht, in: Wirkendes Wort 45, 1995, S. 377–395.
37 Vgl. Gottfried Honnefelder: Der Brief im Roman. Untersuchungen zur erzähltechnischen Verwendung des Briefes im deutschen Roman, Bonn 1975, S. 68–73 (Bonner Arbeiten zur deutschen Literatur 28).
38 Bunzel [Anm. 36], S. 390.
39 Vgl. Bernd Witte: Christian Fürchtegott Gellert: „Leben der Schwedischen Gräfinn von G***“. Die Frau, die Schrift, der Tod, in: Romane des 17. und 18. Jahrhunderts. Interpretationen, Stuttgart 1996, S. 112–149, hier S. 119.
40 Vgl. Eckhardt Meyer-Krentler: Der andere Roman. Gellerts „Schwedische Gräfin“:Von der aufklärerischen Propaganda gegen den „Roman“ zur empfindsamen Erlebnisdichtung, Göppingen 1974, S. 143–145 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 128).
41 Ebd., S. 139f.
42 GS, Bd. 4 [Anm. 19], S. 74.
43 Goethes Werke [Anm. 8], 1. Abt., Bd. 19, Weimar 1899, S. 36. Vgl. Richard Alewyn: „Klopstock!“, in: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte 73, 1979,S. 357–364; Arnd Bohm: „Klopstock!“ Once More: Intertextuality in Werther, in: Seminar: A Journal of Germanic Studies 38, 2002, S. 116–133.
44 Vgl. Heinz Renkewitz: Die Losungen. Entstehung und Geschichte eines Andachtsbuches, Hamburg 1967.
45 GS, Bd. 4 [Anm. 19], S. 16.
46 Ebd., S. 24.
47 Robert H. Spaethling: Die Schranken der Vernunft in Gellerts „Leben der schwedischen Gräfin von G.“: Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Aufklärung, in: Publications of the Modern Language Association of America 81, 1966, S. 224–235, hier S. 232.
48 Vgl. Theorie der Empfindsamkeit, hg. von Gerhard Sauder, Stuttgart 2003, S. 18.
49 Vgl. Werner Jung: „Die besten Regeln sind die wenigsten“. Gellerts Poetik, in: „Ein Lehrer der ganzen Nation“. Leben und Werk Christian Fürchtegott Gellerts, hg. von Bernd Witte, München 1990, S. 116–124.
50 Sauder [Anm. 2], S. 234.