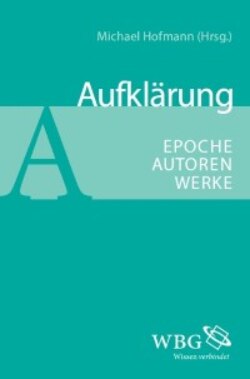Читать книгу Aufklärung - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Roman: Empfindsame Wirkungsästhetik
ОглавлениеIn dem Roman „Leben der Schwedischen Gräfinn von G***“, den Gellert in den Jahren 1747 und 1748 veröffentlicht, ist die Funktion des Briefes für den empfindsamen Diskurs ebenfalls zu beobachten. In die Erzählung integrierte Briefe ermöglichen dem Leser die nachempfindende Teilhabe an einem anderen Leben und erschließen in feiner Nuancierung die noch intimsten Gedanken, Regungen und Gefühlsstimmungen. Indem aber die Briefe, von Einschüben, Erläuterungen und Reflexionen eines Erzählers in einen Zusammenhang gestellt und kommentiert, stets Dokument eines anderen Lebens bleiben, beinhalten sie auch die Möglichkeit des Rückzugs aus der dargestellten Situation. Diese Dialektik von emotionaler Antizipation und reflexiver Distanzierung ist ein wesentliches Element der „Schwedischen Gräfinn“ und zugleich Teil der ihr eingeschriebenen Wirkungsabsicht, deren erzähltheoretische Konzeption Wolfgang Bunzel untersucht hat.36
Die durch die Äußerungsform des Briefes fingierte Nähe zwischen Leser und Figur wird in dem Roman durch das alles Geschehen retrospektiv darbietende und damit auch kommentierend ordnende Eingreifen der Ich-Erzählerin unterlaufen. Die eingestreuten Briefe erfüllen zwar die Funktion, durch den Perspektivenwechsel die Mehrdimensionalität des Geschehens aufzuzeigen. Der seit der Neuzeit ausgebildeten und im 18. Jahrhundert ausdifferenzierten Funktion der Textsorte, durch das intime Bekenntnis Inneneinsichten in die subjektive Befindlichkeit des Schreibenden im Moment des Schreibens zu gewähren und diese in der geschlossenen epischen Kleinform, als Miniaturen der Charakterzeichnung, der empathischen Lektüre eines Lesers zu überantworten, steht jedoch die relativierende Retrospektive der Erzählhaltung entgegen.
Gleichwohl bezeugt Gellert indirekt, einerseits durch die Individualität der Figuren und andererseits durch ihre Briefe und Berichte, die Authentizität des Geschehens.37 Zudem zeigt sich in der Unmittelbarkeit des Romananfangs – der durch die Ich-Form die Vermutung nahe legt, die Erzählerin sei mit der schwedischen Gräfin von G*** identisch und eine Person des wirklichen Lebens – der für den Roman in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts charakteristische Versuch, durch den Verweis auf den Realitätscharakter sich möglichst deutlich von der Tradition des barocken Romans abzugrenzen und auf diese Weise dem immer noch verbreiteten Vorwurf der Romanhaftigkeit zu begegnen.
Der Roman ist damit von einer grundlegenden Ambivalenz geprägt: Der stete Perspektivenwechsel, der durch die Zusammenstellung von Passagen entsteht, die in der ersten Person erzählt werden und solchen, die sich aus den eingeschobenen Briefen erschließen, bedingt, dass der Leser zwischen anteilnehmender Rührung und distanzierter Reflexion im Sinne des aufklärerischen Versuchs, Verstand und Gefühl in Übereinstimmung zu bringen, alterniert. Wolfgang Bunzel spricht in diesem Kontext davon, dass „nebeneinander zwei Erzählebenen existieren“.38 Die Charakterzeichnung der handelnden Figuren korrespondiert mit der von der Ästhetik der Zeit aufgestellten Forderung nach Natürlichkeit und Wahrheit und ermöglicht daher die Identifikation des Lesers mit ihnen. Er wird durch das individuelle Schicksal und das aus einer subjektiven Innensicht geschilderte Empfinden gerührt, so dass das eigene Fühlen zum Fühlen der Figuren werden kann und umgekehrt.
Diese Dialektik, die den Prozess der Lektüre bestimmt und das Geschehen des Romans sowie das innere Geschehen des Lesers miteinander verschränkt, verweist auf ein didaktisches Moment, das dem Werk in besonderer Weise eigen ist.39 Gellert erzählt nicht die Bildungsgeschichte der Gräfin von G***, die keine Entwicklung durchlebt, weil die von ihr vertretenen Tugendideale sich lediglich in je unterschiedlichen Lebenssituationen bewähren, sondern er erzählt die Bildungsgeschichte seiner Leser, die durch die Lektüre zu einer Betrachtung über die Grundlage und Möglichkeit eines moralischen und tugendhaften Lebens angeregt werden.
Während der empfindsame Roman die Fiktionen, welche die Authentizität der Handlung bezeugen, textimmanent nicht hinterfragt und so das Moment der Identifikation mit den handelnden Figuren in den Prozessen der Distanzierung und der teilnehmenden Lektüre dem Leser überantwortet, zeigt sich in der „Schwedischen Gräfinn“ ein für die Aufklärung charakteristischer Zug zum Pädagogischen. Der Roman zeichnet sich durch subtile Mechanismen der Leserlenkung aus, welche die anempfindende Teilnahme nicht dem Vorgang der Lektüre überlassen, sondern bereits im Modus des Erzählens präfigurieren. Das Werk ist insofern ein Vorläufer der empfindsamen deutschen Romanliteratur, als es den Leser zu einer im Sinne der kantischen Definition empfindsamen Lektüre erzieht.
Als Bildungsroman seiner Leser ist das Werk jedoch keineswegs voraussetzungslos. In der Anlage der Wechselbeziehung zwischen der Erzählerin und den Lesern und ihrer Wirkung einerseits sowie zwischen Verstand und Gefühl andererseits bezieht sich Gellert auf pietistische Sprach- und Denkformen, deren Anverwandlung nicht nur ein wesentliches Moment der im Roman vertretenen moralischen Anschauungen ist, sondern auch die Schreibart beeinflusst hat.40 Indem die zur Darstellung kommenden affektiven Auf- und Abschwünge im Leser einen korrespondierenden Reflex evozieren, verweisen sie auf die Wiederholbarkeit der Empfindungen. Diese sind in stets gleicher Weise replizierbar, weil sie aus einer gefühlsbestimmten Religiosität erwachsen, deren Verbindlichkeit weder von der Erzählerin noch von den handelnden Figuren in Frage gestellt wird. Die sprachlichen Wendungen, Begriffe und Bilder, die der religiösen Praxis des Pietismus entlehnt sind und die im zweiten Teil des Romans häufiger verwandt werden als im ersten, dienen nicht der Charakterisierung und Beschreibung eines Affektes der handelnden Figuren, sondern rufen diese Empfindung im Leser hervor.41 Das ebenso überraschende wie freudige Wiedersehen zwischen dem Grafen von G*** und seinem Freund Steeley, der, aus der russischen Gefangenschaft entlassen, seinen Leidensgefährten in Holland aufsucht, enthüllt diesen Mechanismus exemplarisch. Die Gräfin berichtet über die Szene:
O was ist das Vergnügen der Freundschaft für eine Wollust, und wie wallen empfindliche Herzen einander in so glücklichen Augenblicken entgegen! Man sieht einander schweigend an, und die Seele ist doch nie beredter, als bey einem solchen Stillschweigen. Sie sagt in einem Blicke, in einem Kusse ganze Reihen von Empfindungen und Gedanken auf einmal, ohne sie zu verwirren.42
Die Anrede, welche die erinnerten Gefühle des glücklichen Augenblicks dem Leser unmittelbar überantwortet, verzichtet auf die Wiedergabe von Gefühlsnuancen ebenso wie auf die detaillierte Darstellung der beteiligten Personen und beschränkt sich darauf, in diesem die in der Situation durchlebten Gefühle hervorzurufen. Selbst Goethes „Werther“ verwendet an zentraler Stelle diesen Modus des Erzählens: In der Gewitterszene, die in der Evokation Klopstocks kulminiert, berichtet Werther von dem in ihm aufsteigenden Fühlen.43
Indem Goethe den Vorgang der erinnerten Empfindung mit dem Wort Losung bezeichnet, verweist er auf die religiöse Herkunft des Begriffs. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf gab im Mai 1728 der versammelten Gemeinde von Herrnhut während der abendlichen Gesangsstunde eine Strophe aus dem Gesangbuch in der Absicht als Parole für den kommenden Tag mit, Gespräche und Meditationen über das Wort Gottes anzuregen.44 Die Übernahme dieser Tradition eröffnet der Literatur einen Assoziationsraum, der trotz seiner säkularisierenden Tendenz einen Unterton religiöser Bedeutung bewahrt. Damit erwecken Begriffe wie Herz, Empfindung, Rührung, Gelassenheit, Vorsehung im Leser ein vielschichtiges Geflecht emotionaler Nuancen, die durch ihren Ursprung in den Diskursen religiöser Innerlichkeit keine individuellen Gefühle bezeichnen, sondern auf ein allen empfindenden Seelen Gemeinsames verweisen.
Zugleich spiegelt sich in dieser Vorläufigkeit und Zerbrechlichkeit der Empfindungen eine Skepsis gegenüber den Möglichkeiten, der Tiefe des Fühlens einen ihm angemessenen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Nach der Lektüre des Briefes, den der Graf von G*** auf dem Krankenlager während des Feldzuges von seiner Gemahlin Abschied nehmend geschrieben hat, wendet sich die Erzählerin mit dem Bekenntnis an den Leser: „Meinen Schmerz über diese Nachricht kann ich nicht beschreiben. Die Sprachen sind nie ärmer, als wenn man die gewaltsamen Leidenschaften der Liebe und des Schmerzes ausdrücken will.“45 Und über den Versuch, die Gefühle Marianes für Carlson in Worte zu fassen, schreibt sie: „Ich suche die Worte vergebens, mit denen ich ihre Zärtlichkeit gegen ihren Mann beschreiben will.“46 In den selbstreflexiven Gedanken der Erzählerin über ihr Erzählen wird nicht nur der rhetorische Unsagbarkeitstopos variiert, zugleich scheint hier die Vorstellung auf, dass ein Gefühl in seiner Totalität nur im Mitgefühl zu erfassen sei. Die Versenkung in das Erleben des anderen ermöglicht die Übersetzung seines Fühlens in den eigenen Innenraum, bedingt und relativiert zugleich dessen Subjektivität.
Während jedoch die Figuren in ihrem Handeln die Gültigkeit des christlichen Weltbildes und die ihm immanente Vorstellung ihrer Vernunftgemäßheit explizieren, während die Erzählerin die Unmittelbarkeit des Mitfühlens durch die Erzählhaltung unterläuft und damit eine Dialektik von Antizipation und Reflexion akzentuiert, entwickelt der Roman eine von seinem moralischen und pädagogischen Anspruch unabhängige, diesem zuwiderlaufende Dynamik. Weil die wachgerufenen Empfindungen in dem Wechselspiel, das durch die Balance des Geschehens zwischen Realität und Fiktion entsteht, beständig hinterfragt werden, gewinnt der Leser eine Autonomie, die jenseits des moralischen Horizontes des Werkes liegt. Da die Erzählerin die ausgelösten Empfindungen durch Reflexion ihrer Unmittelbarkeit entkleidet, vermag der Leser zu einem autonomen Subjekt zu werden, das vor dem Hintergrund der nachempfundenen Gefühle zu einem Bewusstsein seiner Selbst findet.
In dieser im Verlauf der Lektüre herangebildeten Urteilskraft und ausdifferenzierten Gabe der Empfindung scheint bereits jene Freiheit des Denkens und Fühlens auf, die, im philosophischen Diskurs des 18. Jahrhunderts in die letzte Konsequenz durchdacht und radikalisiert, auch den Glauben an die Möglichkeit positiver Bedeutungen hinterfragen lässt und den Menschen – der optimistischen Illusion der unbegrenzten Perfektibilität einer guten, in der Vernunft Gottes ruhenden Welt beraubt – den Aporien seiner Subjektivität überantwortet.47