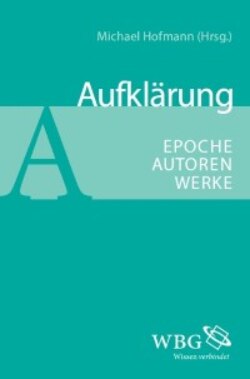Читать книгу Aufklärung - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Morallehre: Vernünftige Gefühle
ОглавлениеGellert überführt den rationalistischen Diskurs, der im frühen 18. Jahrhundert entwickelt worden ist, in eine praktische, lebensnahe Morallehre mit religiösen Momenten. In diesem Sinne definiert Christian Garve das philosophische Hauptwerk des Leipzigers, die „Moralischen Vorlesungen“, als ein System, eine „Reihe von Wahrheiten“ beinhaltend, die „zusammenhängen, und davon die vorhergehenden zum Verstande oder zum Beweise der folgenden angewandt werden“.12 Der Popularphilosoph legt den Akzent seiner Betrachtung auf den argumentativen, dem deduktiven System rationalistischer Syllogismen verpflichteten Aufbau der Moralvorlesungen. Zugleich betont Garve den „Endzweck“, dem Gellerts Entwurf dient: die Befreiung von Vorurteilen sowie unrichtigen Anschauungen, welche die geistige und moralische Vervollkommnung des Menschen behindern und der Entwicklung einer auf den Grundsätzen der christlichen Lehre basierenden Gesellschaftsordnung im Wege stehen.13
Aufklärung ist für den Leipziger also ein politisch-sozialer Entwurf, der durch verbindliche Formen des sozialen Verhaltens ideale Zustände auf Erden schaffen will. Indem er die „Religion zum Grunde der Moral“ setzt, die „einzelnen Tugenden sorgfältig erklärt; ihre Bewegungsgründe auf die eindringendste Art“ darstellt und die „Mittel zu ihrer leichtern Ausübung aus der Erfahrung“ schöpft, zeigt sich zudem ein pädagogisches Moment, das seinem Denken eigen ist und das nicht nur die philosophischen Schriften kennzeichnet, sondern auch in den frühen literarischen Werken aufscheint.14
Neben diesen, die philosophischen Morallehren des Frührationalismus fortsetzenden Vorstellungen betont Gellert jedoch die paradigmatische Bedeutung der Empfindung für den Prozess der sittlichen und damit innerweltlichen Vervollkommnung des Menschen. Schon in der den „Moralischen Vorlesungen“ vorangestellten „Vorerinnerung an seine Zuhörer“ erklärt er sein Bestreben, „die vornehmsten Theile der Sittenlehre auf eine lebhaftere Art, nicht bloß durch Beweise der Vernunft, sondern zugleich durch die Aussprüche des Herzens und die Stimmen der innerlichen Empfindung und des Gewissens, durch Beyspiele und Gemälde“ zu erläutern.15 Dass Reflexion und Emotion wechselweise aufeinander bezogen sind, ist deshalb für Garve der wesentliche Neuansatz, den Gellert mit seinen Vorlesungen über die Moral aus der englischen und schottischen Moralphilosophie übernommen und in den deutschen Diskurs überführt hat.16 Das philosophische System des Leipziger Aufklärers erweist sich somit als Werk einer Phase des Rationalismus, die in dem Versuch, die Zusammenhänge der Welt verstehbar zu machen, in jenen Grenzbereich seiner Möglichkeiten gelangt ist, den die Zeitgenossen nur durch einen Perspektivenwechsel von der sinnlichen Erfahrbarkeit zu der erfahrbaren Sinnlichkeit der Erscheinungen überschreiten zu können glaubten.17
Grundlage der in der Folge a priori gesetzten Annahme dieser bereits empfindsamen Anschauung ist die eines dem Menschen innewohnenden, natürlichen sittlichen Empfindens, das jedoch im individuellen Entwicklungsprozess durch die Bildung der regulierenden Verstandeskräfte erst zur Entfaltung gebracht zu werden bedarf. Im Spannungsverhältnis dieses Synthesegedankens von Vernunft und Gefühl, Sinn und Sinnlichkeit ist auch die begriffliche Definition der Moral zu verstehen, die Gellert an den Anfang der ersten „Moralischen Vorlesung“ stellt:
Die Moral, oder die Kenntniß von der Pflicht des Menschen, soll unsern Verstand zur Weisheit und unser Herz zur Tugend bilden, und durch beides uns zum Glücke leiten. Niemand wird ein Glück suchen, das er nicht kennet, noch die Mittel dazu anwenden können, wenn er sie eben so wenig kennet, oder nicht überzeugt ist, daß sie die besten und einzigen sind. Die Moral soll uns also lehren, was unser wahres Glück, oder unser höchstes Gut sey, das ist, was für ein Geschöpf, das aus einem unsterblichen Geiste und aus einem hinfälligen Körper besteht, am zuträglichsten, der Ruhe der Seelen und der äußerlichen Wohlfahrt am gemäßesten sey, und auf was für einem Wege wir am sichersten zu diesem Ziele gelangen können.18
Indem Vernunftbetontheit und sittliches Verhalten sowohl Ziel als auch Voraussetzung des individuellen Glücks und, darauf beruhend, einer ideal geordneten Gesellschaft sind, scheint jener Widerspruch mit sich selbst auf, der charakteristisch ist für den optimistischen Glauben des aufgeklärten Zeitalters an die Möglichkeit einer diesseitigen Glückseligkeit. Gellerts Utopie ist die paradoxe Gewissheit immanent, dass die beste aller Welten nur von Menschen geschaffen werden kann, die Produkte der Bedingungen sind, welche sie selbst erst hervorzubringen versprechen.