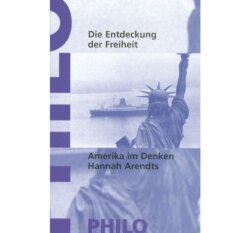Читать книгу Die Entdeckung der Freiheit - Группа авторов - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеLothar Probst/Winfried Thaa
Zwischen berechtigter Hoffnung und wohlbegründeter Furcht: Politische Freiheit in Amerika
Das seit den Freiheitsrevolutionen in Osteuropa wieder entfachte Interesse an der deutsch-jüdischen politischen Denkerin Hannah Arendt hat in den letzten Jahren zu einer beeindruckenden Zahl neuer Veröffentlichungen geführt, die sich mit unterschiedlichen Aspekten ihres Beitrags zu einer „Theorie“ des Politischen beschäftigen. Indem der hier vorgelegte Sammelband in bezug auf und in kritischer Auseinandersetzung mit Hannah Arendt grundsätzliche Fragen einer „zeitgemäßen“ Theorie des Politischen aufgreift, bewegt er sich einerseits in dieser neueren Tradition; er richtet andererseits aber zum ersten Mal den Fokus dieser Auseinandersetzung auf Hannah Arendts „Entdeckung der Freiheit“ in Amerika. Unsere bewußte Entscheidung als Herausgeber, diese Fokussierung auch zum Titel dieser Publikation zu machen, könnte angesichts der von vielen als neoimperial empfundenen Züge der amerikanischen Politik seit dem 11. September 2001 mißverstanden werden. Mit den Augen Hannah Arendts betrachtet ist diese Entscheidung aber keineswegs so paradox, wie es auf den ersten Blick erscheint. Ihre scharfe und pointierte Kritik an der Politik amerikanischer Administrationen hat sie nicht davon abgehalten, die Ursprünge der amerikanischen Republik gegen ihre Entstellungen und Pervertierungen zu verteidigen und an diese Ursprünge immer wieder aufs neue zu erinnern. So schrieb sie 1970 in ihrem Buch Macht und Gewalt: „Die Zeiten, da Amerika sich in voller Klarheit von den politischen Kategorien des europäischen Nationalstaats trennte, sind lange vorbei. Die amerikanische Regierung handelt und argumentiert nicht im Sinne der Amerikanischen Revolution und der ‚Founding Fathers‘, sondern ganz im Sinne des europäischen nationalstaatlichen Denkens, als sei dies schließlich und endlich doch das ihr angestammte Erbe.“1
Tatsächlich war es gerade die Konstruktion einer föderalen Republik – jenseits des europäischen Modells souveräner Nationalstaaten –, die Hannah Arendt an Amerika so schätzte. Bereits 1946 schrieb sie enthusiastisch an Karl Jaspers: „Die Republik ist kein leerer Wahn, und die Tatsache, daß es hier keinen Nationalstaat gibt und keine eigentlich nationale Tradition […], schafft eine freiheitliche oder wenigstens unfanatische Atmosphäre.“2 Auch später kam sie immer wieder auf diesen Punkt zurück, so als sie 1973 in einem Fernsehgespräch mit Robert Errera bemerkte: „Amerika ist kein Nationalstaat, und Europäern fällt es verdammt schwer, diese einfache Tatsache zu begreifen.“3 Die Begeisterung über die Andersartigkeit Amerikas im Vergleich zu Europa schärfte Arendts Blick für die Fundamente der amerikanischen Demokratie. In dem 1975 verfaßten Essay „200 Jahre Amerikanische Revolution“, in dem sie einerseits schonungslos mit der amerikanischen Politik unter Richard Nixon ins Gericht geht, stellt sie andererseits fest: „Die vor zweihundert Jahren gegründeten amerikanischen Institutionen der Freiheit haben länger Bestand gehabt, als irgendeine vergleichbare ruhmreiche Periode der Geschichte. Diese Glanzlichter der Menschheitsgeschichte sind mit Recht Paradigmen unserer Tradition politischen Denkens geworden; doch wir sollten nicht vergessen, daß sie, chronologisch betrachtet, immer nur Ausnahmen waren. Als Glanzlichter leben sie fort, um das Handeln und Denken der Menschen in finsteren Zeiten zu erleuchten.“4
Hoffnung und Skepsis in bezug auf die Zukunft der amerikanischen Gesellschaft und Politik – das sind zwei Konstanten in Arendts durchaus ambivalenter Beziehung zu Amerika. So hat sie aus ihrer kulturkritischen Haltung gegenüber den fragwürdigen Erscheinungen der amerikanischen Konsumgesellschaft und jobholder society nie einen Hehl gemacht. Die in Europa weit verbreiteten Ängste vor einer „Amerikanisierung“ deutet sie als berechtigte Furcht vor den zerstörerischen Potentialen der Moderne. Während das Amerikabild des neunzehnten Jahrhunderts durch Demokratie bestimmt gewesen sei, würde Amerika heute mit der Moderne und deren zentralen Problemen, der politischen Organisation der Massengesellschaft und der politischen Kontrolle technischer Macht, gleichgesetzt. Da diese Probleme jedoch eine Konsequenz der eigenen, europäischen Geschichte seien, ist ihnen nach Arendt durch Abgrenzung gegenüber Amerika nicht zu entkommen.5 Arendt setzt vielmehr, trotz der pessimistisch stimmenden Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens in Amerika, auf die untergründig weiterwirkenden republikanischen Traditionen des Landes, die es Europa voraus habe. In ihrem 1963 im englischen Original erschienenen Buch On Revolution, in dem sie ihre Erkenntnisse über den besonderen Charakter der amerikanischen Revolution niederlegt, schreibt sie:
„Die revolutionären Vorstellungen von öffentlichem Glück und politischer Freiheit sind ein unabdingbarer Teil der Struktur des republikanischen Gemeinwesens geworden und geblieben, und als solche sind sie aus dem Bewußtsein amerikanischer Politik niemals ganz verschwunden. Ob aber diese politische Struktur wirklich so fest gegründet und untermauert ist, daß sie dem sinnlosen Treiben einer Konsumgesellschaft standzuhalten vermag, kann nur die Zukunft lehren. […] Was wir heute sehen, ist widersprüchlich; es gibt genug Anzeichen, die zu Hoffnung berechtigen, aber es gibt nicht weniger zu wohlbegründeter Furcht.“6
Im weiteren Sinn gehörten zu letzteren für Arendt auch der Einsatz von Gewalt und die Zerstörung elementarer rechtsstaatlicher Normen im Zuge einer imperialen Politik. Das also keinesfalls unkritische, aber von einer Begeisterung über die republikanischen Ursprünge der amerikanischen politischen Tradition geleitete Verhältnis Hannah Arendts zu Amerika erschließt sich erst, wenn man ihre Schritte der Annäherung an das neue Fremde nachvollzieht. Durch und durch europäisch, ja deutsch geprägt, war diese Annäherung – wie die Erfahrungen anderer Emigranten, die durch die nationalsozialistische Verfolgung ins amerikanische Exil getrieben wurden, zeigen – durchaus nicht selbstverständlich. „Von allen Emigranten in den USA“, so Ernst Vollrath, „ist sie die einzige, die sich dem Typus des anglo-amerikanischen Denkens, das sich vom Typus des traditionellen politischen Denkens in Deutschland fundamental unterscheidet, in positiver Weise genähert hat.“7 Diese Annäherung verläuft jedoch nicht einseitig, sondern Hannah Arendt fügt dem anglo-amerikanischen Kultur- und Politikverständnis „jene Momente hinzu, die aus dem deutschen Geistesleben stammen.“8 Daß Hannah Arendt – im Gegensatz zu anderen deutschen Emigranten – sich auf das anglo-amerikanische Denken und die darin verwurzelten politischen Traditionen einlassen konnte, hatte auch mit ihren eigenen Erfahrungen in der Politik zu tun, Erfahrungen, die sie erst im Pariser Exil während ihrer Arbeit für zionistische Organisationen machte (siehe hierzu auch den Beitrag von Wolfgang Heuer in diesem Band). Die Berührung mit der Politik legte bei ihr – trotz der Prägungen durch die Weimarer Existentialphilosophie – das Fundament dafür, Prinzipien und Kategorien des Politischen nicht aus Metaphysik oder Moral herzuleiten, sondern aus den Erfahrungen, die in der Politik selber gemacht werden. Einer solchen Beziehung zum Politischen kam das pragmatische anglo-amerikanische Denken natürlich entgegen. Aber es mußten noch andere Dinge hinzutreten, um sich auf die neue Umgebung einlassen zu können – Neugier auf Land und Leute sowie die Bereitschaft, die Sprache richtig zu erlernen und auch außerhalb der Emigrantenkreise die Begegnung mit Amerikanern zu suchen. Kaum in Amerika angekommen, ergriffen Hannah Arendt und Heinrich Blücher in dieser Beziehung die Initiative. Sie verbrachte schon kurz nach ihrer Ankunft in New York fast einen Monat bei einer amerikanischen Gastfamilie, während Heinrich Blücher in New York Sprachunterricht nahm. In einem Brief an Arendt schreibt er in diesem Zusammenhang: „Mit dem Englischen geht’s gar nicht schlecht. Die Lehrerin ist unverändert herrlich, und ich mache wirkliche Fortschritte. Sprache und Land interessieren mich täglich mehr, und ich hoffe, bald ein brauchbares und nicht allzu oberflächliches Urteil zu haben.“9 Der Geist der Neugier, der Erkundung und der Entdeckung, der aus diesen Zeilen spricht, scheint beide von Anfang an in Amerika beseelt zu haben. Dadurch waren sie fähig, nach ihrer Ankunft die Bekanntschaft mit dem Neuen nicht als Transit, als lästiges Durchgangsstadium zu begreifen, um dann unverfälscht zu den alten Wurzeln zurückzukehren, sondern als Herausforderung und als Chance – als Chance einer neuen politischen und intellektuellen Begegnung und Erfahrung. Nur so war es möglich, daß sowohl Arendt als auch Blücher in Amerika Wurzeln schlagen und heimisch werden konnten. Dolf Sternberger charakterisierte Hannah Arendts Beziehung zu Amerika in diesem Zusammenhang treffend, als er schrieb: „Sie ist […] trotz allen erregenden öffentlichen Erfahrungen ihrer eigenen Zeit in New York und in den USA überhaupt im Grunde eine überzeugte ‚politische‘ Amerikanerin, ein ‚citizen‘ von ganzem Herzen geworden. (Es ist unnötig hinzuzufügen, wie sehr sie gleichwohl eine deutsche Denkerin und Schriftstellerin geblieben ist, wir wissen es so gut, wie sie selbst es wußte und bekannte.)“10
Gerade weil Hannah Arendt sich nicht wie eine Außenstehende zu ihrer neuen politischen Heimat verhielt, sondern sich mehr und mehr als Mitglied der amerikanischen politischen Gemeinschaft verstand, war sie in der Lage, sich in einer kreativen Weise mit der amerikanischen politischen Tradition zu befassen. Dabei zielte ihre Beschäftigung mit der amerikanischen Revolution nicht auf eine im üblichen historischen Verständnis wirklichkeitsgetreue Rekonstruktion des Verlaufs der Revolution, sondern darauf, jene Motive und Prinzipien aufzudecken und in Erinnerung zu rufen, die die Gründungsväter der amerikanischen Republik angetrieben hatten. Tatsächlich eignete sich das amerikanische Beispiel wie kein anderes in der Geschichte der Neuzeit, Arendts Theorie der Republik und deren „Gründung im spontanen Akt des gemeinsamen Handelns“11 weiterzuentwickeln. In einer Würdigung dieser Leistung Hannah Arendts bemerkte Dolf Sternberger: „Auch hat sie […] ein Ereignis der neueren Geschichte entdeckt, untersucht und nachgezeichnet, worin die originäre Idee der Politik wiederzukehren schien: die amerikanische Revolution, die revolutionäre Staatsgründung, die Stiftung der Unionsverfassung oder – mit einem Wort, das ihr so teuer wurde, wie es den ‚gründenden Vätern‘ teuer war: die Entstehung der ‚Republik‘.“12
Es gibt also gute Gründe, die „Entdeckung der Freiheit“ in Amerika als ein zentrales Element von Hannah Arendts politischem Denken zu begreifen. Hiervon ausgehend lassen sich Schlüsselbegriffe ihrer „Theorie“ des Politischen erschließen. Andererseits interessieren die theoretischen Voraussetzungen und Grundlagen, die Arendt gewissermaßen im „geistigen“ Gepäck mit nach Amerika brachte und die es ihr ermöglichten, die amerikanische Erfahrung aufzugreifen und auf bis dahin nicht gekannte Weise zu interpretieren. Vor diesem Hintergrund versuchen die Autorinnen und Autoren der in diesem Band versammelten Beiträge, Hannah Arendts spezifischen Zugang zu einer Theorie des Politischen aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren.
Im ersten Block erschließt Wolfgang Heuer Hannah Arendts „Entdeckung der Freiheit“ in Amerika überwiegend aus einer biographischen Perspektive. Bevor Hannah Arendt zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten hat, war sie, so Wolfgang Heuer, von drei Begegnungen entscheidend geprägt worden: von der Begegnung mit Heidegger und Jaspers, von der Begegnung mit dem deutschen Zionisten Kurt Blumenfeld und von der Begegnung mit Heinrich Blücher, ihrem zweiten Mann. Gerade für ihre Berührung mit Amerika sollte die letzte Begegnung eine große Bedeutung bekommen, denn gemeinsam verspürten Heinrich Blücher und Hannah Arendt nach ihren Erfahrungen im Pariser Exil „den Drang, den Abgrund ohne das begriffliche Geländer von Kommunismus oder Zionismus zu erforschen“. Arendt selbst hat die zentrale Bedeutung ihrer Beziehung zu Heinrich Blücher später in der Bemerkung zusammengefaßt: „Meine […] literarische Existenz beruht darauf, daß ich dank meines Mannes politisch denken und historisch sehen gelernt habe“. In Amerika, so Heuer, kamen beide mit einer anderen politischen Tradition in Berührung, die sich wohltuend von der Krise Europas und des europäischen Nationalstaats abhob. In der amerikanischen Trennung von Staat und Nation und der „Teilung der Gewalten als Teilung der Souveränität“ sah Arendt nach ihrer Lektüre der Gründungsdokumente der amerikanischen Republik und den Auseinandersetzungen, die dieser Gründung unter den „Founding Fathers“ vorausgingen, das Modell, an dem sich eine nachtotalitäre Politik orientieren könnte.
Die Beiträge im zweiten Block des Sammelbandes beschäftigen sich mit dem Aufeinandertreffen des kulturkritisch geprägten Denkens vieler deutscher Emigranten mit der gesellschaftlichen Realität Amerikas und dem weitgehend unbekannten amerikanischen politischen Denken. Außer Arendt kommen dabei auch andere Vertreter der deutschen Kulturkritik, insbesondere diejenigen der Kritischen Theorie, in den Blick.
Dagmar Barnouw arbeitet in ihrem Beitrag heraus, daß ein Schlüssel für Arendts politisches Denken in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit dem Zionismus und ihren bereits früh geäußerten Bedenken gegen die Gründung eines jüdischen Staates als Nationalstaat liegt. Diese Überlegungen, so Barnouw, führte sie später in ihren Studien über die amerikanische politische Tradition fort. Das amerikanische Beispiel, in der die aus der Revolution hervorgegangene „Konstitution“ nicht auf einen Gründungsmythos, sondern auf die – „römisch“ verstandene – Autorität des Gründungsaktes abhob und eine für weitere Interpretationen und Neuanfänge offene „Story“ anbot, galt Arendt – in Barnouws Interpretation – als Gegenbeispiel für das auf eine „transhistorische Einzigartigkeit der jüdischen Verfolgung“ rekurrierende und affirmativ-mythische Geschichtsverständnis, welches der Gründung Israels zugrunde lag. Daß Arendt trotz ihrer Prägung in der Tradition der deutschen Kulturkritik überhaupt die „politische Modernität“ Amerikas aufnehmen konnte, lag Barnouw zufolge daran, daß für Emigranten wie Alfred Schütz, Siegfried Kracauer, Carl Zuckmayer, Eric Voegelin und eben Hannah Arendt die Immigration in ein neues Land „die Verantwortlichkeit für das neue Gemeinwesen in sich trug“. Exil bedeutete für sie „nicht nur Verluste, sondern auch neue Anfänge“. Darin unterschied sich diese Gruppe der Exilanten von vielen Vertretern der Kritischen Theorie, die weder etwas Neues von der amerikanischen Politik erwarteten noch danach suchten, sondern sich im Gegenteil – so Barnouws Eindruck – in der Selbstgefälligkeit ihres kulturellen Elitismus und ihrer vorgefaßten Urteile über die amerikanische Gesellschaft einrichteten.
Harald Bluhm beschreibt in seinem Beitrag Hannah Arendts Weg von den Ursprüngen der Weimarer Existentialphilosophie zur Modernität des amerikanischen politischen Denkens. Er fragt zunächst danach, was Arendt auf ihrem Weg nach Amerika „aus der Philosophie mitnimmt, wie sich ihr Denken im Exil verändert, wie sie sich in eine andere Wissenschaftslandschaft einfügt und […] sich zur politischen Ordnung der USA verhält“. Grundlegend für ihr originelles Verständnis der amerikanischen Republik sind, so Harald Bluhm, die Motive des existentialphilosophischen Denkens. Dies drücke sich unter anderem in der Art und Weise aus, in der Arendt Heideggers Weltkonzept in ihr späteres politisches Denken einfügt, aber auch in ihrer Krisendiagnose der Moderne. Insbesondere aus ihrer fundamentalen Kritik am Totalitarismus, den sie selbst als ein Phänomen der Moderne begreift, entstehe ihre Suche nach neuen Konzepten der Politik. In diesem Kontext rückt einerseits der „Rekurs auf antike politische Theorien“, andererseits auf die „amerikanische Revolution“ ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Indem Arendt in ihrer Krisendiagnostik nicht nur auf die Gefahren, sondern auch auf die Chancen von Krisen hinweist und „die Möglichkeit der Entstehung von Neuem“ herausarbeitet, setze sie sich von deutscher Kulturkritik und Verfallsdiagnostik ab. Eine zentrale Rolle spiele dabei der Begriff der Erfahrung, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Zum einen ziele Arendts Destruktion der philosophischen Tradition unter dem Einfluß von Heidegger und Jaspers darauf ab, den Blick für die eigentlichen politischen Erfahrungen und Fragen frei zu machen. Zum anderen sei die Möglichkeit von Erfahrungen an Bedingungen gebunden, die nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden können: strukturell an die Existenz eines öffentlichen Raumes, der Handeln erst ermöglicht, sowie kognitiv-hermeneutisch an das Vorhandensein adäquater Begriffe und politischer Urteilskraft bei den handelnden Subjekten. In einer interpretativen Bezugnahme auf Vita Activa und Über die Revolution entwickelt Bluhm im weiteren die Bedeutung, die Hannah Arendt dem „Pathos des Neubeginnens“ und einem „republikanischen Sinn von Freiheit“ im Prozeß des politischen Handelns zuschreibt. Er erkennt in dieser Konzeption „ein kreativistisches Verständnis des Politischen“, welches einerseits bewußt auf konkrete Handlungsvorschläge im Sinne von policies verzichtet, andererseits aber „auf einer allgemeinen Ebene Chancen und Optionen jenseits deterministischer und pessimistischer Deutungen moderner Politik“ eröffnet.
In einer kritisch kommentierenden Auseinandersetzung mit den Beiträgen von Dagmar Barnouw und Harald Bluhm befaßt sich Thomas Geisen mit dem Verhältnis von Arendts politischem Denken zu der eher soziologisch geprägten Kritischen Theorie Max Horkheimers und Theodor Adornos. Geisen argumentiert gegenüber Barnouws Kritik an der uninteressierten Haltung der Vertreter der Kritischen Theorie an Amerika in der Zeit ihres Exils, daß es in Horkheimers und Adornos kulturkritisch motivierter Einstellung zu den USA vorrangig „um die Analyse der Formen und Ursachen kapitalistischer Herrschaft“ am Beispiel der amerikanischen Gesellschaft ging. Ihre Kritik an der Massenkultur lasse sich nicht von antiamerikanischen Ressentiments, sondern vom Nachweis des Fortgangs „sozialen Unrechts“ und damit von einem emanzipatorischen Interesse leiten. In der weiteren Auseinandersetzung mit Barnouw versucht Thomas Geisen herauszuarbeiten, daß trotz der Tatsache, daß „Pluralität und Differenz“ in der Kritischen Theorie vom Gesellschaftlichen her und bei Arendt vom Politischen her gedacht werden, durchaus eine gewisse „Wahlverwandtschaft als besondere Form des theoretischen Verhältnisses“ zwischen beiden Denkrichtungen vorliegt. Harald Bluhm wiederum, so Geisen, vernachlässige in seinem Beitrag, daß Hannah Arendt „der verfallsgeschichtlichen Tendenz deutscher Kulturkritik eine menschliche Subjektivität“ entgegensetze und sich damit gerade einer systemischen oder dialektischen Interpretation des geschichtlichen Ablaufs nach dem Muster „Krise – Kritik – Verfall – Neuanfang“ entziehe. Ausgehend von seiner Kritik an Barnouw und Bluhm entwickelt Geisen schließlich eine eigene Interpretation von Arendts „Entdeckung der Freiheit in Amerika“. Arendt verstehe den „Akt zur Begründung politischer Freiheit“ durchaus zweifach, nämlich als soziale und als politische Befreiung. In der amerikanischen Revolution ging es zwar vorrangig um die Sicherung und Gestaltung der politischen Freiheit, ohne daß dabei aber „Armut als soziales Problem“ vollkommen aus den Augen geraten sei. Das Prinzip der gleichberechtigten Teilhabe aller – also auch der „Armen“ – habe gerade im amerikanischen Kontext dazu beigetragen, daß diese eine Stimme hatten.
Im dritten Block des Bandes greifen Michael Th. Greven und Winfried Thaa noch einmal die Frage nach Arendts Prägungen durch die deutsche Kulturkritik und Heideggers Existentialphilosophie auf, beziehen diese aber vor allem auf die Frage nach der Modernität Arendts im Vergleich zu anderen Theorien des Handelns, etwa bei Max Weber oder Jürgen Habermas.
Michael Th. Greven stellt in seinem Beitrag explizit die Frage nach der Modernität des politischen Denkens von Hannah Arendt. Jedes Konzept von Modernität, so Greven, müsse „der Kontingenz und damit Krisenhaftigkeit der modernen Welt zureichend Rechnung tragen“. Nach einer Rekonstruktion von Arendts Handlungsbegriff und der ihn tragenden philosophischen Annahmen versucht Greven dann Schritt für Schritt, „ontologisierende“ und inkonsistente Begriffsbildungen in Arendts politischem Denken aufzuzeigen. Dabei bezieht er sich auf ihre Dreiteilung der menschlichen Tätigkeiten in Arbeiten, Herstellen und Handeln. Diese Trias sei willkürlich, weil sie der „unendlichen Vielfalt und Kontingenz menschlichen Tuns“ nicht gerecht werde. Greven kontrastiert im weiteren Verlauf seiner Ausführungen Arendts Handlungsbegriff mit Max Webers Beitrag zur Begründung einer „eigenständigen Soziologie als Handlungswissenschaft“. Weber, so Greven, unterscheide zwischen beobachtbarem Verhalten und einem nur beim Menschen in seiner Sinnhaftigkeit rekonstruierbaren Untertypus, den er „Handeln“ nenne. Dank dieser Unterscheidung vermeide Weber die Festlegung auf bestimmte Grundformen menschlicher Tätigkeit und könne durch die Einführung der Kategorien der „Möglichkeit“ und „Chance“ den „kontingenten Dimensionen des Handelns“ besser begegnen als Arendt. Hannah Arendt dagegen bleibe durch ihre „essentialistische Gleichsetzung“ des Handelns mit einem bestimmten Seinsbereich hinter der unaufhebbaren Kontingenz der modernen Welt zurück und lasse Zweifel an der Anschlußfähigkeit ihres Handlungsbegriffs für eine heutige Theorie der Politik aufkommen.
Winfried Thaa arbeitet in seinem Beitrag zunächst eine Reihe durchaus sinnfälliger Gemeinsamkeiten zwischen Hannah Arendt und der Kritischen Theorie heraus, etwa in bezug auf die Kritik „instrumenteller Vernunft“, den Konformismus moderner Massengesellschaften oder die Gefährdung des Individuums durch Hedonismus und Kulturindustrie. In einem zweiten Schritt versucht er dann zu zeigen, daß Arendt im Unterschied zu den Vertretern der Kritischen Theorie jedoch durch ihre Auseinandersetzung mit den Freiheitspotentialen der amerikanischen politischen Tradition eine „Demokratisierung der Kulturkritik“ gelang. Arendt entwickle ihre Kritik an der Hybris und Amoralität des modernen Menschen nicht vom melancholischen Standpunkt einer „unwiderruflich verlorenen objektiven Vernunft“, sondern bestimme aufgrund ihrer Unterscheidung von Arbeiten, Herstellen und Handeln im „sinnstiftenden und Freiheit verwirklichenden Handeln ein Gegenmodell zum Funktionalismus des Arbeitens und zur instrumentellen Logik des Herstellens“. Insbesondere ihre existentialphilosophisch geprägte Qualifikation des Handelns durch Weltlichkeit und Pluralität ermöglichte es Arendt, die herrschaftszentrierte Wahrnehmung des Politischen zu überwinden. Im Gegensatz zu Max Weber gelinge es Arendt deshalb, das Kontingenzproblem moderner Gesellschaften statt durch Dezisionismus und Herrschaft nun politisch, das heißt durch das institutionell begrenzte Handeln unter Gleichen zu lösen. Während Greven Arendts Handlungsbegriff als vormodern kritisiert und im Vergleich für Webers „offeneren“ Handlungsbegriff plädiert, argumentiert Thaa, daß erst der Handlungsbegriff Arendts die von Platon bis Weber reichende, letztlich auf Technik und Befehls-Gehorsams-Beziehungen rekurrierende Wahrnehmung des Politischen überwinde und den modernen Bedingungen von Kontingenz und Gleichheit gerecht werde.
Im vierten Block diskutieren Horst Mewes und Dana Villa die Frage, ob Arendt in ihrer Interpretation der amerikanischen Revolution zu einseitig auf republikanische Momente fixiert war und dadurch liberale Freiheitsvorstellungen sowie die unhintergehbare Heterogenität moderner Gesellschaften vernachlässigt habe. Rahel Jaeggi nimmt in ihrem Kommentar diese Frage auf und erweitert sie in Richtung einer allgemeinen Auseinandersetzung mit Arendts Verständnis von Pluralität und Individualität im Verhältnis zu liberalen Konzeptionen.
Da Hannah Arendt, wie Horst Mewes argumentiert, ihre Kategorien und Prinzipien des Politischen aus den Erfahrungen der politisch Handelnden selbst ableitet, geht er methodisch zunächst so vor, daß er Arendts Lektüre der Dokumente der „Founding Fathers“ mit seiner eigenen Lektüre und Interpretation dieser Texte vergleicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß Arendts Interpretation zu einer verzerrten Analyse der modernen amerikanischen Politik führe. Den amerikanischen Revolutionären wäre es nicht allein, wie Arendt nahelege, um „öffentliche Freiheit und öffentliches Glück“ gegangen, sondern um die Sicherung und Erweiterung von „öffentlicher und privater Freiheit“. Mewes greift in diesem Kontext Tocquevilles Formulierung vom „richtig verstandenen Eigeninteresse“ auf und sieht darin die Möglichkeit, eine Brücke zwischen dem privaten und öffentlichen Bereich herzustellen. Arendt erkenne aber gerade die „privaten“ Gruppen der Zivilgesellschaft, wie sie Tocqueville besonders hervorhebe, nicht als politisch essentiell an. Ein weiteres Versäumnis Arendts bei ihrer Lektüre der Gründungsdokumente der amerikanischen Republik sieht Mewes in ihrer Vernachlässigung der Diskussionen über das Repräsentationsprinzip, obwohl gerade hier ein Schlüssel dafür vorliege, das Verhältnis von privater und öffentlicher Interessenvertretung in der amerikanischen Politik angemessen zu verstehen. Dadurch komme es bei ihr zu einer Überbewertung des Republikanismus. Auch Arendts Interpretation von John Adams’ Leidenschaft für das „öffentliche Erscheinen und Auszeichnen“ im Prozeß des politischen Handelns führe, so Mewes, zu Mißverständnissen, weil sie es versäume, der Ambivalenz des öffentlichen Auftretens, welches auch vom Verlangen nach publicity und Zurschaustellung geleitet sein kann, Rechnung zu tragen. Insofern vertrage sich ihr emphatischer Begriff des politischen Handelns kaum mit der Wirklichkeit der heutigen Mediengesellschaft.
Dana Villa wählt in seinem Beitrag ebenfalls die Methode des Vergleichs, um Hannah Arendts spezifischen Zugang zur amerikanischen politischen Tradition herauszuarbeiten. Im Zentrum stehen dabei Arendts und Tocquevilles Interpretationen der amerikanischen Demokratie. Er stellt große Übereinstimmung nicht nur in der Bewunderung beider Autoren für das Prinzip der Selbstregierung und der Dezentralisierung der Macht fest, sondern auch in ihrer Betonung des Vorrangs des Politischen. Ein weiterer Punkt, der Arendt und Tocqueville eint, ist nach Dana Villa ihre Diagnose möglicher (bei Arendt bereits eingetretener) Pathologien der amerikanischen Gesellschaft. Dazu zähle die Sorge vor einem despotischen Verwaltungsstaat und einem auf materiellen Reichtum orientierten Individualismus. Tocqueville verstehe jedoch „Individualismus“ nicht als Selbstsucht und Selbstbezogenheit, sondern sehe darin eine desintegrierende Kraft in bezug auf Familien, Generationen und Klassen, dessen moralische Wirkung darin bestehe, „öffentliche Tugenden trockenzulegen“. Einen wesentlichen Unterschied zwischen Arendt und Tocqueville erkennt Dana Villa in ihrer Herangehensweise an das Verhältnis von Religion und Politik. Während Arendts Denken von einem tiefen „Mißtrauen gegenüber einem religiösen Antrieb der Politik“ gekennzeichnet war, meinte Tocqueville im christlichen Glauben das moralische Fundament der amerikanischen Freiheit gefunden zu haben. Diesen Aspekt der religiösen Fundierung der Demokratie bei Tocqueville, das Paradox, daß er als Advokat des Pluralismus zugleich eine gemeinsame Religion befürworte, übersähen wir heute unter dem Einfluß kommunitaristischer Interpretationen, die lediglich Tocquevilles Vorliebe für die vielfältigen zivilen Assoziationen betonten. Im weiteren Verlauf seines Beitrags fragt Villa dann, ob Arendts republikanisches Motiv des „Gründens und Bewahrens“ eine angemessenere Lösung für die radikale Pluralität moderner Gesellschaften biete. Arendt sehe in der amerikanischen Verfassung das Beispiel für einen neuen Raum der Freiheit, der ohne die Rückversicherung auf „zweifelhafte Absolutheiten“ und übergeordnete Autoritäten auskommt. Arendts „geniale“ Interpretation bestehe nun darin, den Akt der Gründung selbst zur Quelle der Autorität der Verfassung zu erklären. Gleichwohl hält Dana Villa Tocquevilles und Arendts Versuche, den „Vorrang des Politischen“ auf etwas „Stabileres als konstitutionelles Recht und institutionelle Rahmenbedingungen“ und damit auf „Mythen“ zu gründen, für nicht vereinbar mit dem moralischen Pluralismus, der die gegenwärtigen liberalen Demokratien kennzeichnet.
Rahel Jaeggi greift die Kritik von Horst Mewes und Dana Villa an Arendt auf und versucht, die Motive von Arendts Kritik am liberalen Modell des Politischen zu ergründen. Es gehe Arendt um die „priority of the political“ gegenüber der „priority of the private“ im liberalen Modell. Nicht weil sie „antiliberal“ gewesen sei, sondern weil in der liberalen Tradition Probleme, die aus „Privatinteressen heraus motiviert sind“, zum Gegenstand politisch-öffentlicher Regelungen werden, ohne einen eigenen Raum des Politischen zu konstituieren, habe Arendt im Liberalismus eine Gefahr für das genuin Politische gesehen. Jaeggi sieht in Arendts Konzeption von „Welt“ und „Person“ eine Möglichkeit, die dichotomische Gegenüberstellung von Republikanismus und Liberalismus zu überwinden. Weder das Individuum noch die Welt, auf die es sich bezieht, seien bei Arendt feste, vorauszusetzende Größen, sondern beide konstituieren sich erst im Wechselspiel des politischen Handelns und verändern sich dabei. Arendt vernachlässige insofern keinesfalls den Pluralismus moderner Gesellschaften, sondern habe einen anderen Begriff von Individualität und Pluralität als der Liberalismus. Politik sei in Arendts Verständnis eben nicht einfach der Ort der Aushandlung unterschiedlicher Interessen oder unhintergehbarer Differenzen. Im Gegenteil: Erst im Rahmen eines gemeinsamen Handelns im öffentlichen Raum und der Gestaltung einer gemeinsamen Welt konstituieren sich Interessen und Differenzen als politische und eröffnen dadurch gleichzeitig die Möglichkeit ihrer Transformation. Gerade dieser „transformative Charakter“ des politischen Handelns im öffentlichen Raum überwinde die Tendenz des liberalen Denkens, „jede Form der substanziellen Debatte zwischen verschiedenen Lebensformen unmöglich zu machen“.
Im letzten Teil des Bandes geht Otto Kallscheuer noch einmal zurück zu den biographischen Wurzeln von Arendts Identifikation mit der amerikanischen Demokratie, an der sie bekanntlich trotz ihrer Kritik der US-Außenpolitik und der inneren Verfassung der amerikanischen Gesellschaft festhielt. Er unterstreicht, daß Amerika für Arendt nicht nur Exil, sondern auch eine Chance als Publizistin und Wissenschaftlerin darstellte, die sie als Jüdin und als Frau im Europa der Zwischenkriegszeit wohl nicht gehabt hätte. Die Kernthese Kallscheuers lautet allerdings, daß Arendts Lesart der amerikanischen Politik verzerrt sei durch ihre New Yorker Erfahrungen und sie die religiösen Ursprünge der amerikanischen Republik ignoriere. Die revolutionäre „Nation“ Amerika sei ohne die evangelische Erweckungsbewegung des achtzehnten Jahrhunderts und ihre bis heute politisch wirksamen Wiederbelebungen nicht adäquat zu verstehen. Die amerikanische Zivilreligion umfasse nicht nur „Rom“, sondern auch „Israel“, und das bedeute den „biblischen Code von Prüfung und Umkehr, vom Bund mit Gott, vom Vertrauen in den HERRN beim Zug durch die Wüste und beim gerechten Kampf“. Wie ungeheuer dieses „zweite Register“ der amerikanischen Zivilreligion in europäischen Augen aussehen kann, braucht heute, angesichts des Versuchs einer gewaltsamen „Demokratisierung“ der arabischen Welt, nicht weiter ausgeführt zu werden.
Auch wenn sich die hier kurz skizzierten Beiträge durch eine große Vielfalt und Differenziertheit im methodischen Vorgehen, in der Argumentation und in der Darstellung auszeichnen, werden sie doch durch den gemeinsamen Fokus, der diesem Band zugrunde liegt, zusammengehalten. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, daß die meisten Beiträge viele gemeinsame Referenzpunkte aufweisen und manchmal in geradezu verblüffender Art und Weise dieselben Texte und Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven betrachten und unterschiedlich interpretieren. Wenn man in Rechnung stellt, daß Hannah Arendt schon zu ihren Lebzeiten eine umstrittene politische Denkerin war, die nie für sich in Anspruch genommen hat, eine geschlossene politische Theorie zu entwerfen, dürfte diese Multiperspektivität kaum überraschen. Es ist aber mit Sicherheit kein Zufall, daß trotz aller Unterschiede in den Perspektiven und Urteilen die Bedeutung von Hannah Arendts Begriff des „politischen Handelns“ für eine Theorie des Politischen in den meisten Beiträgen ohne Einschränkung gewürdigt wird. Dies unterstreicht einmal mehr, daß für all diejenigen, deren Vorstellungen von Politik und politischer Theorie sich nicht in funktionalistischen und systemtheoretischen Zugangsweisen erschöpfen, gerade von ihrem Begriff des „politischen Handelns“ bis heute eine große Faszination ausgeht.
Lothar Probst
Winfried Thaa
1Hannah Arendt, Macht und Gewalt, München 1987, S. 10.
2Hannah Arendt/Karl Jaspers, Briefwechsel 1926–1969, München/Zürich 2001, S. 66f.
3Hannah Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, München/Zürich 1998, S. 115.
4Hannah Arendt, Zur Zeit. Politische Essays, Berlin 1986, S. 163.
5Vgl. Hannah Arendt, „The Threat of Conformism“, in: Dies., Essays in Understanding 1930–1954, New York 1994, S. 427.
6Hannah Arendt, Über die Revolution, München 1994, S. 178.
7Aus einem Vortragsmanuskript von Ernst Vollrath mit dem Titel „Die Originalität des Beitrages von Hannah Arendt zur Theorie des Politischen“.
8Ebd.
9Hannah Arendt/Heinrich Blücher, Briefe 1936–1968, München/Zürich 1996, S. 125.
10Dolf Sternberger, „Die versunkene Stadt“, in: Merkur 341 (1976), S. 941.
11Vollrath, „Die Originalität des Beitrages von Hannah Arendt zur Theorie des Politischen“, a.a.O.
12Sternberger, „Die versunkene Stadt“, a.a.O., S. 940.