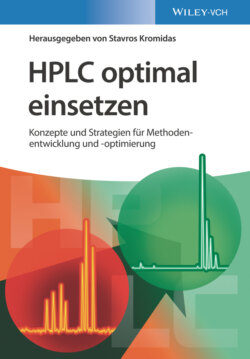Читать книгу HPLC optimal einsetzen - Группа авторов - Страница 63
3.2.4 Überprüfung der Komplettmethode
ОглавлениеIm abschließenden Schritt werden nun LC-Trennung und MS-Detektion methodenseitig zusammengeführt. Wer es eilig hat, installiert einfach die benötigte Trennsäule, koppelt die UHPLC-Anlage fluidisch mit dem MS-Ionenquelleneinlass und startet eine Trennung einer (matrixfreien) Standardlösung mit den separat optimierten Bedingungen für UHPLC und MS. Die Chance, dass dies auf Anhieb funktioniert, ist recht hoch. Oft muss man jedoch MS-Quellenparameter nachkorrigieren, weil sich in der Gradientelution die tatsächliche Elutionsmittelzusammensetzung für einen Analyten deutlich von der Zusammensetzung des Tuningexperimentes unterscheidet. Die auf eine isokratische Eluentenzusammensetzung hin optimierten Quellenparameter sind nicht optimal geeignet für deutlich abweichende Mischungsanteile an Wasser und Organik. Bevorzugt beobachtet man dies im wasserreichen, „nassen“ Bereich des Elutionsprogramms, wo es häufiger zu Tröpfchenbildung, erkennbar an Spikes in der Signalbasislinie, kommt. In Extremfällen muss man zu unterschiedlichen Zeiten des Chromatogramms mit individuell auf dieses Zeitsegment angepassten Quelleneinstellungen arbeiten. Die marktüblichen MS-Kontrollprogramme erlauben zwar keine kontinuierliche Änderung von Quellenparametern, wie z. B. einen Druckgradienten über die Zeit für das Vernebelungsgas. Zumindest aber ist die Unterteilung des Trennzeitfensters in unterschiedliche MS-Detektionssegmente möglich, für die unabhängige Einstellungen definiert werden können. Die Erfahrung zeigt aber, dass dies in vielen Fällen nicht nötig ist und man mit ein wenig Geschick rasch zu einem globalen Satz an MS-Einstellungen gelangt, mit dem über das komplette Elutionsfenster hinweg zuverlässig gearbeitet werden kann.
Wer lieber methodisch ausführlicher vorgeht, legt vor der ersten LC-MS-Trennung noch einen Zwischenschritt ein, in dem die UHPLC-MS-Kopplung einschließlich eingebauter Trennsäule apparativ lauffertig aufgesetzt, allerdings zwischen Säule und Massenspektrometer wieder wie beim MS-Tuning über ein T-Stück eine Spritzenpumpe angeschlossen wird. Man lässt dann die UHPLC-Anlage Blindgradienten ohne Probeninjektion durch den Probengeber fahren und speist wiederum eine Analytlösung hinter der Säule über das T-Stück kontinuierlich zu. Mit diesem Aufbau lässt sich rasch ermitteln, ob die beim MS-Tuning ermittelten MS-Detektionsparameter über den gesamten Gradientelutionsbereich hinweg ausreichend gute Resultate erlauben und wie sich das Analytsignal im Massenspektrometer in Abhängigkeit der Laufmittelzusammensetzung ändert. Gleichermaßen kann man anhand der Blindgradienten ohne Nachsäuleninfusion bestimmen, inwieweit sich das Basislinienrauschen über den Gradienten hinweg ändert, z. B. durch unsaubere Lösemittel, vermehrtes Säulenbluten oder Verunreinigungen aus der Apparatur. Für Realproben von hoher Bedeutung ist zudem die Bestimmung von Matrixeinflüssen (Ionensuppression), die auf ähnliche Weise mit einer Matrixlösung bestimmt werden kann [1]. Nach einer solchen Überprüfung der LC-MS-Methode auf ihre Tauglichkeit hin kann mit den üblichen Verfahrensschritten einer Methodenvalidierung fortgefahren werden.