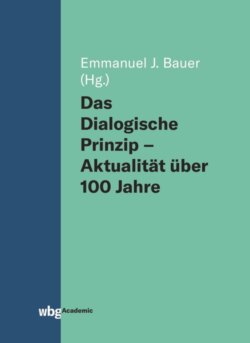Читать книгу Das Dialogische Prinzip - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Beispiele von Dialogen aus Homer, Thukydides und Sophokles
ОглавлениеDialogisches ist daher von Beginn an in vielen Gattungen der griechischen Literatur vorzufinden, natürlich auch im poetischen Kosmos der homerischen Gesänge, die weit über die Epik hinaus Vorbild und Anregung für nachfolgende Zeiten wurden.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel findet sich im letzten, dem 24. Gesang der „Ilias“, „Lytra“ genannt, weil der trojanische König Priamos sich zu Achill begibt, um die Leiche seines Sohnes Hektor auszulösen (tò l ýtron bedeutet „Lösegeld“). Wir haben hier, gleich an ihrem Anfang, wohl einen der bewegendsten Dialoge der Weltliteratur vor uns, der eine Fülle von Merkmalen und Kriterien aufweist, die man zur Einschätzung der Qualität von Dialogen an sie anlegt.
Schon die Gesprächssituation ist von höchster Brisanz, hat doch Priamos mit Hektor seinen Erstgeborenen und den größten Helden der Trojaner verloren, Achill hingegen mit ihm den ihm verhassten Mörder seines Freundes Patroklos getötet und dann täglich dreimal um dessen Grab geschleift. Nun also begibt sich der greise König der Trojaner in das Lager von deren erbittertstem Feind, begleitet von Hermes, den Zeus zu seinem Schutz entsandt hat, und ausgerüstet mit einem Maultiergespann, das die Schätze zur Auslösung der Leiche mit sich führt. Priamos trifft Achill nach dem Abendessen in Gesellschaft zweier Freunde, umfängt dessen Knie und küsst dessen „schreckliche männertötenden Hände“. Die Anwesenden hören gebannt auf seine ersten Worte: Achill möge an seinen eigenen greisen Vater denken, der in Bedrängnis auf die Hilfe seines starken Sohnes hoffen könnte. Ihm sei solche Hoffnung nun verwehrt.
Die Gesprächsführung setzt sich psychologisch fein gezeichnet fort, mit schön verteilten Strichen indirekter Charakterisierung der beiden Gesprächspartner (Achill reizbar und leicht zu seinem das ganze Epos treibenden Zorn bereit, Priamos leidgeprüft und doch selbstbewusst als Herrscher), tiefen Einsichten in die von den Göttern verhängte condition humaine (Achill weiß von seinem frühen Ende), aber auch mit Phasen der Entspannung der so heiklen Situation, wenn sich etwa beide der gegenseitigen Wertschätzung versichern oder über die Geldgier der Griechen und ihres von Achill durchgehend ja sehr ambivalent gesehenen Anführers Agamemnon spotten.
Mit dem Rücktransport der Leiche nach Troja und ihrer Verbrennung nach einer zehntägigen, im Gespräch vereinbarten Waffenruhe endet die Ilias, sodass dieser Dialog zu einem abschließenden, fulminanten Höhepunkt des ganzen Gedichts gerät.
Ein zweites Beispiel sei der Gattung der Historiographie entnommen, und zwar dem Werk des Thukydides, der als Begründer einer an Tatsachen orientierten „pragmatischen“ Geschichtsschreibung gilt, in der Darstellung von Reden und Gesprächen allerdings, wie er selbst ankündigt (1, 22, 1), nicht eine wörtliche Wiedergabe, sondern eine auf den Gesamtsinn gehende und von der jeweiligen Situation geforderte Paraphrase anstrebt.
In seinem berühmten „Melierdialog“ (5, 84–116) geht es um den Konflikt zwischen der Insel Melos, die im peloponnesischen Krieg neutral bleiben will, und einer Gesandtschaft aus der Stadt Athen, deren Imperialismus solches nicht duldet.
Gleich zu Beginn des Dialogs wird der Dialog selbst zum Thema. Die Athener wollen nämlich ihre Argumente vor der Volksversammlung der Melier vortragen, diese hingegen eine Debatte im Adelsrat. Jene akzeptieren das mit der bemerkenswerten Einsicht, dass die Melier dort bei einer durchgehenden Rede der Athener zurecht eine mögliche Manipulation ihres Volkes befürchteten, und schlagen eine Diskussion kath’ hékaston („Punkt für Punkt“, 5, 85) vor, damit Auffassungsunterschiede sofort zur Sprache kommen können. In schärfstem Gegensatz zu dieser scheinbaren Offenheit machen sie allerdings gleich eingangs klar, dass hier das Recht des Stärkeren und nicht Gerechtigkeit walte, die nur bei Gleichheit der Kräfte zur Geltung käme. Mit der Vorwegnahme seines Ausgangs aber ist dem Dialog seine Offenheit genommen und scheint ihm seine Basis entzogen, und das Ergebnis bestätigt dies. Die Oligarchen von Melos wollen ihre siebenhundertjährige Freiheit nicht aufgeben, sie hoffen auf die Hilfe der Götter und auf Athens Gegner Sparta. Die Athener beginnen ihre Belagerung, die über den Winter andauert und Melos schließlich zur Aufgabe zwingt. Die männlichen Inselbewohner werden hingerichtet, Frauen und Kinder als Sklaven verkauft, die so entleerte Insel erhält eine Kolonie von 500 attischen Bürgern.
Das schreckliche Scheitern dieses Dialogs hat vielfach zur Auffassung geführt, es handle sich hier gar nicht um einen ‚echten‘ Dialog, sondern, wie im Werk des Thukydides insgesamt, vor allem um eine Darstellung der „Physiologie und Pathologie der Macht“.1 Er wird außerhalb der ‚eigentlichen‘ Gattung verortet und der sophistischen „Eristik“ zugerechnet, wo es eben nicht wie in der „Dialektik“ des philosophischen Dialogs um Einigung und damit Belehrung auf höherem Niveau, sondern nur um einen „Schlagabtausch“ als „rhetorisch-technische Übung“ gehe. Die Athener hätten „die Fähigkeit zum konstruktiven dialégesthai im Angesicht imperialer Macht“ verloren.2
Mein Blick auf die Theorie und Praxis des politischen Dialogs der Gegenwart im zweiten Teil dieses Vortrags wird hingegen zeigen, dass Thukydides möglicherweise auch hier einen scharfen und tiefen Blick auf ein anthrópinon (etwas „wesenhaft Menschliches“) getan hat, wie er es für sein Geschichtswerk generell in dem schon erwähnten Methodenkapitel 1, 22 ankündigt.
Zu den Vorbildern des Thukydides zählen, und auch das wird vielfach betont, die Dialoge im attischen Drama, in Tragödie und Komödie. Nach Aristoteles sind diese Dramenformen sogar durch die Einführung einer Dialogsituation entstanden. Im vierten Kapitel seiner „Poetik“ deutet er an, dass improvisierte Dialoge der Anführer von Chören mit eben diesen am Anfang gestanden seien. Der berühmte Thespis (dessen sprichwörtlicher Theaterkarren erst viel später bei Horaz erwähnt ist) soll als erster dem Chor in Prolog und Einzelrede gegenübergetreten sein und so die Tragödie erfunden haben.
Der Dialog ist also gleichsam ein Geburtshelfer des Dramas und prägt es dann in dessen gesamter Entwicklung in einer großen Bandbreite, von einem ganz ‚natürlich‘ scheinenden lockeren Sprecherwechsel bis hin zu gesungenen Partien oder bisweilen sehr künstlich wirkenden Stichomythien (Sprecherwechsel mit jedem Vers) und Antilabai (noch raschere Wechsel).
Als ein Beispiel (unter sehr vielen möglichen) sei ein kurzer Blick auf den Dialog geworfen, der im „König Ödipus“ des Sophokles den Protagonisten zur anagnórisis, also zur Erkenntnis seiner Identität, damit aber auch zum Wissen um seine Kapitalverbrechen Vatermord und Mutterehe führt. Ödipus, als König von Theben auf der energischen Suche nach dem Mörder seines Vorgängers (und Vaters!) Laios, presst einem alten Hirten, der ihn einst als Kind in den Bergen hätte aussetzen sollen, aus Mitleid aber einem korinthischen Kollegen übergeben hatte, in gedrängtester Wechselrede die Wahrheit über seine Herkunft heraus. Der rasche Sprecherwechsel in der Stichomythie ab V. 1149 verhindert einen zügigen und ungehinderten Informationsfluss, willkommen für den Hirten, der die schreckliche Wahrheit ja verschweigen, unerträglich für Ödipus, der sie wissen will, aber mit seinen drängenden Einwürfen ihre Kundgabe immer wieder hinausschiebt. Schließlich kann er den Hirten mit der gezielten Frage nach der Identität des Kindes festnageln, doch dieser versucht eine letzte Ausflucht: „O weh, bei mir selbst liegt es nun, das Schreckliche zu sagen“ (V. 1169). Der es nun schon ahnende Ödipus darauf: „Und an mir, es zu hören. Aber gehört werden muss es!“ Nach einem Hinweis des Hirten auf des Königs schon ins Innere des Palastes geflüchtete Gattin (und Mutter!) Iokaste steigert sich die Gesprächsverdichtung nochmals zu Halbversen, in denen die Brutalität der Mutter (und Gattin!) sichtbar und der Ödipus ja schon bekannte Orakelspruch als Ursache ausgemacht werden. Das Weitere ist bekannt: Ödipus blendet sich, und zwar mit einer Fibel vom Kleid Iokastes, die er im Palast erhängt vorgefunden hat.
Dieser Dialog bildet fraglos den Höhepunkt des schon von Aristoteles als musterhaft empfundenen Dramas. Seine besondere Kunst besteht darin, die Zuschauer, denen die Fabel ja bereits zur Zeit des Sophokles geläufig war, trotz ihres Vorwissens bis heute nochmals in atemlose Spannung zu versetzen, die sogar beim schlichten Lesen der Passage noch spürbar wird. Keine andere Form scheint diesem Effekt dienlicher als eben der Dialog.