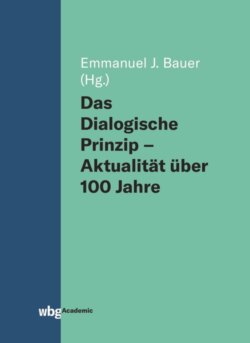Читать книгу Das Dialogische Prinzip - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hinführung
ОглавлениеAls vor 100 Jahren am Ende des Ersten Weltkrieges die europäische Welt in Trümmern lag, waren es einige jüdisch-christliche Denker, die versuchten, mit ihrem personal-dialogischen Ansatz der unvorstellbaren Verrohung des Menschlichen einen Weg zu einer neuen Humanität aufzuzeigen. Sie konnten die dramatischen Auswirkungen dieses Krieges, der letztlich die anderen großen Tragödien des letzten Jahrhunderts (Stalinismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Holocaust, Zweiter Weltkrieg) evozierte, nicht kennen, aber vermutlich erahnen. Brutalität, Zerstörungswut und Misstrauen waren in einem Ausmaß zu Tage getreten, wie man es nicht für möglich gehalten hatte. Eine Besinnung auf die Würde des Menschen als Person tat not.
Die Bedeutung des Miteinander und der gegenseitigen Anerkennung als Personen wurde schon früher erkannt und von der Philosophie ins Bewusstsein gehoben. Es sei an Georg W. F. Hegel, Johann G. Hamann, Johann G. von Herder oder Friedrich H. Jacobi erinnert. In Abgrenzung zum Deutschen Idealismus strich Ludwig Feuerbach die Bedeutung des leibhaften Ich-Du-Verhältnisses hervor, wenn er betont: „Die wahre Dialektik ist kein Monolog des einsamen Denkers mit sich selbst, sie ist ein Dialog zwischen Ich und Du.“1 Den wahren Durchbruch erlangte das Dialogische Prinzip jedoch durch Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner und Martin Buber, die in etwa zur gleichen Zeit ihre Gedanken formulierten und der Öffentlichkeit präsentierten. Sie stellen das mutige Vertrauen dem Grundgefühl der Angst und des Misstrauens, die wirkliche, offene Beziehung der sich abschottenden Ich-Einsamkeit und das echte Gespräch den vielen Formen des als Monolog verkleideten Scheindialogs gegenüber. Echtes Gespräch setzt gegenseitige rückhaltlose Offenheit, Innewerden der Person-Ganzheit des Anderen, Authentizität und gegenseitige Achtung und Wertschätzung voraus.2 Im Unterschied zu den vielen oberfläch-lichen Formen des Miteinanderredens geht es hierbei um eine Art der Begegnung zwischen Ich und Du, die von den Gesprächspartnern verlangt, den Anderen radikal ernst zu nehmen und sich von dessen Eigenart und wahren Anliegen wirklich berühren zu lassen. Mutatis mutandis ist die das echten Gespräch bedingende existentielle Grundhaltung auch eine der Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander von Menschen und Völkern. Der gegenwärtige politische Stil, dem es in erschreckendem Ausmaß an Verlässlichkeit, Behutsamkeit der Worte und Ehrlichkeit mangelt, aber auch die zum Teil Besorgnis erregenden Veränderungen der Kommunikation aufgrund der neuen Medien und die zunehmenden Probleme mit Extremismen machen uns bewusst, welch große Aktualität dieses sogenannte Dialogische Prinzip heute von Neuem für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft angesichts der Herausforderungen in Politik, Religion und Gesellschaft hat.
Um der großen Bedeutung des richtigen Sprechens Miteinander und der echten Form menschlicher Begegnung nachzuspüren, veranstaltete die Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft gemeinsam mit dem Fachbereich Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg vor einigen Wochen ein Symposion über die ungebrochene Aktualität des Dialogischen Prinzips über 100 Jahre hinweg. Folgende Themen wurden dabei aufgegriffen:
KARLHEINZ TÖCHTERLE geht den Ursprüngen des Dialogs nach und zeigt, dass dieser als ein humanum von Anfang an eine bedeutende Rolle in vielen Gattungen der griechischen Literatur spielte, wie Beispiele aus Homer, Thukydides und Sophokles belegen. Der weithin als Höhepunkt angesehene philosophische Dialog Platons wird schon bei seinem Schüler Aristoteles umgeformt und so von Cicero übernommen, der seinerseits zum Klassiker wird. Er und die großen spätantiken Vertreter der Gattung, Augustinus und Boethius, bleiben Vorbilder bis in die Zeit der Renaissance und des Humanismus, aus der gleich zu Beginn Petrarca herausragt. Nach der Aufklärung nimmt die Bedeutung des literarischen Dialogs stark ab. Die vielleicht etwas übertreibende Rede von seinem „Ende“ in der gegenwärtigen Politik gründet sich in persönlichen Erfahrungen des Autors, wird aber auch von der aktuellen Debatte gestützt.
CHRISTA DÜRSCHEID analysiert zunächst den Terminus Dialog aus sprachlich-struktureller Sicht und die Kriterien eines „echten“ Dialog im Sinne Bubers. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass die personale Kommunikation im Internet zwar dialogischen Charakter hat, sofern sich die Äußerungen aufeinander beziehen, dass sie aber ob des Mangels an gegenseitiger Wertschätzung doch keinen echten Dialog darstellt. Im zweiten Teil legt sie dar, welche sprachlichen Merkmale für die schriftliche Internetkommunikation (z.B. in WhatsApp-Nachrichten und auf Facebook) charakteristisch sind und führt einige Beispiele für ehrverletzende und beleidigende Nachrichten, also für solche Äußerungen an, die gerade nicht von Respekt und Wertschätzung zeugen. So besorgniserregend letztere auch sind, dürfen sie aber doch nicht als typisch für die Internetkommunikation angesehen werden; man dürfe nicht das Auffällige mit dem Typischen gleichsetzen. Vielmehr muss aus linguistischer Sicht der Sprachgebrauch auch dahingehend beurteilt werden, ob er sozial angemessen ist, ob er also den Erwartungen entspricht, die für den jeweiligen zwischenmenschlichen Umgang gelten.
GÜNTER FIGAL schließt an Michael Theunissens Interpretation der Dialogphilosophie als einer starken philosophischen Alternative zur Phänomenologie der Intersubjektivität an, wie sie von Husserl, Heidegger und Sartre ausgearbeitet worden ist, und versucht, die von Theunissen monierte begriffliche Schwäche der Dialogphilosophie zu kompensieren. Da ihm mit den begrifflichen Mitteln der ‚klassischen‘, auf Husserl zurückgehenden Phänomenologie eine solche Kompensation nicht möglich erscheint, wenn die Dialogphilosophie zu ihr eine Alternative bieten soll, nimmt er den Begriff des ‚Zwischen‘ auf, mit dem Buber das Wesen der Ich-Du-Beziehung bestimmt, und interpretiert diesen Begriff im Rahmen einer Phänomenologie des Raumes (vgl. sein Werk „Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie“, 2015). Personen, so wird gezeigt, sind nicht nur räumlich, sondern sie leben Raum. Entsprechend kann die Begegnung von Personen, wie Buber sie beschreibt, als personale Erfahrung geteilten Raums verstanden werden.
EMMANUEL J. BAUER weist auf, dass Psychotherapie, wenn man sich zum einen vor Augen führt, dass sie die Heilung des psychisch erkrankten Menschen oder zumindest die Stabilisierung seiner ganzmenschlichen Verfassung zur Aufgabe hat, und zum anderen die zentrale Rolle des personalen Dialogs für das Selbst-Sein und Selbst-Werden des Menschen bedenkt, letztlich nicht umhin kommt, dem Dialogischen Prinzip in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Am Beispiel von drei Psychotherapie-Schulen, nämlich der Gestalttherapie, der Personen- oder Klientenzentrierten Gesprächstherapie und der Existenzanalyse wird untersucht, welche Bedeutung das Dialogische in der theoretischen Grundlegung des therapeutischen Handelns jeweils hat. In allen drei genannten Richtungen wird Martin Bubers Gedanken der Ich-Du-Begegnung eine prominente Rolle zuerkannt, in der Existenzanalyse darüber hinaus auch dem Zwiegespräch mit sich selbst – als Ort der inneren Abstimmung dessen, was für den Einzelnen das Richtige und Wahre in der je konkreten Situation ist. Allerdings müssen auch die Grenzen der Anwendbarkeit des echten Dialogs auf das psychotherapeutische Setting sowie der sekundäre Charakter des inneren Dialogs berücksichtigt werden.
ALEIDA ASSMANN unterscheidet in Anschluss an Paul Ricoeur eine „idem“-Identität, die die Selbigkeit einer Person über die Zeit hinweg betont, von einer „ipse“-Identität, die das Selbstverhältnis zum Gegenstand der Reflexion macht. Die Herstellung eines solchen Selbstverhältnisses ist ohne den Aufbau einer sozialen Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen unmöglich: Das Selbstgespräch ebenso wie das Erinnern festigen immer auch soziale Bindungen. Der Prozess des Erinnerns ist aber nicht auf das Individuum beschränkt, es gibt auch ein kollektives Erinnern. In diesem Falle wird das gemeinsame Gedächtnis durch einen gesellschaftlichen Rahmen zusammengehalten. Dessen Struktur entscheidet über Ausgrenzung oder Integration. Die Geschichte zeigt, dass das nationale Gedächtnis dazu tendiert, die Ereignisse auf Archetypen zu reduzieren, etwa auf die Rolle des Siegers, Opfers oder Widerstandskämpfers, um die nationale Identität zu stützen. Doch auf diesem Weg sei nur ein Dialog unter Schwerhörigen möglich. Es geht darum, die monologische Form des Erinnerns, die das Augenmerk nur auf das eigene Leiden richtet, in eine dialogische Erinnerungskultur zu verwandeln, in der auch das Leid des anderen Volkes mit in den Blick kommt und bleibt.
KARL-JOSEF KUSCHEL versucht in seinem Beitrag im Anschluss an Martin Buber zu klären, was „echte Religionsgespräche“ sind und diese abzugrenzen von einem „technischen Dialog“, der auf dem Austausch bloßer Sachinformationen beruht, sowie von einem „dialogisch verkleideten Monolog“, bei dem man nicht zu einem Gegenüber spricht, sondern nur zu sich selbst und sich seines eigenen Glaubens vergewissert. Echte Religionsgespräche dagegen sind etwas anderes. Sie haben nicht das Ziel, die Differenzen zwischen den Religionen zu überspielen oder die Wahrheitsfrage auszuklammern oder zu bagatellisieren. Echtem Dialog ist aufgegeben, aus der Perspektive des jeweils eigenen legitimen Glaubenszeugnisses heraus die Existenz des anderen vor Gott mit zu bedenken. Zur Identitätsgewinnung kommt es von daher nicht durch Ausgrenzung oder Verwerfung anderer, sondern in Relationalität zum Anderen, also im Zuge von Beziehungsdenken. Interreligiöses Lernen beginnt nach der Überzeugung des Verfassers mit der Umkehr des Sehens. Die jeweils Anderen dürfen nicht mehr als bloße Objekte für die Durchsetzung eigener Überzeugungen, sondern müssen mit dem ‚dritten Auge‘, mit den Augen des Glaubens, wahrgenommen werden. Werden Menschen aus der Tiefe des Glaubens betrachtet, geben sie sich als jeweils unverwechselbar-einmalige Geschöpfe Gottes zu erkennen. Die Anders-Gläubigen sind als Anders-Gläubige zu entdecken. Für diese Denkform eine theologische Begründungsstruktur aufzuzeigen und zu verantworten, ist Anliegen des Beitrags.
Am Ende dieser geistigen Hinführung erlauben Sie mir noch einige Dankesworte. In besonderer Weise danke ich den Kollegen Rektor Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger, dem Präsidenten der Internationalen Ferdinand Ebner Gesellschaft, Dr. Krzysztof Skorulski und Univ.-Prof. Dr. Michael Zichy, die zusammen mit mir für die Initiierung, Konzeption und Durchführung der Internationalen wissenschaftlichen Tagung Sorge trugen. Zudem danke ich Herrn Dr. Jens Seeling für die gute Kooperation mit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und schließlich Frau Dorit Wolf-Schwarz für die Erstellung des Satzes.
1Feuerbach, Ludwig, Grundsätze der Philosophie, in: Ders., Entwürfe zu einer neuen Philosophie. Hrsg. von Walter Jaeschke und Werner Schuffenhauer (Philosophische Bibliothek, Bd. 447), Hamburg: Meiner 1996, § 64.
2Vgl. Bauer, Emmanuel J., Personal-existentieller Dialog als Bedingung authentischen Selbst-Seins bzw. Selbst-Werdens, in: Salzburger Jahrbuch für Philosophie 62 (2017) 9–29.