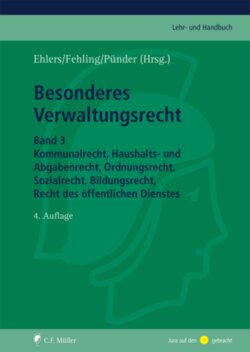Читать книгу Besonderes Verwaltungsrecht - Группа авторов - Страница 405
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Kommunale Gebühren und Beiträge[680]
Оглавление200
Auf Grundlage der jeweiligen Ermächtigungsvorschriften in den Kommunalabgabengesetzen der Länder sind die Gemeinden zur Erhebung von Gebühren und Beiträgen, der sog. Vorzugslasten oder Kausalabgaben, berechtigt. Hinsichtlich der Begriffsbestimmung enthalten die Kommunalabgabengesetze Legaldefinitionen[681].
201
Eine Gemeinde kann eine Verwaltungsgebühr für jedes Handeln der Gemeinde erheben, das vom Gebührenschuldner beantragt worden ist oder ihn unmittelbar begünstigt. Verwaltungsgebühren dienen vor allem dem Ausgleich von Kosten für Amtshandlungen. Der Begriff der Amtshandlung wird weit verstanden, die Amtshandlung erschöpft sich folglich nicht im Erlass von Verwaltungsakten, auch schlichtes Verwaltungshandeln, beispielsweise die Entgegennahme und EDV-mäßige Erfassung von Formularen, wird dem Begriff der Amtshandlung unterstellt[682]. In der Regel fallen Verwaltungsgebühren an für die Ausstellung von Bescheinigungen und Genehmigungen, z.B. im Bereich des Baurechts, daneben werden sie aber auch für sonstiges schlichtes Verwaltungshandeln (Realakte) erhoben. Trotz anderen Wortlauts in den KAG[683] wird aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften von einer Pflicht der Gemeinden zur Erhebung von Verwaltungsgebühren ausgegangen[684]. Für die Berechnung der Höhe der Verwaltungsgebühr sehen die KAG der Länder teilweise besondere Regelungen vor. Festgelegt wird in einigen KAG das Kostendeckungsprinzip[685], das den Kommunen verbietet durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren einen Überschuss[686] zu erzielen. In der Regel orientiert sich die Höhe der Verwaltungsgebühr an den Personal- und Sachausgaben, die durchschnittlich für die Erfüllung der betreffenden Verwaltungshandlung anfallen. Für die Gebührenerhebung – sowohl für Benutzungs- als auch für Verwaltungsgebühren – gilt alternativ bzw. zusätzlich das Äquivalenzprinzip. Als Ausfluss des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzips ist dieses auch dann beachtlich, wenn es im KAG nicht ausdrücklich normiert ist[687]. Im Gegensatz zum generellen Kostendeckungsprinzip fordert das Äquivalenzprinzip, dass die individuell geschuldete Gebühr dem tatsächlichen Wert der Gegenleistung entsprechen muss. Da der tatsächliche Wert der Gegenleistung nicht immer eindeutig bestimmt werden kann, bleibt hier dem Satzungsgeber ein weiter Ermessensspielraum in der Austarierung der Gebührenhöhe zwischen diesen beiden Ansätzen. Im Ergebnis kann letztendlich nur überprüft werden, ob zwischen Leistung und Gegenleistung ein grobes Missverhältnis besteht[688]. Festgelegt werden die Gebührensätze in den Verwaltungsgebührensatzungen der einzelnen Gemeinde[689].
202
Benutzungsgebühren dienen dem Ausgleich für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Der Begriff der öffentlichen Einrichtung wird in den KAG nicht definiert, für die Begriffsbestimmung ist auf die Gemeindeordnungen[690] zurückzugreifen. Hier wird die öffentliche Einrichtung als Bestand personeller und sachlicher Mittel, der der Erfüllung freiwilliger oder pflichtiger Gemeindeaufgaben dient, gefasst[691]. Nicht erforderlich ist, dass die öffentliche Einrichtung lediglich Gemeindebürgern zugute kommt. Auch von Gemeindefremden können für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen Gebühren erhoben werden[692]. Der öffentlich-rechtliche Charakter der Einrichtung ist durch Widmung herzustellen[693]. Als Träger der Daseinsvorsorge im örtlichen Bereich ist die Erhebung von Benutzungsgebühren insbesondere für die Gemeinden von großer Bedeutung: Die Versorgung der Gemeindebürger mit Gas, Wasser und Elektrizität, die Müll- und Abwasserbeseitigung, aber auch das Angebot von Theatern, Schwimmbädern, bestimmter Bildungseinrichtungen oder Friedhöfen ist mit Kosten verbunden. Über die Erhebung von Benutzungsgebühren werden die Begünstigten zum Ersatz des Aufwands herangezogen.
203
Die Gemeinden übertragen Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge regelmäßig auf wirtschaftliche Betriebe. Oftmals werden unselbstständige Regie- oder Eigenbetriebe mit der Aufgabenwahrnehmung befasst. Dies ist vor allem bei der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung der Fall. Möglich ist auch die Einrichtung einer selbstständigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Zum Ausgleich ihrer Ausgaben sind diese Betriebe, sofern sie in öffentlich-rechtlicher Organisationsform agieren, berechtigt, Benutzungsgebühren zu erheben[694]. Den Gemeinden, oder ggf. den wirtschaftlichen Betrieben selbst, steht es aber frei das Benutzungsverhältnis privatrechtlich auszugestalten[695]: Dann muss anstelle von Gebühren und Beiträgen im Sinne der KAG ein privatrechtliches Entgelt[696] als Gegenleistung gefordert werden. Vermehrt nehmen die Gemeinden in den letzten Jahren auch die Möglichkeit wahr, selbst privatrechtliche Betriebe – wegen des Erfordernisses der beschränkten Haftung in den Gemeindeordnungen[697] handelt es sich vor allem um eine GmbH oder AG – zu gründen, um gemeindliche Aufgaben zu erfüllen[698]. Insbesondere für Verkehrs- und Versorgungsbetriebe wird in vielen Städten die GmbH als Organisationsform gewählt. Auch hier ist nur die Erhebung eines privatrechtlichen Entgelts möglich. Darüber hinaus bestehen Bestrebungen das Strom- und Gasnetz, welches in den 1990er Jahren teilweise privatisiert wurde, mit dem Auslaufen der Konzessionen zu rekommunalisieren[699].
204
Zur Bestimmung der Höhe der Benutzungsgebühren enthalten die KAG Vorgaben[700]. Teilweise ist ausdrücklich das Kostendeckungsgebot normiert, nach dem die Gebührenhöhe so bemessen sein soll, dass sie die Kosten der öffentlichen Einrichtung in der Regel decken. Zugleich wird durch dieses Prinzip die Erzielung von Überschüssen durch die Gebühreneinnahme verhindert, da die Abschöpfung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Steuer vorbehalten bleibt. Insofern kann dem Kostendeckungsprinzip Verfassungsrang zugesprochen werden, auch wenn es an einer einfachgesetzlichen Normierung in den KAG fehlt[701].
205
Wie für die Verwaltungsgebühren gilt auch für die Benutzungsgebühren zusätzlich bzw. alternativ das Äquivalenzprinzip[702]: Zwischen geschuldeter Gebühr und dem tatsächlichem Wert der Benutzung der Einrichtung darf kein grobes Missverhältnis bestehen. In einigen Kommunalabgabengesetzen ist ausdrücklich bestimmt, dass Benutzungsgebühren grundsätzlich nach einem „Wirklichkeitsmaßstab“ bemessen werden müssen[703]. Demnach hängt die Höhe des geforderten Entgelts von dem Wert der tatsächlichen Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ab; sollte dieser nicht genau feststellbar sein, darf ausnahmsweise der „Wahrscheinlichkeitsmaßstab“ herangezogen und der Wert der Leistung geschätzt werden; den Satzungsgebern ist hierbei ein Einschätzungsspielraum zuzugestehen. Ein Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip liegt jedenfalls dann vor, wenn die Gebührenhöhe den Wert der kommunalen Gegenleistung evident übersteigt.
206
Lange Zeit umstritten war die Frage nach der Zulässigkeit einer nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gestaffelten Benutzungsgebühr, beispielsweise für den Besuch eines Kindergartens oder einer Musikschule. Teilweise wurde in der Gebührenstaffelung ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG gesehen[704]. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Gebührenstaffelung 1998 jedoch – zumindest für soziale Einrichtungen – als zulässig angesehen, sofern im Sinne des Äquivalenzprinzips selbst der Gebührenhöchstsatz den Wert der kommunalen Gegenleistung nicht unverhältnismäßig übersteigt[705].
207
Im Gegensatz zur Gebühr setzt der Beitrag keine tatsächlich in Anspruch genommene Gegenleistung voraus, sondern wird bereits erhoben, weil dem Bürger die bloße Möglichkeit gewährt wird, eine konkrete Gegenleistung in Anspruch nehmen zu können, es genügt demnach ein abstrakter Vorteil. Wichtigstes Beispiel für die kommunale Beitragserhebung sind die Erschließungsbeiträge.