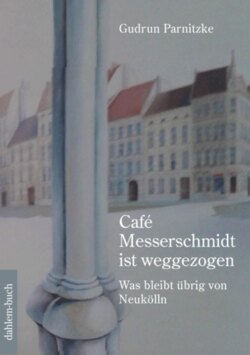Читать книгу Café Messerschmidt ist weggezogen - Gudrun Parnitzke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Morgengrauen
Im Sommer, bei Hitze, ist der Lärm unerträglich, vor allem am Wochenende. Nachts müssen die Fenster offen bleiben.
Das Kind starrt mit weit geöffneten Augen in die Dunkelheit. Warten bis die Schritte auf dem Gehweg verhallen, aber sie kommen immer wieder. Der lässige Gang auf hohen Absätzen bohrt sich in unruhigen Halbschlaf.
Fremde Stimmen aus anderen Wohnungen drängen sich ans Ohr, halblaute Musik, das Aufheulen eines Motors beim Gas geben.
Plötzlich aufflammender Tumult, wenn die Kneipentüren sich öffnen und die hämmernden Rhythmen aus der Music Box an den Fassaden der Häuser emporschießen.
Das Grölen der Betrunkenen geht bis zum Morgengrauen, anschwellend, abebbend, nimmermüde, als fürchteten sie die Stille am Ende einer langen Nacht. Manchmal platzt der schrille Ton der Feuerwehrsirene in den anbrechenden Morgen. Die Feuerwache ist nebenan.
Einmal kommt ein Streifenwagen mit Blaulicht, von den Eltern gerufen. Die Mutter war am Fenster, der Vater am Telefon:
„Sie haben einen jungen Mann aus der Kneipentür gestoßen! Sie haben ihn an den Schultern gepackt und den Kopf auf das Straßenpflaster geschlagen. Immer wieder. Jetzt liegt er da und rührt sich nicht mehr.“
Eine halbe Stunde später ein Rückruf.
„Wir haben niemanden gefunden, keinen Verletzten, nichts zu sehen, keinerlei Spuren. Aber bleiben Sie dran, bitte bleiben Sie dran! Sobald Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, rufen Sie uns an! Dora an Siegfried, wir fahren jetzt zum Hermannplatz.“
Der Vater legt auf: „Ihr könnt uns mal!“
Die Eltern gehen wieder zu Bett.
„Ja früher, die Schupos, die konnten noch durchgreifen!“ Die Mutter sarkastisch: „Die haben den weggeschafft! Zum Teltowkanal.“
Das Kind, barfuß, im Nachthemd, den Henkelbecher aus Blech in der Hand, schließt behutsam den Wasserhahn. Durch die offene Küchentür hat es gelauscht. Es trinkt und hängt den Becher an den Haken über dem Spülbecken. Dann schleicht es ins Bett zurück, die Worte der Mutter im Ohr. Das Kind will einschlafen, aber auf dem bleigrauen Wasserspiegel des Kanals breiten sich kreisförmige Wellen aus und spielen mit dem Haar des Toten. Der Kopfkissenbezug unter der Wange des Kindes zieht sich zusammen, vergeblich versucht es ihn glatt zu streichen. Erst das lang gezogene Heulen der letzten S-Bahn versetzt das Kind in eine dumpfe Betäubung.
Kaum hat die Nacht sich beruhigt, ziehen die ersten Flugzeuge über die Dächer hinweg. Das Kind liegt auf dem Rücken und kann sich nicht rühren, die Zunge ist ein salziger Pfropfen, der sich am Gaumen festgesaugt hat. Die Flugzeuge landen. Eines kommt als brennende Fackel näher, zieht taumelnd über die Hinterhöfe davon und das Kind, unruhig atmend im Traum, will nicht wissen, wo es abstürzt, über den Friedhöfen an der Hermannstraße oder über dem Tempelhofer Feld, wo am Rande der Start- und Landebahnen der Schäfer mit seiner Herde wandert.
Im Winter ist es ruhiger. Nur das Mondlicht, das durch die oberen Fensterflügel auf das Kopfkissen fällt, ist eine Qual. Das Kind fürchtet den kalten Schein des Mondes, der sich stumm seinen Weg durch die Dunkelheit bahnt.
Sonntags, wenn die Morgendämmerung beginnt, regt sich nichts. Außer dem Lärm eines Flugzeugmotors dringt kein Laut durch die geschlossenen Fenster. Ein Blick auf Großmutters dürftige Möbel im fahlen Licht des anbrechenden Tages aus schlaftrunkenen Augen. Die Konturen im Raum sind in Bewegung, ein flimmerndes Grau haftet an jedem Gegenstand.
Am Rande des Nähtischs liegt ein Goldbarren. Sein durchdringendes Leuchten saugt das Flimmern auf. Das Kind hält den Kopf ins Kissen gepresst, in das klumpige, mit weißem Damast bezogene Federbett, das lange vor ihm einem anderen Kopf zum Ruhen bestimmt war. Es hält den Atem an und starrt auf das Wunder.
Wunder geschehen über Nacht. Meist sind es kleine Wunder, bei denen die Großmutter ihre Hand im Spiel hat, besonders in der Weihnachtszeit, wenn es überall knistert und duftet und irgendwo aus dem Bücherregal ein hellroter Marzipanapfel hervorscheint, der sich eingeschlichen hat in die eintönige Fassade dunkler Lederrücken, wo er das Kind anlockt und glücklich macht.
Das Leuchten des Goldes verschwimmt vor dem Blick, bevor die Lider sich schließen. Das Kind fällt in einen Schlaf, der reich an Träumen ist, so verworren, dass beim Erwachen nur noch das letzte Bild in den Schläfen pocht: Nasser Asphalt, wie gefroren in der Kälte des Neonlichts, das von nirgendwoher kommt und die ganze Welt ausfüllt, für immer.
Die Trostlosigkeit im Moment des Erwachens schürt zwiespältige Gefühle, die das Kind mit dem Dasein von jeher verknüpft, doch der anbrechende Tag lässt die Gewissheit, dem Unsagbaren ausgeliefert zu sein, verblassen.
Das Kind besinnt sich auf das Gold, wendet den Kopf. Auf dem Nähtisch erkennt es die Bernsteinbrosche der Großmutter, von Gestalt und Farbe einem riesigen Anisbonbon gleich. Das Kind atmet auf.
Als nächstes wird die Mutter durch die Tür rufen: „Steh auf Uli! Das Badezimmer ist frei.“
Am Abend zuvor, als Uli längst schlief, hat, aus dem Theater kommend, die Großmutter ihr Kleid und den Schmuck in der Stube abgelegt. Die Stube ist eine Kleiderkammer im Schlafzimmer der Großmutter und nur durch einen Vorhang vom übrigen Raum getrennt. Uli schläft im Bett des verstorbenen Großvaters, den sie nie gekannt. Der Nähtisch an der Rückwand ist klein und schmucklos. Kein Bild an den Wänden, auch kein bunter Kalender, kein Topf mit Azaleen auf der Fensterbank.
„Für Azaleen ist es im Winter nicht warm genug“, stellt Ulis Mutter bedauernd fest, nicht ohne Vorwurf, auf die Großmutter gemünzt, weil sie den braunen Kachelofen in ihrem Schlafzimmer nicht heizt.
„Wenn an allem gespart wird, warum nicht an Briketts? Die Federbetten sind warm genug“, bestimmt die Großmutter.
Die Federn sind flach gedrückt und manchmal werden sie klamm und schwer, wenn Uli in der Nacht atemlos die Treppen der vier Stockwerke nach oben hetzt und vor der ausgebrannten Wohnung ins Leere starrt.
„Du hast den Krieg doch gar nicht mitgemacht“, würde die Mutter sagen, deren Elternhaus im Wedding in Schutt und Asche versank. Deshalb verschweigt Uli den Traum.
Das Bett des Großvaters ist riesig und an seinem Kopfende ragt Großmutters Kleiderschrank bis zur Decke empor. Uli weiß von einer geheimen Tür hinter den Kleidern und Blusen. Vielleicht muss man, um sie zu öffnen, Großmutters Trauerhut aufsetzen. Über die schmale Krempe des Hutes wölbt sich ein schwarzes Netz aus feinen Maschen und innen, auf einem seidenen Band, ist ein Name eingestickt: Suse Herrguth. Es ist der Name einer Hutmacherin in der Hermannstraße.
„Aber ihren Laden gibt es nicht mehr“, hat die Großmutter gesagt.
Uli glaubt, Suse Herrguth ist eine Zauberin, die den Schlüssel zu der geheimen Tür hütet. Hinter der Tür breiten sich Wälder und Wiesen aus, so weit das Auge reicht. Man betritt sie auf Zehenspitzen und fliegt über gewaltige Baumkronen, als ließe man für immer das vergilbte Gras hinter sich, das die S-Bahngleise an der Siegfriedstraße säumt und unter windschiefen Birkentrieben vor sich hin magert, leere Bierflaschen und verrostete Fischdosen zwischen spärlichen Halmen.
Einmal hat man ein Kindermäntelchen gefunden, an steiler Böschung, wo keine Laternen stehen. Doch niemand vermisste das Mäntelchen und niemand vermisste ein Kind. Immerhin gab der Fund besorgten Eltern Anlass ihre Kinder zu warnen.
„Ein Fremder, der Kinder anspricht“, weiß Uli, „hat kein Gesicht. Begegnet man ihm, muss man davonlaufen.“ Aber Uli hat Angst, dass ihre Beine versagen, wie im Traum, wenn bleischwere Gewichte an ihren Füßen hängen. Doch anvertrauen will sie sich keinem.
Auch über die andere Angst spricht sie nicht, die wie ein unsichtbarer Krake über der Stadt liegt.
„Sorgfältig die Hände waschen und kein Leitungswasser trinken!“ hieß es eines Tages. Die Eltern schüttelten verwundert den Kopf: „Was soll man denn sonst trinken?“
Zur Warnung hängt das Plakat mit dem verkrüppelten Mädchen an jeder Litfaßsäule. Das Mädchen, von hinten zu sehen, könnte jedermanns Kind sein. Ganz alleine steht es in einem langen Flur, weit entfernt vom anderen Ende, wo Tageslicht durch einen Ausgang fällt. Jeder Schritt des Kindes mit den geschienten Beinen ist eine Qual, das ist nicht schwer zu erkennen.
„Die Krankheit kommt über Nacht“, glaubt Uli und zwingt sich mit ausgestreckten Beinen einzuschlafen. Nur dann wird sie aufrecht gehen können nach dem Erwachen, trotz gelähmter Beine, an Krücken zwar, wie das Mädchen auf dem Plakat, aber aufrecht. Die Impfung gegen die Kinderlähmung haben die Eltern verweigert.
„Erst einmal abwarten“, haben sie entschieden, „und nicht alles mitmachen. Zuerst TBC, dann die Pocken und jetzt Kinderlähmung!“
„Zuviel Gift!“ findet auch die Großmutter, die sich in alles einmischt. „Wer weiß, was im Körper hängen bleibt.“
So vergehen für Uli die Nächte. Warten, bis das verkrüppelte Mädchen sich im Nichts jenes traumlosen Moments auflöst, mit dem der Schlaf beginnt. Wenn sie erwacht, denkt sie als Erstes an ihre Beine, spielt vorsichtig mit den Zehen und bleibt mit angewinkelten Knien unter der Decke liegen. Dann ist ihr, als sei sie noch einmal davongekommen.
Ihrem Bruder hat es nichts ausgemacht nicht geimpft zu werden. Er hat keine Angst, er hat keine Träume, die seinen Schlaf vergiften. Sein Bett steht in einer notdürftig beheizten Kammer, die Wärme kommt aus einem elektrischen Porzellanofen mit rotglühenden Drähten, der wie ein Bienenkorb aussieht. Aus einem Fenster mit einfacher Verglasung geht der Blick in einen Lichtschacht. Unten im Schacht steht ein Kasten mit Streugut, sonst nichts. Kein Sonnenstrahl dringt in die Tiefe. Nur die Flugzeuge werfen tagsüber einen flüchtigen Schatten bis auf den Grund und das Dröhnen der Motoren lässt die Fensterscheibe klirren. Manchmal geht in der Nacht die Flurbeleuchtung im Seitenflügel an und die Schritte eines Hausbewohners hallen an den Wänden wider, danach das ungedämpfte Knacken und Krachen eines Türschlosses.
Einmal, hat Ulis Bruder gesagt, habe jemand durch eines der Fenster im Aufgang „Mörder!“ gebrüllt, doch niemand hätte sich gerührt. Abgeprallt an kahlen Mauern verfing sich der Ruf im Schacht. Bis zum Morgengrauen hätte der Bruder in das Dunkel gelauscht, aber im Schacht blieb alles still.