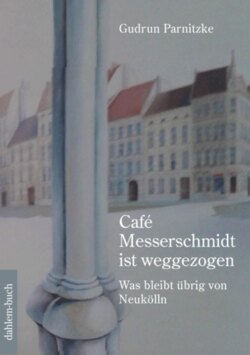Читать книгу Café Messerschmidt ist weggezogen - Gudrun Parnitzke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5. Fremdes Pflaster
Uli streicht mit dem Zeigefinger über die geschliffene Oberfläche von Großmutters Bernsteinbrosche. Der riesige Anisbonbon. Anis wärmt. Bernstein wärmt auch, doch nur, wenn er auf der Haut liegt.
Die Großmutter trägt die Brosche am Ausschnitt ihres rohseidenen Kleides in Violett, das der Schneidermeister Großmutters gebeugter Haltung angepasst hat. Vorne ist es kürzer als hinten, damit der Saum nicht die Schuhspitzen berührt, und dennoch tief genug, um die Hässlichkeit der orthopädischen Maßschuhe ein wenig zu verdecken.
Zum Schneidermeister fährt die Großmutter mit der S-Bahn nach Lichterfelde-West.
Uli hüpft an Großmutters Seite über das bucklige Straßenpflaster im Gardeschützenweg, ihre neue Puppe im Arm. Auch die Puppe braucht ein Kleid. Uli hüpft über weiße Blütenblätter, die auf dem Gehweg liegen. Die Zweige der Jasminsträucher biegen sich über schmiedeeiserne Gartenzäune. Beim Hüpfen verliert die Puppe ihren Schlüpfer. Ein großer Mann hat Uli eingeholt und hält den Schlüpfer zwischen Daumen und Zeigefinger hoch.
„Gehört das deiner Puppe?“
Beschämt schüttelt Uli den Kopf.
„Also, so etwas!“ Die Großmutter entschuldigt sich und nimmt unter routiniertem „Tausend Dank!“ dem Mann das Höschen ab. Der lüftet seinen Strohhut und geht mit großen Schritten davon.
„Siehst du“, sagt die Großmutter, laut genug, damit der Mann es noch hören kann: „Das ist ein Kavalier!“
Da schämt sich Uli noch mehr, obwohl sie nicht einmal weiß was Kavalier bedeutet, ein Wort, das zu einer ganz eigenen Großmuttersprache zu gehören scheint. „Tausend Dank!“ oder „Verbindlichsten Dank!“ Das sagt nur die Großmutter. Und nur sie findet etwas „kolossal“ oder „famos“ oder „vorzüglich“. Die Mutter sagt niemals „vorzüglich“. Manchmal ruft die Großmutter „Ach, du Grundgütiger!“ aus, schaut zum Himmel auf und faltet die Hände vor der Brust wie die Mutter Gottes an einem Tiroler Kreuzweg. So viel Reiseerfahrung hat Uli schon. Auch das Wort „Diarrhö“ hat Uli nur von der Großmutter gehört. „Ich habe Diarrhö.“ Offenbar eine seltene Großmutterkrankheit, die mit einem ausgehauchten Ö endet.
In der hellgrauen Villa gibt es viel Stuck an den Wänden, im Flur Marmor, wenngleich etwas vergilbt, stumpf geworden und rissig. Die Großmutter läutet an der Tür zur Schneiderei im Erdgeschoss. Ein goldener Klingelknopf unter goldenem Namensschild, auf dem Weber steht.
Uli, neugierig abwartend, als die Tür aufgeht, mustert den zierlichen Mann mit dem kahlen Kopf.
„Ich bin Herr Weber“, stellt er sich Uli vor. „Lustig, nicht wahr?“
Der Schneidermeister Weber kichert und beobachtet, ob das Kind den Witz begreift, doch Uli, unsicher, was der Mann von ihr erwartet, verzieht keine Miene.
Mit langen, blassen Fingern nimmt der Schneidermeister bei der Puppe Maß, betastet den Puppenleib. Uli betrachtet die Finger zum Betasten von Leibern und Stoffen. Sie bewegen sich sicher und flink.
Frau Weber ist dünn, hat flache Brüste und ein schiefes Gesicht. Sie riecht aus dem Mund, wenn sie mit dem Gatten lacht. Zu lachen gibt es viel, denn der Gatte ist immer zu Scherzen aufgelegt.
„Schau mal nach oben!“ fordert er Uli auf. Er zieht an einer goldenen Kordel und versetzt ein rundes Mobile in Bewegung. Bunt gefiederte Vögel mit goldfarbenen Glaskörpern schwirren unter einer Stuckrosette im Kreis. Uli, die sie längst entdeckt hatte, starrt gebannt auf ihren Flug. Sie erschrickt vor dem durchdringenden Zwitschern einer Lerche, das zwischen den Lippen von Herrn Weber hervorquillt. Die Großmutter, in steifer Pose auf einem echten Rokokosessel, klatscht in die Hände.
„Bravo!“ ruft sie und sagt, das sei ganz famos. Uli solle auch klatschen. Aber Uli verschränkt die Arme hinter ihrem Rücken. Herr Weber entfernt ein grünes Plättchen von seinem Gaumen: die Lerche.
Den Rokokosessel, erzählt er, habe er 1945 aus der brennenden Requisitenkammer seines Theaters gerettet. Ja, früher, schwärmt er, da habe er die Lady Milford und das Fräulein von Barnhelm eingekleidet und seine liebe Frau habe hunderte Rüschen an den seidenen Roben gebügelt, vor jeder Vorstellung aufs Neue. Das sei ein Akt für sich gewesen, ohne die leichten elektrischen Bügeleisen, die erst nach dem Krieg aufkamen. Und an die ganz alten mit dem glühenden Bolzen, ohne Regler, mag er schon gar nicht denken.
Sie hätte einen Bogen Löschpapier genommen, um die Hitze zu prüfen, teilt die Großmutter ihre Erfahrungen mit. Frau Weber behauptet, die richtige Temperatur im Gefühl gehabt zu haben. Beim Theater müsse alles schnell gehen. Zeit und Präzision seien das A und O, und Gefühl das I-Tüpfelchen dabei. Auch beim Bügeln.
„Ich habe es mit Spucke kontrolliert“, sagt sie und betrachtet ihre vernarbten Fingerkuppen.
Herr Weber legt eine Schallplatte auf ein altes Grammofon mit einem Schalltrichter, kurbelt das Gerät an und spitzt genießerisch den Mund, den Kopf im Takt eines Walzers wiegend. Die rechte Hand um die dürre Taille seiner Frau gelegt schwingt er sie im Kreis herum, verschmilzt mit ihr zu einem Körper, während die Beine des Paares sich wie dünne mechanische Werkzeuge, die passgenau aufeinander abgestimmt sind, wirbelnd über das ausgetretene Parkett bewegen.
„Was Sie alles können!“ Die Großmutter findet auch diesen Teil der Vorstellung famos. „Meine Füße wollen nicht mehr, ich bin ein Krüppel“, erklärt sie. Im Übrigen hätte sie auch als junge Frau nicht oft getanzt.
„Sieh einer an! Wo Sie doch aus Neukölln sind!“ wundert sich Herr Weber. In Rixdorf ist Musike, zitiert er einen uralten Schlager. „Kindl-Festsäle, der Rollkrug, die Neue Welt in der Hasenheide, das Ballhaus Orpheum“, zählt er auf. „Sie haben die Amüsiermeile doch vor der Haustür gehabt.“
„Ja, und die Friedhöfe auch!“ Dazu lächelt die Großmutter mit gekräuselten Lippen. Und dann strafft sie den Rücken: „Außerdem bin ich aus Schlesien.“
Sie betont oft, dass sie aus Schlesien ist und Neukölln nicht als ihre Heimat betrachtet und lebt doch schon so lange dort. Jung verheiratet nach Neukölln gezogen kam sie in eine Stadt, die noch nicht zu Berlin gehörte, die gerade ihren alten Namen Rixdorf abgestreift hatte und damit zugleich alles Unseriöse, nach billigem Vergnügen Klingende. Und in der die Stadtväter größten Wert darauf legten, dass es hier nicht nur Tanzpaläste und „Musike“, sondern auch ein Tiefbauamt gab. Einige Jahre später wurden die ersten U-Bahn-Linien geplant und mit dem U-Bahnhof Hermannplatz, in dem sich zwei Linien auf verschiedenen Ebenen kreuzen, entstand unter der Erde ein architektonisches Wunderwerk, das seinesgleichen suchte.
„Mein Mann war Ingenieur beim Tiefbauamt“, sagt die Großmutter. „Stadtentwässerung.“ Und in der Hasenheide verkehrte sie nicht, das sei nicht ihr Milieu gewesen. Was aber das Tanzen betrifft: Sie mache sich persönlich nichts daraus, sie würde lieber ins Theater gehen, wenn es ein gutes Stück gibt. Und lesen natürlich. Und dann, etwas verschämt, gesteht die Großmutter, dass sie gerne schreiben würde.
„Schriftstellerin, das wäre etwas gewesen!“
Den Entwurf einer Liebesgeschichte mit dem Titel Vom Glück zum Leid hatte sie im Wäscheschrank zwischen jenen Teilen ihrer Aussteuer aufbewahrt, die nie in Gebrauch genommen wurden: einem Tafeltuch für vierundzwanzig Personen und der doppelten Anzahl von Servietten, alles mit ihrem Monogramm. Es hätte die Grenzen der kleinen Beamtenwohnung in der Neuköllner Leinestraße gesprengt. Hin und wieder schüttelt der Vater noch immer den Kopf: Nur das Nötigste habe man aus der elterlichen Wohnung retten können, als das Wohnhaus unter dem Artilleriebeschuss der Roten Armee in Flammen aufging, aber das unnütze Tafeltuch und das handgeschriebene Manuskript fanden sich unversehrt unter dem Nötigsten wieder.
Frau Weber hat der Großmutter das fertige Kleid übergestreift, hurtig steckt sie den Saum ab und Herr Weber tänzelt mit prüfendem Blick um die Großmutter herum, begeistert davon, wie das Kleid trotz ihres gebeugten Oberkörpers die Stattlichkeit der Trägerin betont.
„Nur noch der Saum!“ Frau Weber tröstet Uli, die sich langweilt, mit ein paar Keksen. Trostkekse, die nach Mottenpulver schmecken.
„Haben die sonst nichts zu trösten?“ Uli sieht sich nach Spuren von Enkelkindern um, entdeckt aber keine.
Angekommen am S-Bahnhof Neukölln dampft das Pflaster nach einem Regenschauer. Die Hitze hat sich zwischen den Fassaden der Mietshäuser gestaut und drückt in die kalten Kellerschächte, aus denen der Geruch armseligen Hausrats entweicht.
Uli läuft auf der Bordsteinkante entlang.
„Pass auf die Laternen auf!“ warnt die Großmutter sie.
Uli schleckt eine Kugel Schokoladeneis aus der Waffeltüte. Die winzige Eisdiele von Herrn Rendez in der Emser Straße liegt ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt, gleich hinter der Wechselstube, wo sie auch die Kundschaft aus dem Osten anlockt. Nur vier zierliche runde Tische mit roten Plastiksesseln haben neben der Theke Platz, aus einem Lautsprecher an der Wand quäkt es Bella Bimba. Alle fünf Minuten ein anderer Schlager.
Herr Rendez ist ein stattlicher Mann, ansehnlich mit seinen dichten, dunklen Locken und dem schwarzen Schnauzbart.
„Französischer Name“, sagt die Mutter oft und dann, mit einem nasalen N: „Rändee. Bestimmt Hugenotte.“ Französisch war ihre erste Fremdsprache auf dem Lyzeum gewesen.
Die eleganten, sicheren Handbewegungen von Herrn Rendez beim Abfüllen der Eiswaffeln mit silbernen Kugelzangen oder einem Spatel könnten die eines Chirurgen sein. Im Winter zieht er den Hasen das Fell vom Leib und zerlegt Wild und Geflügel. Die geschossenen Rehe hängen kopfüber an einem Haken neben dem Schaufenster, die Vorderläufe zusammengebunden, damit sie nicht vom Wind bewegt werden, als wäre das Tier im Traum auf der Flucht. Aus dem Maul der Rehe tropft Blut in eine Zellophantüte und sammelt sich zu einer trüben braunen Pfütze.
„Wie war es in Lichterfelde?“ fragt die Mutter. Sie fürchtet, das Kind könnte mit Bestürzung die Kluft zwischen Neukölln und Lichterfelde, den Gärten dort und Villen, erkennen und unglücklich darüber sein.
„Es war langweilig“, mault Uli. Das Schönste sei der Heimweg vom Bahnhof Neukölln gewesen, wegen der Eistüte, die es bei Herrn Rendez gibt. „Rändee“, verbessert sie die Mutter.
Großmutters neues Kleid hängt im Kleiderschrank und verbreitet einen zarten Duft von Uralt Lavendel. Die flachen grünen Flaschen haben ein geschwungenes Profil und einen goldenen Verschluss. Wenn sie leer sind, gehören sie Uli. Ein paar Tropfen lässt die Großmutter übrig. Auf welker Haut entfalten sie den müden Duft des Alters, auf junger Haut riechen sie würzig und leicht bitter. Uli füllt die Flaschen mit Wasser, schüttelt den Inhalt durch, prahlt: „Mein Parfum!“