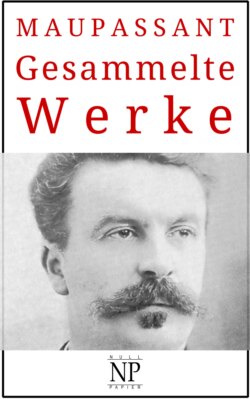Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 20
Mondschein
ОглавлениеFrau Julie Roubère erwartete ihre ältere Schwester, Frau Henriette Létoré, die von einer Schweizer Reise zurückkehrte.
Létorés waren seit etwa fünf Wochen verreist, und Frau Henriette hatte ihren Gatten allein nach seiner Besitzung bei Calvados zurückkehren lassen, wo er geschäftlich zu tun hatte, um selbst auf ein paar Tage nach Paris zu gehen und ihre Schwester zu besuchen.
Es war schon Abend. In dem kleinen bürgerlichen Wohnzimmer war es bereits recht dämmerig. Frau Roubère saß am Fenster und las zerstreut, um bei jedem Geräusche den Kopf zu heben.
Endlich klingelte es und ihre Schwester erschien in ihren wallenden Reisekleidern. Sie flogen sich gleich in die Arme, noch ehe sie sich wiedererkannt hatten, und hielten mit Küssen nur inne, um gleich wieder anzufangen.
Dann sprachen sie und befragten sich über ihr Befinden, ihre Familie und tausend andere Dinge; sie schwatzten hastig, mit eiligen, abgerissenen Worten und sprangen vom einen zum anderen über, während Henriette ihren Schleier und Hut ablegte.
Die Nacht brach herein. Frau Roubère schellte nach der Lampe, und als sie gebracht war, blickte sie ihre Schwester aufmerksam an und wollte sie von Neuem umarmen. Aber plötzlich hielt sie betroffen, starr und sprachlos inne: auf den Schläfen ihrer Schwester schlängelten sich zwei große weiße Locken. Ihr übriges Haar war kohlschwarz und von tiefem Glanze, aber da – nur da – an den beiden Seiten zogen sich zwei Silberflechten hin, die sich alsbald in der dunkelen Masse verloren. Und sie war doch kaum vierundzwanzig Jahre alt, und dies war vor ihrer Schweizer Reise auch nicht gewesen. Frau Roubère starrte sie unverwandt an; die Tränen waren ihr nahe, als ob irgend ein geheimnisvolles, furchtbares Unglück über ihre Schwester hereingebrochen wäre.
– Was hast du, Henriette? fragte sie.
– Nichts, antwortete die Gefragte mit traurigem, krankem Lächeln. Ich versichere dir, nichts. Du blickst so auf meine weißen Haare?
Frau Roubère fasste sie ungestüm an der Schulter und blickte sie forschend an.
– Was hast du? wiederholte sie. Wenn du die Unwahrheit sagst – ich merk’ es sogleich.
Sie standen sich Aug’ in Auge gegenüber. Frau Henriette war blass geworden, als ob sie ohnmächtig würde; sie senkte die Augen, deren Winkel sich mit Tränen füllten.
– Was ist dir zugestoßen? wiederholte ängstlich die Schwester. Was sagst du? Gib mir Antwort!
Frau Henriette schien besiegt und legte schluchzend die Stirn auf die Schulter ihrer jüngeren Schwester.
– Ich habe einen Liebhaber, flüsterte sie.
Dann, als sie sich ein wenig beruhigt hatte und das krampfhafte Schluchzen nachließ, begann sie plötzlich mitteilsam zu werden. Es war, als ob sie ein lastendes Geheimnis loswerden und ihr Herz einem teuren Menschen ausschütten wollte.
Die beiden Frauen schritten, sich mit verschlungenen Händen haltend, auf das Sofa zu, das im Grunde des Zimmers stand, und ließen sich darauf nieder. Die jüngere Schwester schlang ihren Arm um den Hals der älteren und zog deren Kopf an ihr Herz, während sie aufmerksam zuhörte.
– Ja, begann jene, ich bekenne mich ohne Umschweife schuldig. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Seit jenem Tage bin ich wie toll. Sieh du dich nur vor, Kleine, pass auf dich auf. Wenn du wüsstest, wie schwach wir sind, wie leicht wir nachgeben, wie schnell wir fallen! Ein Nichts, ein ganzes kleines Nichts genügt, eine zärtliche Regung, eine jener plötzlichen Anwandlungen von Schwermut, die unsre Seele durchziehen, ein Bedürfnis, die Arme aufzutun, zu küssen und zu herzen, wie wir es alle in gewissen Augenblicken verspüren.
Du kennst meinen Gatten, und du weißt, wie lieb ich ihn habe, aber er ist gesetzt und verständig, und ahnt nichts von all den zärtlichen Regungen eines Frauengemütes. Er ist sich immer gleich, immer gütig und lächelnd, immer gefällig, immer vollkommen. O wie gern möchte ich, dass er mich manchmal jäh in seine Arme risse, dass er mich mit jenen langsamen und tiefen Küssen beglückte, die zwei Seelen vereinen und wie stumme Liebesschwüre sind; wie wünschte ich, dass er sich manchmal vergäße und Schwächen zeigte, dass er ein Bedürfnis nach mir und meinen Liebkosungen, meinen Tränen hätte!
Das alles ist dumm, wie er sagt, aber wir sind doch nun einmal so. Was können wir dafür?
Und doch ist es mir nie in den Sinn gekommen, ihn zu betrügen. Heute ist es nun so gekommen, ohne Liebe, ohne Grund, ohne Ursache, nur weil es in einer Mondnacht am Vierwaldstättersee war.
Den ganzen Monat lang, wo wir auf Reisen waren, hatte mir mein Mann mit seiner ewigen Gleichmütigkeit alle Begeisterung genommen, alles Hochgefühl erstickt. Wenn wir so morgens bei Sonnenaufgang die steilen Hänge im Galopp herunterfegten, vier Pferde vor der Postkalesche, und ich durch den durchsichtigen Frühnebel hindurch die langgestreckten Täler und Wälder, die Flüsse und Städte erblickte, und entzückt in die Hände klatschte und sagte: »Wie schön ist das! Mein Freund, küsse mich doch!« – dann antwortete er mit wohlwollendem, frostigen Lächeln und zuckte dabei mit den Achseln: »Das ist doch kein Grund, sich zu küssen, weil die Landschaft dir gefällt!«
So etwas erkältet mich immer bis ins Herz hinein. Denn mir scheint, wenn man sich lieb hat, muss man immer Lust haben, sich noch mehr zu lieben, wenn ein solches Naturspiel uns bewegt.
Zudem hatte ich manchmal poetische Wallungen, die er durch seine bloße Anwesenheit unterdrückte. Was soll ich dir sagen? Ich war nicht viel anders als ein Kessel voll Dampf, der luftdicht verschlossen ist.
Eines Abends, wir waren schon seit vier Tagen in einem Hotel in Fluelen, hatte Robert etwas Migräne und war darum gleich nach dem Essen zu Bett gegangen; und ich ging ganz allein am Rande des Sees spazieren.
Die Nacht war zauberhaft. Der Vollmond stand hoch am Himmel; die großen Berge mit ihren Schneehäuptern waren mit Silber umsäumt, und über das tiefschwarze Wasser gingen leichte Lichtschauer. Die Luft war weich, sie war von jener bezaubernden Weiche, die uns schwach bis zum Umfallen macht und uns ohne Veranlassung zärtlich stimmt. Wie ist die Seele in solchen Momenten empfindsam! Wie bebt sie! Wie leicht regt sie sich dann und wie stark empfindet sie alles!
Ich setzte mich ins Gras und ließ mein Auge auf diesem großen, träumerischen, bezaubernden See ruhen, und etwas Seltsames ging in mir vor. Ich empfand plötzlich ein unersättliches Verlangen nach Liebe, eine Empörung gegen die trübe Plattheit meines Lebens. Sollte es mir nie vergönnt sein, am Arm eines geliebten Mannes das hohe Ufer eines mondbeglänzten Sees zu umwandeln? Würde ich nie jene tiefen, süßen, betörenden Küsse auf mich eindringen fühlen, wie man sie in solchen Mondnächten austauscht, die von Gott eigens für die Liebe geschaffen scheinen? Sollte ich nie in mondheller Sommernacht von trunkenen Armen zitternd umspannt werden?
Und ich begann zu weinen, wie eine Törin. Da – hörte ich Geräusch in meinem Rücken: ein Mann stand hinter mir und blickte mich an. Als ich den Kopf wandte, erkannte er mich und kam näher. »Sie weinen, gnädige Frau?« fragte er zartfühlend. Es war ein junger Advokat, der mit seiner Mutter reiste und den wir schon mehrfach getroffen hatten. Seine Augen hatten oft auf mir geruht.
Ich war so außer Fassung, dass ich nicht wusste, was ich sagen und denken sollte. Ich stand auf und sagte, dass ich krank wäre. Er schritt ungezwungen und ehrerbietig neben mir her und sprach von unserer Reise. Alles, was ich empfunden hatte, deutete er sich. Alles, weswegen ich zitterte, verstand er wie ich, besser als ich. Und plötzlich sagte er mir Verse, Verse von Musset. Ich brach in Tränen aus, von unaussprechlicher Sehnsucht gepackt. Mir war, als wären die Berge droben, der See und der Mondschein voll unvergänglich süßer Musik…
Und so kam es, ich weiß selbst nicht wie, ich weiß selbst nicht warum, es war wie in einer Art von Traumwachen…
Was ihn betrifft… ich habe ihn nur noch am nächsten Tage gesehen, es war bei der Abfahrt. Er hat mir seine Karte gegeben…
Frau Létoré sank erschöpft in die Arme ihrer Schwester und stieß Seufzer auf Seufzer, fast Schreie aus.
Und Frau Roubère sagte ernst und gesammelt, aber sanft:
– Siehst du, große Schwester, oft ist es nicht ein Mann, den wir lieben, sondern die Liebe. Und an diesem Abend war der Mondschein dein wahrer Geliebter.
*