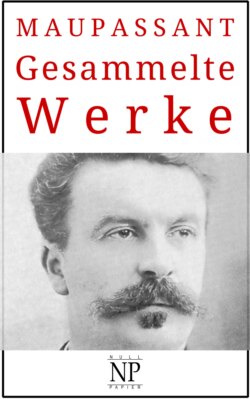Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 23
Angeführt
Оглавление– Ja, die Weiber!
– Nun, was ist denn mit den Weibern?
– Je nun, es gibt keine geschickteren Tausendkünstler, als sie. Sie legen uns bei allem und jedem herein, mit und ohne Grund, oft aus bloßer Freude am Ränkespinnen. Sie überlisten uns mit unglaublicher Naivetät, mit erstaunlicher Keckheit und unnachahmlicher Feinheit. Sie betrügen uns vom Morgen bis in die Nacht, alle ohne Ausnahme; die anständigsten, die rechtschaffensten, die sinnbegabtesten – alle sind Ränkeschmiede.
Freilich, das muss man sich sagen, nicht selten werden sie dazu gezwungen. Der Mann hat ohne Zweifel oft eigensinnige Launen, Launen wie ein Blöder, und tyrannische Gelüste. Ein Mann trifft in seinem Hause jeden Augenblick die lächerlichsten Anordnungen. Er ist voller Narrheiten, denen seine Frau schmeichelt, um sie zu hintertreiben. Sie macht ihm weis, dass etwas so und so viel kostete, denn wenn es mehr kostete, gäbe es Spektakel. Und sie weiß sich immer geschickt aus der Klemme zu ziehen, und dies durch so einfache und niederträchtige Mittel, dass wir die Arme sinken lassen, wenn wir zufällig dahinter kommen. Dann sagen wir verblüfft: »Wie habe ich das nur nicht merken können!?«
*
Der Mann, der so sprach, war ein alter Minister des Kaiserreiches, Graf von L…, ein sehr verschlagener Mann, wie es hieß, und von überlegenem Geiste.
Eine Gruppe von jungen Leuten umstand ihn und hörte aufmerksam zu.
Mich, begann er von Neuem, hat einmal eine kleine Bürgersfrau in ebenso drolliger wie meisterhafter Weise angeführt. Ihnen zur Lehre will ich die Geschichte erzählen.
Ich war damals Minister des Auswärtigen und hatte die Gewohnheit, jeden Morgen einen langen Spaziergang nach den Champs Élysées zu machen. Es war im Monat Mai; ich ging und sog in vollen Zügen den angenehmen Duft des ersten Grüns ein.
Bald wurde ich gewahr, dass mir Tag für Tag eine allerliebste kleine Person begegnete, eines jener reizenden, graziösen Geschöpfe, die den Stempel von Paris tragen. Ob sie hübsch war? Ja und nein. Schön gewachsen? Nein, besser als das. Die Taille war zu schlank, die Schultern zu grade, die Brust zu gewölbt. Aber wenn auch, ich ziehe diese köstlichen lebenden Puppen mit ihrer rundlichen Form dem großen Knochengerüst der Venus von Milo vor…
Und dann trippelte sie auf eine unnachahmliche Weise, und das bloße Rauschen ihrer Röcke lässt es uns heiß und kalt durch die Glieder rieseln… Es sah aus, als blickte sie mich im Vorübergehen an. Aber diese Kreaturen sehen immer nach allem Möglichen aus, und man weiß doch nie…
Eines Morgens erblickte ich sie auf einer Bank sitzend; sie hatte ein aufgeschlagenes Buch in der Hand. Schnell setzte ich mich neben sie und in fünf Minuten waren wir die besten Freunde. Dann begrüßten wir uns jeden Morgen lächelnd: »Guten Tag, meine Dame!« – »Guten Tag, mein Herr!« und darauf wurde geplaudert. Sie verriet mir, dass sie die Frau eines Beamten sei, dass das Leben traurig, die Vergnügungen selten und die Sorgen häufig wären, und tausend andere Dinge mehr.
Ich sagte ihr zufällig und vielleicht auch aus Eitelkeit, wer ich wäre, und sie spielte die Erstaunte sehr gut.
Tags darauf besuchte sie mich im Ministerium und kam danach so oft wieder, dass die Diener im Ministerium sie bald kannten und sich, wenn sie erschien, ihren Namen, den sie ihr gegeben, gegenseitig zutuschelten. Sie hatten sie »Frau Léon« getauft; Léon ist nämlich mein Vorname.
So sah ich sie drei Monate lang jeden Morgen, ohne ihrer je überdrüssig zu werden: so schön verstand sie ihre Zärtlichkeiten zu variieren und zu tönen. Aber eines Tages merkte ich, dass ihre Augen rot waren und von zurückgehaltenen Tränen schimmerten; sie sprach auch nur widerwillig und schien in geheime Gedanken versunken.
Ich bat und beschwor sie, mir den Kummer ihres Herzens anzuvertrauen, und sie stammelte schließlich zusammenschaudernd: »Ich… ich bin guter Hoffnung.« Dann fing sie an zu schluchzen. Ich schnitt ein grimmes Gesicht und wurde blass, wie man es bei dergleichen Anlässen tun soll. Sie machen sich gar keinen Begriff davon, welchen unangenehmen Schreckschuss einem die Ankündigung einer solchen unerwarteten Vaterschaft einjagt. Aber früher oder später werden Sie’s ja auch zu erfahren haben… Ich stotterte also verlegen: »Aber… aber du bist doch verheiratet.«
»Ja«, antwortete sie, »aber mein Mann ist seit zwei Monaten in Italien und wird noch lange nicht zurückkommen.«
Ich wollte die Verantwortlichkeit um jeden Preis von mir abwälzen und sagte: »Du musst sogleich zu ihm hin.« Sie errötete bis in die Schläfen und senkte die Lider. »Ja… aber…« Sie wagte nicht weiter zu sprechen oder wollte auch nicht.
Ich verstand jedoch und übergab ihr in schonendster Form ein Couvert mit dem nötigen Reisegeld.
*
Acht Tage später erhielt ich einen Brief aus Genua, die Woche darauf einen aus Florenz, dann aus Livorno, Rom und Neapel. Sie schrieb mir: »Es geht mir gut, Geliebter, nur sehe ich schauderhaft aus. Ich möchte nicht, dass du mich siehst, eh’ alles vorüber ist; du würdest mich sonst nicht mehr mögen. Mein Mann ahnt nichts. Da sein Auftrag ihn noch lange hier im Lande hält, werde ich erst nach dem Ereignis nach Frankreich zurück können.«
Und nach acht Monaten etwa erhielt ich aus Venedig nur diese Worte: »Es ist ein Junge.«
Einige Zeit darauf erschien sie plötzlich des Morgens in meinem Arbeitszimmer. Sie war frischer und hübscher denn je und warf sich mir an die Brust. Und unsre alte Zärtlichkeit wurde fortgesetzt.
Als ich das Ministerium verließ, kam sie in mein Hotel in der Rue Grenelle. Sie sprach mir oft von ihrem Kinde, aber ich hörte garnicht hin; denn das ging mich nichts an. Ich übergab ihr hin und wieder nur ein recht hübsches Sümmchen und sagte einfach: »Lege das für ihn an.«
So vergingen zwei Jahre, während sie mir immer eindringlicher von dem kleinen Léon erzählte. Zuweilen weinte sie auch und sagte: »Du liebst ihn nicht, du willst ihn nicht einmal sehen. Wenn du wüsstest, welchen Kummer du mir damit bereitest!«
Schließlich setzte sie mir so stark zu, dass ich ihr eines Tages zusagte, am nächsten Morgen nach den Champs Élysées zu kommen, wenn sie mit dem Kinde dort spazieren ginge.
Aber in dem Augenblick, wo ich gehen wollte, befiel mich eine seltsame Unschlüssigkeit. Der Mann ist schwach und dumm; was wusste ich, was in meinem Herzen vorgehen würde, wenn ich dieses kleine Wesen – meinen Sohn! erblickte. Vielleicht würde mein Herz sich regen.
Ich hatte bereits den Hut auf dem Kopfe und die Handschuhe angestreift; ich warf die Halbschuhe wieder auf mein Schreibpult und meinen Hut auf einen Stuhl. »Nein«, sagte ich zu mir, »ich gehe ganz bestimmt nicht. Das ist verständiger!«
Plötzlich öffnete sich die Tür und mein Bruder trat ein. Er übergab mir einen anonymen Brief, den er diesen Morgen erhalten hatte und der folgendermaßen lautete: »Setzen Sie Ihren Bruder, den Grafen L…, davon in Kenntnis, dass die kleine Frau aus der Rue Cassette sich in unverschämtester Weise über ihn lustig macht. Erkundigungen über sie einzuziehen, wäre angezeigt.«
Ich hatte nie und mit keinem Menschen von dieser Geschichte gesprochen. Ich war höchst verblüfft und erzählte meinem Bruder den Hergang der Sache von Anfang bis zu Ende. »Was mich betrifft«, setzte ich hinzu, »so will ich nichts mehr damit zu tun haben. Du würdest mich aber sehr verbinden, wenn du Nachforschungen darüber anstellen wolltest.« Als mein Bruder gegangen war, sagte ich mir: »Worin kann sie mich betrügen? Sie hat vielleicht noch andere Liebhaber. Aber was geht das mich an? Sie ist jung, frisch und hübsch, mehr verlange ich nicht von ihr. Sie scheint mich zu lieben und kostet im Ganzen nicht viel. Ich verstehe es wirklich nicht.«
Mein Bruder kam bald zurück. Auf der Polizei hatte man ihm über ihren Gatten die besten Auskünfte gegeben. »Beamter im Ministerium des Innern, korrekt, wohl ackreditiert, wohlgesinnt, hat aber eine Frau, die weit über ihre bescheidenen Verhältnisse zu leben scheint.« Das war alles.
Hierauf war mein Bruder in ihre Wohnung gegangen, und da er hörte, dass sie aus wäre, hatte er sich an den Portier gewandt und diesen durch Gold zum Reden gebracht. »Frau D… eine sehr brave Frau und Herr D… ein sehr braver Mann, nicht stolz, nicht reich, aber freigebig.«
Um doch etwas zu sagen, fragte mein Bruder:
– Wie alt ist ihr Kleiner jetzt?
– Aber sie hat ja gar keine Kinder, Herr.
– Wie? Sie hat doch den kleinen Léon?
– Nein, mein Herr, Sie täuschen sich.
– Aber der, den sie auf ihrer italienischen Reise bekam, es ist jetzt zwei Jahre her.
– Sie ist nie in Italien gewesen, mein Herr. Seit fünf Jahren, wo sie hier wohnt, hat sie das Haus nicht verlassen.
Mein Bruder war betroffen, fragte von Neuem und sondierte so tief wie möglich. Aber es blieb dabei: Kein Kind, keine Reise.
Ich war höchst erstaunt, ohne doch den Sinn dieser Komödie recht zu verstehen.
– Ich will Klarheit in der Sache haben, sagte ich, und dies sogleich. Ich werde sie bitten, morgen hierher zu kommen und du wirst sie an meiner Statt empfangen. Wenn sie mich angeführt hat, wirst du ihr diese zehntausend Franks übergeben und ich will sie nicht mehr sehen. Ich fange wahrhaftig an, ein Haar darin zu finden.
*
Was glauben Sie wohl? Vorher hatte es mich verstimmt, dass ich von dieser Frau ein Kind hatte, und jetzt war ich ärgerlich, beschämt und gekränkt, dass ich keins hatte. Ich war jeder Verpflichtung und Sorge ledig und doch wütend.
Mein Bruder empfing sie am nächsten Tage in meinem Arbeitszimmer. Sie trat lebhaft ein, wie gewöhnlich, lief ihm mit offenen Armen entgegen und stutzte erst, als sie ihn erkannte.
Er grüßte und entschuldigte sich.
– Ich bitte um Entschuldigung, sagte er, wenn ich Ihnen an Stelle meines Bruders entgegentrete. Aber er hat mich beauftragt, Sie um eine Auskunft zu bitten, die er nicht gerne selbst erhalten möchte.
Dann blickte er ihr scharf ins Auge und sagte plötzlich:
– Wir wissen, dass Sie kein Kind von ihm haben.
Sie war einen Augenblick stutzig, gewann aber sogleich die Fassung wieder, setzte sich und blickte diesen Richter lächelnd an.
– Nein, ich habe kein Kind, antwortete sie einfach.
– Wir wissen auch, dass Sie nie in Italien gewesen sind.
Diesmal begann sie laut aufzulachen.
– Nein, ich bin nicht in Italien gewesen.
Mein Bruder war betroffen und sagte:
– Der Graf hat mich beauftragt, Ihnen dieses Geld zu geben und Ihnen zu erklären, dass er seine Beziehungen zu Ihnen abbräche.
Sie wurde wieder ernst, steckte das Geld ruhig in die Tasche und sagte naiv:
– Also… soll ich den Grafen nicht wiedersehen?
– Nein, meine Dame.
Sie schien das nicht zu erwarten und setzte ruhigen Tons hinzu:
– Schade. Ich liebte ihn sehr.
Als mein Bruder sah, dass sie so entschlossen war, fragte er sie, gleichfalls lächelnd: »Sagen Sie mir bitte nur, warum Sie diese lange und komplizierte Geschichte von der Reise und dem Kinde erfunden haben?«
Sie blickte meinen Bruder ganz erstaunt an, als ob er etwas sehr Dummes gefragt hatte, und antwortete:
– Das ist doch aber arg! Glauben Sie denn, eine arme kleine Bürgersfrau wie ich, an der garnichts dran ist, hätte einen Mann wie den Grafen von L…, einen Minister, einen Grandseigneur, einen reichen und verführerischen Gentleman, drei Jahre lang festhalten können, wenn ich nicht etwas hatte, womit ich ihn hielt? Nun, es ist jetzt zu Ende; schade drum! Aber es konnte ja nicht ewig so bleiben. Drei Jahre lang ist mir’s wenigstens gelungen. Bitte sagen Sie dem Grafen viele Grüße von mir.
Sie stand auf.
– Aber… das Kind, fing mein Bruder wieder an. Sie hatten doch ein Kind, das Sie ihm zeigen wollten.
– Gewiss, es ist das Kind meiner Schwester. Sie hat es mir geliehen. Wahrscheinlich stammt der Brief von ihr.
– Schön, aber alle diese Briefe aus Italien?
Sie setzte sich wieder und schüttelte sich vor Lachen.
– Oh, diese Briefe! sagte sie. Ein ganzes Gedicht. Der Graf war nicht umsonst Minister des Auswärtigen.
– Aber… wie denn…
– Das ist mein Geheimnis. Ich will niemand blosstellen.
Sie grüßte mit leicht spöttischem Lächeln und ging ohne jede Gemütsbewegung, wie eine Schauspielerin, deren Rolle zu Ende ist. –
»Und die Moral«, setzte Graf L… hinzu: »Traue keiner diesen lockren Vögeln!«
*