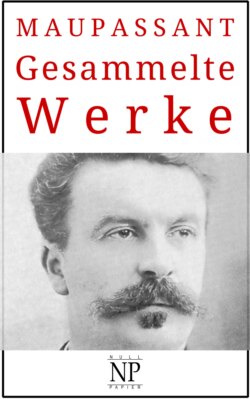Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 43
VI.
ОглавлениеDie Kirche war ganz mit Schwarz bezogen, und ein großes Wappenschild über dem Portal mit einer Krone darüber verkündete den Passanten, dass hier ein Edelmann beigesetzt wird.
Die Trauerfeier war zu Ende und die Gäste gingen langsam vor dem Sarge am Neffen des Grafen vorbei; er drückte ihnen die Hände und erwiderte ihre Grüße. Als Georges Du Roy und seine Frau die Kirche verlassen hatten, gingen sie langsam, schweigend nach Hause.
»Es ist wirklich merkwürdig«, sagte Georges, ohne sich zu seiner Frau zu wenden.
»Was denn, mein Freund?« fragte Madeleine.
»Dass Vaudrec uns nichts vererbt hat!«
Sie errötete plötzlich, als breitete sich ein rosa Schleier vom Hals bis zum Gesicht, und sagte:
»Warum sollte er uns was hinterlassen? Es lag doch kein Grund vor.«
Nach kurzem Schweigen fuhr sie fort:
»Vielleicht hat er ein Testament hinterlassen, das bei seinem Notar liegt. Wir können es ja noch nicht wissen.«
Er überlegte und sagte:
»Ja, das ist möglich, weil wir doch seine besten Freunde waren, wir beide. Zweimal in der Woche war er bei uns zu Tisch und kam zu jeder Stunde. Er war bei uns wie zu Hause. Er liebte dich wie ein Vater und er hatte keine Familie, keine Kinder, keine Geschwister, nur einen Neffen, einen entfernten Neffen. Ja, es muss ein Testament da sein. Ich verlange nichts Großes von ihm, nur eine Kleinigkeit, etwas, was uns beweisen wird, dass er uns liebte und an uns gedacht hatte und die Neigung zu schätzen wusste, die wir für ihn hatten. Er schuldet uns einen Beweis seiner Freundschaft.«
Sie sagte mit einer nachdenklichen gleichgültigen Miene: »Ja, es ist sehr gut möglich, dass ein Testament vorhanden ist.«
Als sie nach Hause kamen, reichte der Diener Madeleine einen Brief. Sie öffnete ihn, und überreichte ihn ihrem Mann:
»Herr Lamaneur
Notar 17, rue des Vosges
Gnädige Frau!
Ich bitte Sie ergebenst, in einer wichtigen Angelegenheit mich am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag von zwei bis vier in meinem Büro aufsuchen zu wollen.
Ich verbleibe usw.
Lamaneur.«
Georges errötete und sagte:
»Das wird es sein. Es ist merkwürdig, dass er dich auffordert und nicht mich, der eigentlich der gesetzliche Familienvorstand ist.«
Sie antwortete zuerst nichts und sagte dann nach kurzem Besinnen:
»Wollen wir gleich beide hingehen.«
»Ja, ich bin bereit.«
Sobald sie gefrühstückt hatten, machten sie sich auf den Weg.
Als sie in das Büro des Herrn Lamaneur kamen, erhob sich der Bürovorsteher mit einer auffallenden Dienstfertigkeit und führte sie zu seinem Chef.
Der Notar war ein kleiner, vollkommen runder Mann. Sein Kopf glich einer Kugel, die auf einer anderen größeren Kugel aufgesetzt war, diese zweite Kugel wurde von zwei Beinen getragen, die ihrerseits so klein und kurz waren, dass sie auch wie zwei runde Kugeln aussahen.
Er begrüßte sie, bat Platz zu nehmen; dann wandte er sich an Madeleine:
»Madame, ich habe Sie hergebeten, um Sie von dem Inhalt des Testaments des Grafen Vaudrec in Kenntnis zu setzen, das Sie betrifft.«
Georges konnte sich nicht enthalten und flüsterte:
»So hab’ ich’s mir auch gedacht.«
Der Notar setzte hinzu:
»Ich will Ihnen gleich das Testament vorlesen, es ist übrigens ganz kurz.« Er nahm aus einer Mappe, die vor ihm lag, einen Bogen heraus und las: »Ich, Endesunterzeichneter, Paul-Emile-Cyprien-Gontran Comte de Vaudrec, gesund an Körper und Seele, bestimme hiermit meinen letzten Willen. Da der Tod uns in jedem Augenblicke treffen kann, so will ich in Voraussetzung seines Eintrittes, mein Testament niederschreiben, das bei dem Notar Lamaneur hinterlegt wird.
Da ich keine direkten Erben habe, hinterlasse ich mein gesamtes Vermögen, bestehend aus Wertpapieren in Höhe von ca. 600000 Francs und aus Immobilien in Höhe von ca. 500000 Francs, Madame Claire-Madeleine Du Roy als ihr unbelastetes freies Eigentum. Ich bitte sie, diese Gabe eines toten Freundes als Beweis einer aufrichtigen, tiefen und ergebenen Zuneigung entgegenzunehmen.«
Der Notar fuhr fort:
»Das ist alles. Dieses Schriftstück ist vom August letzten Jahres datiert und ist an Stelle eines gleichlautenden Dokumentes getreten, das vor zwei Jahren auf den Namen von Claire-Madeleine Forestier ausgestellt war. Auch dieses erste Dokument befindet sich in meinem Besitz, und im Falle einer Anfechtung von selten der Verwandten könnte man damit beweisen, dass der Graf de Vaudrec seinen Willen nicht geändert hatte.«
Madeleine wurde blass und blickte hinunter auf ihre Füße. Georges drehte nervös seinen Schnurrbart zwischen den Fingern. Nach einer kurzen Pause fuhr der Notar fort:
»Selbstverständlich, mein Herr, kann Madame diese Hinterlassenschaft nur mit Ihrer Zustimmung annehmen.«
Du Roy stand auf und sagte in trocknem Tone:
»Ich bitte um Bedenkzeit.«
Der Notar lächelte, und sagte mit liebenswürdiger Stimme:
»Ich begreife die Bedenken, die Sie zaudern lassen. Ich habe noch hinzuzufügen, dass der Neffe des Grafen Vaudrec, als er heute früh von dem letzten Willen seines Onkels Kenntnis nahm, sich bereit erklärte, denselben anzuerkennen, falls man ihm die Summe von hunderttausend Francs auszahlte. Nach meiner Ansicht ist das Testament unanfechtbar, aber ein Prozess würde Aufsehen erregen, was Sie wahrscheinlich vermeiden wollen. Die Welt urteilt bekanntlich oft sehr boshaft. Jedenfalls würde ich Sie bitten, mich noch vor Sonnabend von Ihrem definitiven Entschluss über alle Punkte in Kenntnis zu setzen.«
Georges verbeugte sich:
»Gut, Herr Lamaneur.«
Dann verabschiedete er sich feierlich, ließ seine Frau, die gar nichts mehr sagte, vorangehen und verließ das Büro in so steifer und gemessener Weise, dass der Notar nicht mehr lächelte.
Sobald sie nach Hause gekommen waren, schloss Du Roy heftig die Tür hinter sich und warf seinen Hut aufs Bett.
»Du bist Vaudrecs Geliebte gewesen?«
Madeleine hatte ihren Schleier abgelegt und drehte sich schroff um:
»Ich, oh!«
»Ja, du. Man hinterlässt nicht einer Frau sein ganzes Vermögen … ohne dass …«
Sie begann zu zittern und konnte nicht die Nadeln fassen, mit denen ihr durchsichtiger Schleier ans Haar befestigt war.
Sie dachte einen Augenblick nach und stammelte mit erregter Stimme:
»Hör mal … du bist verrückt … du bist … du bist … und du selbst … du hast ja vorher — auch gehofft … er würde dir auch etwas vermachen.«
Georges stand vor ihr und beobachtete sie, wie ein Untersuchungsrichter, der die geringsten Schwächen des Angeklagten zu entdecken sucht. Er erwiderte, indem er jedes Wort betonte:
»Ja … mir hätte er was hinterlassen können, mir, deinem Gatten … mir, seinem Freunde … verstehst du … Dir doch nicht … dir, seiner Freundin … dir, meiner Gattin … Der Unterschied ist sehr wesentlich und sogar ausschlaggebend vom Standpunkt der öffentlichen Meinung … in den Augen der Gesellschaft …«
Madeleine blickte ihm gleichfalls scharf in die durchsichtigen Augen, tief und sonderbar, als wollte sie in die unbekannten Tiefen seines Wesens eindringen, die man nur selten in flüchtigen Augenblicken erfassen kann, in den Augenblicken der Achtlosigkeit, der Vergesslichkeit des Sichgehenlassens, die dann wie halbgeöffnete Türen sind, die in die geheimnisvollen Abgründe der Seele führen.
Sie versetzte langsam:
»Mir scheint doch … dass, wenn … dass man eine Erbschaft in dieser Höhe von ihm zu deinen Gunsten mindestens ebenso auffallend gefunden hätte.«
Er fragte heftig:
»Warum?«
»Weil« … sagte sie, und nach kurzem Zaudern fuhr sie fort:
»Weil du mein Mann bist … und ihn erst seit kurzer Zeit kennst, während ich schon sehr lange mit ihm befreundet war … und weil sein erstes Testament, das noch zu Lebzeiten Forestiers abgefasst war, doch mir galt.«
Georges ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab und erklärte:
»Du kannst das nicht annehmen.«
»Gut,« antwortete sie gleichgültig, »also dann brauchen wir erst gar nicht bis Sonnabend zu warten. Wir können diesen Entschluss Herrn Lamaneur sofort mitteilen.«
Er blieb vor ihr stehen und sie sahen sich Auge in Auge. Sie wollten beide bis ins tiefste Geheimnis ihres Herzens eindringen und ihre innersten Gedanken ergründen. Es war ein Seelenkampf zweier Menschen, die Seite an Seite lebten und sich doch nicht kannten, die sich beargwöhnten, ausspürten und belauerten und nie in den tiefen, schlammigen Grund der Seele hineingeschaut hatten.
Plötzlich schleuderte er ihr mit dumpfer Stimme ins Gesicht:
»Gestehe doch, dass du die Geliebte von Vaudrec warst.«
Sie zuckte mit den Achseln.
»Du redest Unsinn. Vaudrec hatte mir allerdings eine sehr große Zuneigung entgegengebracht … Aber weiter nichts … niemals.«
Er stampfte mit dem Fuß.
»Du lügst, es kann nicht möglich sein.«
Sie entgegnete ruhig:
»Es ist doch so.«
Er begann wieder auf und ab zu gehen, dann blieb er stehen:
»Erkläre mir dann, warum hinterlässt er sein ganzes Vermögen ausgerechnet dir?«
Sie tat gleichgültig und uninteressiert, als ob sie die Sache gar nichts anginge.
»Es ist sehr einfach. Wie du eben sagtest, hatte er keine Freunde außer uns, oder vielmehr außer mir, da er mich seit meiner Kindheit kennt. Meine Mutter war Gesellschafterin bei seinen Eltern. Er kam sehr oft hierher, und da er keine direkten Erben hatte, hat er an mich gedacht. Dass er mich etwas lieb hatte, ist sehr gut möglich. Aber welche Frau ist auf solche Weise nie geliebt worden. Dass diese stille und geheime Liebe ihn meinen Namen aufs Papier schreiben ließ, als er seine letzte Verfügung getroffen hatte, kann auch sein. Er brachte mir jeden Montag Blumen. Du warst doch darüber gar nicht erstaunt, und dir brachte er keine mit, nicht wahr? Heute vermacht er mir sein Vermögen aus demselben Grund und da er wahrscheinlich sonst niemanden hat, dem er es geben könnte. Es wäre im Gegenteil höchst sonderbar, wenn er es dir hinterlassen hätte. Warum? — Was bist du für ihn?«
Sie sprach so natürlich und so ruhig, dass Georges zu zaudern begann.
Er erwiderte:
»Das ist egal. Wir können die Erbschaft unter solchen Bedingungen unmöglich annehmen. Das würde den schlechtesten Eindruck erwecken. Alle Welt würde daran glauben, das Schlimmste vermuten und sich über mich lustig machen. Meine Kollegen sind sowieso schon neidisch auf mich und lauern auf die Gelegenheit, mich anzugreifen. Ich muss mehr als jeder andere auf meine Ehre und auf meinen Ruf bedacht sein. Ich kann unmöglich zugeben, dass meine Frau eine derartige Erbschaft von einem Mann annimmt, den das Gerücht schon zu ihrem Liebhaber gestempelt hat. Vielleicht hätte sich das Forestier gefallen lassen, ich aber nicht.«
Sie murmelte sanft:
»Also gut, mein Freund, wir nehmen es nicht an, dass macht bloß eine Million weniger in unserer Tasche aus, weiter ist ja nichts.«
Er ging noch immer auf und ab und begann laut zu denken; er sprach zu seiner Frau, ohne das Wort direkt an sie zu richten.
»Nun ja! eine Million … umso schlimmer … Er hat ja eben bei der Abfassung des Testaments nicht begriffen, was für einen Taktfehler und was für einen Verstoß gegen die gesellschaftlichen Konventien er damit begangen hatte. Er hatte nicht gedacht, in welche schiefe und lächerliche Lage er mich bringen würde. Alles kommt im Leben auf die Umstände an… Er hätte mir die Hälfte hinterlassen sollen und alles wäre in bester Ordnung gewesen.«
Er setzte sich, schlug die Beine übereinander und zupfte an den Spitzen seines Schnurrbartes, wie er das in den Stunden der Sorge, der Langweile und des schweren Nachdenkens zu tun pflegte.
Madeleine griff nach einer Stickerei, an der sie hin und wieder arbeitete;, suchte die Wollfäden heraus und sagte:
»Ich habe nur stillzuschweigen. Du musst dir die Sache überlegen.«
Lange saß er schweigend da, dann versetzte er zögernd:
»Die Welt wird nie begreifen können, dass Vaudrec dich zu seiner Universalerbin eingesetzt hat und dass ich so etwas geduldet habe. Solch ein Vermögen auf so eine Weise anzunehmen, das würde einem Geständnis gleichbedeutend sein … Du würdest deinerseits ein verbotenes Verhältnis zugeben und ich eine niederträchtige Schwäche … verstehst du, wie man unsere Annahme auslegen würde? Man müsste einen Ausweg finden, irgendein geschicktes Mittel, wie man die Sache vertuschen könnte. Man könnte beispielsweise durchblicken lassen, dass er sein Vermögen uns zu gleichen Teilen vermacht hat, die eine Hälfte dem Manne, die andere der Frau.«
Sie fragte:
»Ich sehe nicht ein, wie das zu machen wäre, da doch das Testament eine gesetzliche Kraft hat?«
»Oh, das ist ganz einfach,« antwortete er, »du könntest mir die Hälfte der Erbschaft als Schenkung zu Lebzeiten übertragen. Wir haben keine Kinder, das geht sehr gut zu machen. Auf diese Weise würden wir dem böswilligen Gerede ein Ende bereiten.«
Sie erwiderte etwas ungeduldig:
»Ich sehe nicht ein, wieso man dem böswilligen Gerede entgehen kann, da doch die Urkunde, die Vaudrec unterzeichnet hat, nicht wegzuleugnen ist.«
»Wir brauchen sie doch gar nicht vorzuzeigen«, rief er zornig aus, »und sie öffentlich an die Wand zu schlagen. Du bist zu dumm. Wir sagen, Graf de Vaudrec hat sein Vermögen uns beiden zu je einer Hälfte hinterlassen … Weißt du, du kannst doch die Erbschaft ohne meine Zustimmung überhaupt nicht antreten. Ich gebe sie dir nur unter der Bedingung einer Teilung, die mich vor dem Gespött der Welt bewahrt.«
Sie sah ihn mit einem durchbohrenden Blick an.
»Wie du willst, ich bin bereit.«
Dann stand er auf und ging wieder auf und ab, er schien wieder zu schwanken und vermied jetzt den scharf beobachtenden Blick seiner Frau.
»Nein, in keinem Fall« sagte er. »Vielleicht soll man überhaupt verzichten … es ist würdiger, korrekter, ehrenhafter … Übrigens auf diese Weise könnte man uns auch nicht das Geringste nachsagen. Die gewissenhaftesten Leute könnten sich nur davor verbeugen.«
Er blieb vor Madeleine stehen.
»Also schön, wenn du willst, gehe ich nochmals zu Lamaneur, ich setze ihm die Sache auseinander und frage ihn um Rat. Ich erkläre ihm mein Bedenken und teile ihm mit, dass wir uns zu einer Teilung entschlossen haben, um die Leute nicht über uns klatschen zu lassen. Von dem Augenblick an, wo ich die Hälfte der Erbschaft annehme, ist es ja selbstverständlich, dass niemand das recht hat, über die Sache zu lächeln. Das würde mit anderen Worten heißen: Meine Frau nimmt die Erbschaft an, da ich, ihr Gatte, sie auch annehme, und als solcher habe ich zu bestimmen, was sie tun kann, ohne sich zu kompromittieren. Sonst hätte es ja einen Skandal gegeben.«
»Wie du willst«, murmelte Madeleine einfach.
Er redete weiter:
»Ja, bei dieser Teilung der Erbschaft in zwei Hälften liegt die Sache sonnenklar. Wir beerben einen Freund, der keinen Unterschied zwischen uns machte, keinen von uns bevorzugte und nicht den Schein erwecken wollte, als meinte er: ›Ich gebe nach meinem Tode einem von beiden den Vorzug, wie ich ihn zu meinen Lebzeiten vorgezogen habe.‹ Er liebte mehr die Frau, wohlverstanden, aber wenn er jetzt sein Vermögen beiden Gatten zu gleichen Teilen hinterlässt, so wollte er damit ausdrücklich bestimmen, dass die Bevorzugung rein platonisch war. Sei überzeugt, dass, wenn er nachgedacht hätte, er geradeso gehandelt hätte. Er hatte sich die Sache nicht überlegt und die Folgen nicht vorausgesehen. Du sagtest vorhin ganz richtig, er brachte dir jede Woche Blumen mit und dir galt auch sein letztes Andenken, ohne dass er sich überlegte …«
Sie unterbrach ihn etwas gereizt und ungeduldig:
»Schon gut. Ich hab’ es begriffen. Du kannst dir die Erklärungen ersparen. Geh gleich zum Notar.«
Er wurde rot und stotterte:
»Du hast recht, ich gehe.«
Er nahm seinen Hut und sagte beim Weggehen:
»Ich werde versuchen, den Neffen mit fünfzigtausend Francs abzufinden, nicht wahr?«
»Nein,« antwortete sie stolz, »gib ihm die hunderttausend Francs, die er verlangt. Nimm sie von meinem Teil, wenn du willst.«
Plötzlich schämte er sich und sagte:
»Nein, wir werden uns das teilen. Wenn jeder von uns fünfzigtausend Francs gibt, dann bleibt uns doch eine runde Million.«
Dann fügte er hinzu:
»Auf Wiedersehen, meine kleine Made.«
Er ging zum Notar, erklärte und setzte ihm seine Absichten auseinander, die, wie er behauptete, von seiner Frau ausgingen.
Am folgenden Tag unterzeichneten sie eine Schenkung zu Lebzeiten von fünfhunderttausend Francs, die Madeleine Du Roy ihrem Gatten abtrat. Dann, als sie das Büro verlassen hatten, schlug Georges Du Roy vor, bei dem schönen Wetter einen Spaziergang zu machen. Er war sehr liebenswürdig und aufmerksam gegen seine Frau. Er sah außerordentlich vergnügt aus und lachte, während sie nachdenklich und etwas ernst blieb.
Es war ein kühler Herbsttag. Die vorübergehende Menge schien es eilig zu haben und die Passanten schritten hastig dahin. Du Roy führte seine Frau vor den Laden, in dessen Schaufenster er den Chronometer bewundert hatte.
»Willst du, dass ich dir eine Schmucksache kaufe?« fragte er. Sie murmelte gleichgültig:
»Wie du willst.«
Sie traten in den Juwelierladen herein. Er fragte:
»Was willst du, ein Kollier, ein Armband oder ein Paar Ohrringe?«
Beim Anblicken der Schmuckstücke und Juwelen konnte sie ihre absichtlich angenommene kühle Haltung nicht mehr bewahren und ihre Augen liefen funkelnd und neugierig über all die Kostbarkeiten in den Glaskästen.
Und plötzlich rief sie vom Verlangen ergriffen:
»Sieh, da liegt ein schönes Armband!«
Es war eine eigenartig geformte Kette. Jedes einzelne Glied trug einen anderen Stein.
Georges fragte:
»Was kostet dieses Armband?«
»3000 Francs«, erwiderte der Juwelier.
»Wenn Sie es mir für zwei fünf lassen, so ist das Geschäft gemacht.«
Der Verkäufer zögerte; dann versetzte er:
»Nein, mein Herr, das ist unmöglich.’’
Du Roy fuhr fort:
»Also dann geben Sie mir den Chronometer für 1500 Francs dazu; das macht zusammen 4000, die ich Ihnen in bar bezahle. Einverstanden? Wenn Sie nicht wollen, gehe ich woanders hin.«
Der Juwelier war verdutzt und sagte schließlich zu.
»Also gut, mein Herr.«
Der Journalist gab seine Adresse und fügte hinzu:
»Auf den Chronometer lassen Sie meine Initialen G. R. C. in verschlungenen Buchstaben eingravieren, und darüber setzen Sie die Baronskrone.«
Madeleine lächelte überrascht. Und als sie hinausgingen, schmiegte sie sich mit einer gewissen Zärtlichkeit an seinen Arm. Sie fand ihn wirklich schlau, gewandt und stark. Jetzt, wo er ein Vermögen hatte, musste er auch einen Titel haben. Das war recht und billig.
Der Juwelier verbeugte sich.
»Sie können sich darauf verlassen, es wird Donnerstag fertig sein, Herr Baron.«
Sie gingen am Vaudeville vorbei. Dort wurde ein neues Stück aufgeführt.
»Wenn du willst, gehen wir heute ins Theater, ich werde sehen, ob wir eine Loge bekommen?«
Sie fanden eine Loge und nahmen sie. Er sagte weiter:
»Wie wäre es, wenn wir heute im Restaurant äßen?«
»Oh, bitte, das möchte ich sehr.«
Er war glücklich wie ein König, und zerbrach sich den Kopf, was sie sonst noch unternehmen könnte.
»Wenn wir Madame de Marelle bäten, heute mit uns den Abend zu verbringen. Ihr Mann ist hier, wie ich hörte, und ich würde mich sehr freuen, ihn begrüßen zu können.«
Sie gingen hin. Georges, der sich vor einem Zusammentreffen mit seiner Geliebten fürchtete, war es ganz recht, dass seine Frau dabei war, um jede Auseinandersetzung unmöglich zu machen.
Doch Clotilde schien sich überhaupt auf gar nichts mehr zu entsinnen und zwang sogar ihren Mann, der Einladung zu folgen.
Das Diner war lustig und der Abend entzückend. Georges und Madeleine kamen spät nach Hause zurück. Das Gas brannte nicht mehr. Um die Stufen zu beleuchten, zündete der Journalist von Zeit zu Zeit Wachsstreichhölzer an. Als sie den ersten Stock erreicht hatten, beleuchtete die Flamme, die plötzlich durch die Reibung entstand, ihre beiden Gesichter, inmitten der Dunkelheit des Treppenhauses. Sie sahen wie zwei Gespenster aus, die auftauchten und sofort wieder bereit waren, in der Finsternis zu verschwinden.
Du Roy erhob seine Hand, um ihre Spiegelbilder heller zu beleuchten und sagte lächelnd und triumphierend:
»Da gehen die beiden Millionäre!«