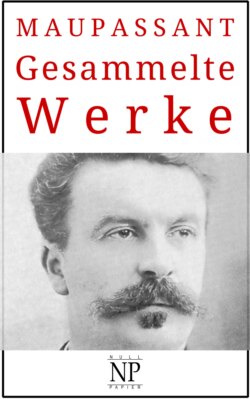Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 40
III.
ОглавлениеAls Du Roy am nächsten Morgen auf die Redaktion kam, ging er sofort zu Boisrenard.
»Mein lieber Freund,« sagte er, »ich muss dich um eine Gefälligkeit bitten. Seit einiger Zeit findet man Spaß daran, mich Forestier zu nennen. Mir wird es allmählich zu dumm, und ich bitte dich daher, deinen Kollegen in aller Freundschaft mitzuteilen, ich würde jeden, der sich noch einmal den Scherz erlaubt, ohrfeigen. Sie mögen sich selbst überlegen, ob die Albernheit einen Degenstich wert ist. Ich wende mich an dich, weil du ein ruhiger Mensch bist, der ärgerliche Verwicklungen verhindern kann und außerdem, weil du bei meinem Duell sekundiert hast.«
Boisrenard versprach den Auftrag auszuführen. Du Roy verließ die Redaktion, um ein paar Besorgungen zu machen und kam nach einer Stunde wieder. Niemand nannte ihn mehr Forestier.
Als er nach Hause kam, hörte er Frauenstimmen im Salon.
»Wer ist da?« fragte er.
»Madame Walter und Madame de Marelle«, antwortete der Diener.
Sein Herz begann zu klopfen, dann sagte er sich: »Halt, ich will mal sehen«, und er öffnete die Tür.
Clotilde saß in der Ecke am Kamin. Ein Sonnenstrahl, der vom Fenster kam, beleuchtete sie. Es kam Georges vor, als würde sie bei seinem Anblick ein wenig blasser. Er begrüßte zuerst Frau Walter und ihre beiden Töchter, die wie zwei Schildwachen neben der Mutter saßen, dann wandte er sich zu seiner früheren Geliebten. Sie reichte ihm die Hand, er ergriff sie und drückte sie kräftig, als ob er sagen wollte: »Ich liebe Sie noch immer.« Sie erwiderte seinen Druck. Er fragte:
»Ist es Ihnen gut ergangen, seit der Ewigkeit, wo wir uns nicht mehr gesehen haben?«
»Sehr gut, und Ihnen, Bel-Ami?«
Dann wandte er sich an Madeleine und fügte hinzu:
»Du gestattest doch, dass ich ihn noch immer Bel-Ami nenne?«
»Selbstverständlich, liebste Clotilde, ich erlaube dir alles, was du willst.«
Eine leichte Ironie schien durch diese Worte hindurch zuklingen. Madame Walter sprach von einem Fest, das Jacques Rival in seiner Junggesellenwohnung geben wollte, einer großen Festvorstellung, zu der auch die Damen der Gesellschaft eingeladen werden sollten.
Sie sagte: »Das wird sehr interessant werden, aber ich bin verzweifelt, denn wir haben niemanden, der uns begleiten könnte, und mein Mann muss ausgerechnet an diesem Tage verreisen.«
Du Roy stellte sich sofort zur Verfügung, und sie nahm sein Anerbieten an.
»Meine Töchter und ich werden Ihnen sehr dankbar sein.«
Er betrachtete die jüngere der beiden Fräulein Walter und dachte: »Sie ist nicht schlecht, die kleine Suzanne, wahrhaftig nicht!«
Sie sah wie ein zartes, blondes Püppchen aus. Ein bisschen zu mager, aber sehr zierlich, mit schlanker Taille, entwickeltem Busen und Hüften, mit einem ganz feinen Gesichtchen, mit blaugrauen Emailleaugen, die wie mit dem Pinsel eines hervorragenden Miniaturmalers gemalt zu sein schienen. Sie hatte eine etwas zu weiße, zu glatte und gleichmäßige Haut, ihr Haar war gut frisiert und bildete eine künstlich gekräuselte und reizvolle Wolke, genau wie das der hübschen Luxuspuppen, die man oft in den Armen kleiner Mädchen erblickt, die selbst kaum größer sind als ihr Spielzeug.
Die älteste Schwester Rose war hässlich, flach und nichtssagend. Sie gehörte zu jenen Mädchen, die man stets übersieht, die man nicht anspricht und von denen man nicht redet.
Die Mutter stand auf und wandte sich zu Georges:
»Also ich verlasse mich auf Sie, nächsten Donnerstag um zwei Uhr.«
»Sie können sich auf mich verlassen, Madame«, erwiderte er.
Als sie fort war, verabschiedete sich auch Madame de Marelle. »Auf Wiedersehen, Bel-Ami.« Jetzt drückte sie ihm die Hand sehr lange und kräftig und ihn rührte dieses schweigende Geständnis. Er fühlte sich plötzlich von einer Leidenschaft für diese kleine nette Zigeunerfrau erfasst, die ein so guter Kamerad war und ihn vielleicht wirklich lieb hatte. »Ich gehe morgen, sie besuchen«, dachte er.
Sobald er mit seiner Frau allein war, brach Madeleine in ein fröhliches und heiteres Lachen aus. Sie sah ihm in die Augen und sagte: »Weißt du, dass Frau Walter in dich verliebt ist?«
Er wollte ihr nicht glauben und antwortete: »Ach, lass doch.«
»Sei versichert. Sie sprach von dir mit einer geradezu tollen Begeisterung. Das ist sehr merkwürdig von ihr! Sie möchte für ihre Töchter zwei solche Männer wie dich finden. Zum Glück ist so was bei ihr ohne Bedeutung.«
Er begriff nicht, was sie meinte.
»Wieso ohne Bedeutung?«
Sie antwortete mit der Überzeugung einer Frau, die ihres Urteils sicher ist:
»Noch nie ist über Frau Walter der leiseste Verdacht laut geworden, verstehst du, nie, niemals! Sie steht rein da in jeder Beziehung. Ihren Mann kennst du ja so gut wie ich. Aber sie, das ist etwas anderes. Übrigens hat sie sehr darunter gelitten, dass sie einen Juden geheiratet hat, trotzdem ist sie ihm treu geblieben; sie ist eine anständige Frau.«
Du Roy war überrascht.
»Ich dachte, sie wäre auch eine Jüdin.«
»Sie, im Gegenteil. Sie ist Patronatsdame aller Wohltätigkeitseinrichtungen der Madeleinekirche. Sie ist sogar kirchlich getraut worden. Ich weiß nicht, ob sich Herr Walter dabei pro forma hat taufen, lassen oder ob die Kirche ein Auge zugetan hat.«
Georges murmelte:
»Ah, also sie ist in mich verliebt?«
»Entschieden, und bis über die Ohren. Wenn du nicht schon verheiratet wärest, würde ich dir raten, um die Hand von Suzanne zu bitten. Nicht wahr! Suzanne ist dir doch lieber wie Rose?« — Er drehte an seinem Schnurrbart und sagte: »Na, die Mutter scheint auch noch ein frisches und schneidiges Weib zu sein!«
Madeleine wurde ungeduldig:
»Weißt du, mein Kleiner, ich gönne dir gern die Mutter. Aber in diesem Falle habe ich keine Angst. In ihrem Alter begeht man nicht den ersten Fehltritt. Damit muss man früher beginnen.«
Georges dachte: »Wenn das wirklich wahr wäre, dass ich Suzanne hätte heiraten können?« …
Dann zuckte er mit den Achseln. »Ach was, das ist doch Unsinn. Der Vater hätte mich nie als Schwiegersohn akzeptiert.«
Immerhin nahm er sich vor, Frau Walters Benehmen ihm gegenüber etwas aufmerksamer zu beobachten, ohne übrigens sich dabei zu fragen, ob er daraus einen Vorteil ziehen könnte.
Den ganzen Abend lang verfolgte ihn die Erinnerung an seine Liebschaft mit Clotilde; Erinnerungen, die zärtlich und zugleich sinnlich waren. Er dachte an ihre tollen Streiche, an ihre lustigen Einfalle und an ihre gemeinschaftlichen Streifzüge. Er sagte sich immer wieder: »Sie ist wirklich bezaubernd, ich gehe morgen bestimmt zu ihr hin.« Am nächsten Morgen nach dem Frühstück begab er sich tatsächlich nach der Rue de Verneuil. Dasselbe Stubenmädchen öffnete ihm die Tür und fragte ihn gemütlich nach der Art kleinbürgerlicher Dienstboten:
»Geht es Ihnen gut, mein Herr?«
»Jawohl, mein Kind«, erwiderte er und trat in den Salon, wo eine ungeübte Hand Tonleitern am Klavier spielte. Es war Laurine. Er dachte, sie würde ihm an den Hals fliegen, aber sie stand ernst auf, grüßte ihn feierlich, wie eine Erwachsene und zog sich in würdiger, reservierter Haltung zurück. Sie benahm sich vollständig wie eine tiefgekränkte Frau, sodass er ganz erstaunt und verdutzt dastand. Nun kam die Mutter. Er ergriff ihre Hände und küsste sie.
»Wie oft habe ich an Sie gedacht«, sagte er.
»Und ich.«
Sie setzten sich und sahen sich lächelnd an, indem sie sich tief in die Augen sahen; sie hatten beide Lust, sich auf die Lippen zu küssen.
»Meine liebe kleine Clo, ich liebe Sie!«
»Und ich dich auch.«
»Dann, dann bist du mir nicht mehr böse?«
»Ja und nein. Es hat mir sehr weh getan. Darin aber begriff ich deine Gründe und sagte mir: ›Früher oder später kommt er doch zu mir zurück.’«
»Ich wagte nicht wiederzukommen, denn ich wusste nicht, wie du mich empfangen würdest. Ich wagte es nicht, aber ich hatte ein glühendes Verlangen nach dir. Übrigens sag’ mir mal, was ist denn mit Laurine los. Sie hat mich kaum begrüßt und ist dann wütend fortgegangen.«
»Ich weiß es nicht, aber seit deiner Heirat darf man nicht mehr über dich reden. Ich glaube, sie ist wirklich eifersüchtig.«
»Nicht möglich.«
»Doch, doch Liebster. Sie nennt dich nicht mehr Bel-Ami, sondern sie nennt dich Monsieur Forestier.«
Du Roy wurde rot und beugte sich zu der jungen Frau.
»Gib mir deinen Mund«, bat er.
Sie hielt ihm ihre Lippen hin.
»Wo können wir uns wiedersehen?« fragte er.
»In … in der Rue Constantinople.«
»Wie! die Wohnung ist nicht vermietet?«
»Nein, ich habe sie behalten.«
»Du hast sie behalten?«
»Ja, ich dachte, du würdest wiederkommen.«
Seine Brust hob sich vor stolzer Freude. Diese Frau liebte ihn also wirklich mit einer echten beständigen und innigen Liebe. Er flüsterte:
»Ich liebe dich über alles.« Dann fragte er:
»Geht es deinem Manne gut?«
»Ja, sehr gut, er war einen Monat hier. Vorgestern ist er abgereist.«
Du Roy konnte sich nicht enthalten zu lachen.
»Wie gut sich das trifft.«
»O ja,« antwortete sie, »das trifft sich sehr gut, aber selbst wenn er hier ist, geniert er uns auch nicht, du weißt ja?«
»Du hast recht. Er ist übrigens ein reizender Mensch.«
»Und du,« fragte sie, »wie gefällt dir das neue Leben?«
»Weder besonders gut, noch besonders schlecht. Meine Frau ist eine Lebensgefährtin, eine Bundesgenossin.«
»Weiter nichts?«
»Weiter nichts … was das Herz angeht …«
»Ich verstehe es wohl. Sie ist doch sehr nett?«
»Ja, entschieden, aber sie reizt mich nicht.« — Er näherte sich Clotilde und murmelte:
»Wann sehen wir uns wieder?«
»Morgen … wenn du willst.«
»Ja. Morgen um zwei Uhr.«
»Um zwei Uhr.« — Er erhob sich, um zu gehen; dann stammelte er etwas verlegen:
»Weißt du, ich möchte die Wohnung in der Rue de Constantinople von jetzt an auf meine eigene Rechnung nehmen. Ich will es. Das geht nicht, dass du sie weiter bezahlst.«
In einer Anwandlung von Bewunderung küsste sie ihm nun die Hand und flüsterte:
»Tue so, wie du willst. Mir genügt, dass ich sie für unser Wiedersehen bewahrt habe.«
Und Du Roy verließ sie, das Herz voller Befriedigung.
Er ging an einem Schaufenster eines Fotografen vorüber, und das Bild einer stattlichen Dame mit großen Augen erinnerte ihn an Frau Walter. »Eigentlich ist sie noch gar nicht so übel,« sagte er sich, »wie kommt es, dass mir noch nie etwas aufgefallen ist? Ich bin neugierig, wie sie mich Donnerstag empfangen wird.«
Er rieb sich die Hände und ging freudestrahlend weiter. Er empfand Freude des allseitigen Erfolges; die egoistische Freude des geschickten Mannes, dem alles gelingt, und die zärtliche Freude der befriedigten Eitelkeit und Sinnlichkeit, wie sie durch Frauenliebe erregt wird.
Als der Donnerstag kam, fragte er Madeleine:
»Gehst du nicht zum Preisfechten bei Rival?«
»O nein, das macht mir wenig Vergnügen. Ich gehe in die Abgeordnetenkammer.«
Es war herrliches Wetter, er nahm deshalb einen offenen Landauer und fuhr, Frau Walter abzuholen. Er war überrascht, als er sie erblickte; so schön und jung fand er sie. Sie hatte ein helles, leicht ausgeschnittenes Sommerkleid an und unter dem gelben Spitzeneinsatz sah er die vollen Rundungen der Brüste. Noch nie hatte sie so frisch ausgesehen und er hielt sie wirklich für begehrenswert. Sie bewahrte eine stille und vornehme Haltung, eine gewisse mütterliche Ruhe, durch die sie den frivolen Blicken der Männer zumeist nicht auffiel. Alles, was sie sagte, war etwas mehr oder minder Bekanntes, Konventionelles und nie übertrieben. Ihr Ideenkreis war wohl klassifiziert und geordnet und fern von jeglicher Art der Ausschreitung.
Ihre Tochter Suzanne war ganz in Rosa gekleidet und glich einem aufgefrischten Watteaubild, während ihre ältere Schwester wie eine Erzieherin aussah, die dieses reizende Püppchen beaufsichtigen musste.
Vor Rivals Wohnung stand eine Wagenreihe. Du Roy bot Frau Walter den Arm und sie gingen hinein.
Das Preisfechten wurde zum Besten der Waisenkinder des 6. Pariser Stadtbezirks veranstaltet unter dem Patronat aller Senatoren- und Deputiertenfrauen, die zur Vie Française Beziehungen hatten.
Frau Walter hatte versprochen, mit ihren Töchtern hinzukommen, lehnte es aber ab, Patronatsdame zu sein, da sie mit ihrem Namen nur die von der Kirche angeregten Wohltätigkeitsveranstaltungen unterstütze; nicht etwa aus übermäßiger Frömmigkeit, sondern weil ihre Ehe mit einem Juden sie, wie sie glaubte, zu einer gewissen religiösen Haltung zwang. Und das von dem Journalisten veranstaltete Fest trug einen republikanischen Anstrich, der womöglich antiklerikal ausgelegt werden konnte.
Seit drei Wochen stand in den Zeitungen aller Parteirichtungen zu lesen: »Unser berühmter Kollege Jacques Rival hat den vortrefflichen und großherzigen Plan gefasst, zugunsten der Waisenkinder des 6. Stadtbezirks von Paris ein großes Schaufechten in seinem hübschen Fechtsaal, der zu seiner Junggesellenwohnung gehört, zu veranstalten; die Einladungen erfolgen durch Madame Laloigne, Madame Remontel und Madame Rissolin, die Gattinnen der Senatoren gleichen Namens, sowie durch die Gattinnen der bekannten Abgeordneten: Madame Laroche-Mathieu, Madame Percerol und Madame Firmin. Während der Pause wird eine Sammlung veranstaltet und der Ertrag unmittelbar dem Maire des 6. Stadtbezirks oder dessen Vertreter ausgehändigt werden.« — Es war eine Riesenreklame, die der Journalist für sich und seinen Vorteil inszeniert hatte.
Jacques Rival empfing die Gäste am Eingang seiner Wohnung, wo ein Büfett eingerichtet war, dessen Kosten von den Einnahmen abgezogen werden sollten. Mit liebenswürdiger Handbewegung zeigte er auf die Treppe, die zum Keller führte. Da hatte er einen Fecht- und Schießraum eingerichtet. Er sagte:
»Hinunter, meine Damen, bitte, hinunter. Das Fechten wird im Keller stattfinden.« Er eilte der Frau seines Chefs entgegen, dann drückte er Du Roy die Hand und sagte:
»Guten Tag, Bel-Ami!«
»Wer hat Ihnen gesagt, dass …?« fragte dieser erstaunt.
»Madame Walter, die diesen Namen sehr nett findet«, antwortete Rival, ohne ihn ausreden zu lassen.
»Ja,« sagte Frau Walter errötend, »ich gestehe, dass, wenn ich Sie näher gekannt hätte, dann würde ich Sie wie die kleine Laurine auch ›Bel-Ami‹ nennen. Der Name passt sehr gut zu Ihnen.«
Du Roy lachte: »Aber ich bitte Sie, Frau Walter, tun Sie das.«
»Nein, dazu sind wir nicht genug befreundet«, sagte sie sehr leise.
»Wollen Sie mir die Hoffnung geben, dass wir in Zukunft es sein werden?« fragte er.
»Wir werden sehen«, antwortete sie.
Am Eingang zum Keller trat er zur Seite. Die schmale Treppe war mit Gas beleuchtet und der krasse Übergang vom Tageslicht zu diesem gelblichen Schein hatte etwas Düsteres. Ein Kellergeruch stieg die Wendeltreppe hinauf, ein Geruch von erwärmter Feuchtigkeit, von verschimmelten Wänden, die für diesen Tag abgewischt waren; ein Duft nach Weihrauch, Frauen, Lubin, Verveine und Veilchen.
Man vernahm viele Stimmen durch dieses Loch, das Wogen einer erregten Menge. Der Keller war von Gaslampen und venezianischen Laternen erleuchtet, die zwischen den Blättern versteckt waren, mit denen man die Wände ausgeschmückt hatte. Man sah nichts wie grüne Äste. Die Decke war mit Farnkraut geschmückt, der Boden mit Blumen und Blättern bestreut. Man fand diese Einrichtung entzückend. Im kleinen Keller im Hintergrunde war die Bühne für die Fechter eingerichtet, von beiden Seiten standen zwei Reihen Stühle für die Preisrichter. Im ganzen Keller waren Bänke aufgestellt, die im ganzen zweihundert Personen aufnehmen konnten. Eingeladen waren vierhundert.
Vor dem Podium standen schlanke junge Leute im Fechtkostüm mit langen Gliedern, hochgedrehten Schnurrbärten und posierten vor den Zuschauern. Man nannte sie beim Namen und zeigte auf die Fechtmeister und Amateure, auf die Berühmtheiten des Fechtsportes. Um sie herum standen jüngere und ältere Herren in schwarzen Gehröcken und plauderten mit den Fechtern. Auch sie wollten gesehen, erkannt und bemerkt werden; das waren die Fürsten der edlen Fechtkunst in Zivil, die Sachverständigen im Stich und Hieb.
Fast die ganzen Bänke waren von Frauen besetzt; man hörte das Rauschen ihrer Kleider und das Gemurmel ihrer Stimmen. Sie fächelten sich wie im Theater; denn es herrschte schon eine erstickende Hitze in dieser laubgeschmückten Grotte. »Mandelmilch! Limonade! Bier!« hörte man von Zeit zu Zeit einen Witzbold rufen. Frau Walter und ihre Töchter setzten sich auf die Plätze in der ersten Reihe, die für sie reserviert waren. Als Du Roy sie hingeführt hatte, wollte er sich zurückziehen und sagte:
»Ich muss Sie leider verlassen, die Herren dürfen die Bänke nicht besetzen.«
Frau Walter sagte zögernd:
»Ich möchte Sie aber sehr gern hierbehalten. Sie können mir die Namen der einzelnen Fechter nennen. Wenn Sie hier am Ende der Bank stehenbleiben, werden Sie sicher niemanden stören.«
Sie sah ihn mit ihren großen sanften Augen an und fuhr fort zu bitten:
»Nicht wahr, Sie bleiben bei uns, Herr … Herr Bel-Ami. Wir können Sie nicht entbehren.«
»Ich gehorche mit Vergnügen, gnädige Frau«, erwiderte er.
Überall hörte man das Urteil des Publikums:
»Dieser Kellerraum ist sehr spaßig … sehr nett.« Georges kannte diesen gewölbten Raum nur zu gut. Er dachte an jenen Vormittag, den er hier am Tage vor seinem Duell zugebracht hatte, ganz allein, gegenüber der kleinen weißen Scheibe, die ihm aus dem Hintergrund des weiten Kellers wie ein großes, furchtbares Auge entgegenleuchtete. Von der Treppe her ertönte Jacques Rivals Stimme:
»Es geht gleich los, meine Damen!«
Und sechs Herren in enganliegenden steifen Kleidern, die den Brustkasten hervortreten ließen, betraten das Podium und setzten sich auf die für die Jury bestimmten Stühle. Man flüsterte ihre Namen: es waren der General de Raynaldi, der Vorsitzende, ein kleiner Mann mit großem Schnurrbart, der Maler Josephin Roudet, ein großer kahlköpfiger Mann mit langem Vollbart, Matthéo de Ujar, Simon Ramoncel, Pierre de Carvin, drei junge elegante Herren, und schließlich der Fechtmeister Gaspard Merlerori.
Dann erschienen zwei Zettel an den beiden Seiten des Kellers. Rechts stand: Monsieur Crèvecœur, und links Monsieur Plumeau.
Es waren zwei Fechtmeister, zwei tüchtige Fechtmeister zweiten Ranges. Sie traten auf, beide sehr hager, mit militärischen Allüren und steifen Bewegungen. Sie begrüßten sich mit den Waffen, wie zwei Automaten, und der Kampf begann. In ihren Kitteln aus Leinewand und weißem Leder sahen sie wie zwei Pierrotsoldaten aus, die sich zum Scherz miteinander schlugen.
Von Zeit zu Zeit hörte man das Wort »Getroffen« und die sechs Preisrichter streckten mit Kennermiene ihre Köpfe aus. Das Publikum sah weiter nichts als zwei lebende Marionetten, die sich schnell bewegten und die Arme vorstreckten.
Man verstand nichts, aber man war doch zufrieden. Die beiden Gestalten erschienen den meisten doch ein bisschen ungraziös und etwas lächerlich. Man dachte an die hölzernen Hampelmänner, die zu Neujahr auf den Boulevards verkauft werden.
Die beiden ersten Fechter wurden durch die Herren Planton und Carapin abgelöst. Ein Fechtmeister vom Zivil und der andere vom Militär. Planton war sehr klein und Carapin sehr dick. Es sah aus, als müsste er gleich beim ersten Florettstich wie ein aufgeblasener Ballon platzen. Man lachte. Planton sprang wie ein Affe. Carapin bewegte nur seinen Arm; der Rest seines Körpers blieb infolge seiner Korpulenz unbeweglich, und er fiel alle fünf Minuten mit solcher Wucht und Kraft aus, als fasste er den schwersten Entschluss seines Lebens. Nachher hatte er die größte Mühe, um sich wieder zurückzulehnen.
Die Kenner erklärten sein Fechten für sehr kraftvoll und scharf. Das Publikum glaubte und klatschte ihm Beifall.
Dann traten die Herren Porion und Lapalme auf, ein Fechtlehrer und ein Amateur; sie lieferten eine wilde Schlacht und stürzten rasend aufeinander los, sodass die Preisrichter mit ihren Stühlen flüchten mussten, und tobten über das Podium von einem Ende bis zum anderen, indem sie mit kräftigen, komischen Ausfällen bald vordrangen, bald zurückwichen. Ihre kleinen Sprünge nach rückwärts brachten die Damen zum Lachen, aber andrerseits imponierte dann wieder ein energischer Angriff der einen oder der anderen Seite. Ein unbekannter Jüngling aus der Zuschauermenge äußerte seine Meinung über diese Zimmergymnastik, indem er rief: »Nicht so stürmisch, es geht doch nach Stunden.« Diese Geschmacklosigkeit wurde von allen Seiten sehr missfällig aufgenommen und man rief: »Pst! Pst!« Das Urteil der Sachverständigen wurde bald bekannt, die Kämpfer hätten viel Mut und Kraft, aber nicht immer die notwendige Genauigkeit und Sicherheit gezeigt.
Der erste Teil schloss mit einem sehr schönen Waffengang zwischen Jacques Rival und dem bekannten belgischen Meister Lebegue. Rival gefiel den Damen sehr. Er war wirklich eine schöne Erscheinung, gut gewachsen, behänd und graziöser als alle, die vor ihm aufgetreten waren. In der Art, wie er parierte und ausfiel, lag eine gewisse weltliche Eleganz, die allgemein gefiel und umso auffallender war, da sein Gegner sehr energisch, aber plump und ungraziös kämpfte. »Man spürt sofort den Mann von guter Erziehung«, sagte man.
Er hatte Erfolg und wurde beklatscht.
Doch seit einiger Zeit beunruhigte die Zuschauer ein merkwürdiges Geräusch über ihren Köpfen. Es war ein starkes und heftiges Hin- und Herlaufen, das von schallendem Gelächter begleitet wurde. Die zweihundert Eingeladenen, die nicht in den Keller hinabsteigen konnten, schienen sich auf ihre eigene Art zu amüsieren. Auf der kleinen Wendeltreppe standen etwa fünfzig Menschen eingeklemmt. Die Hitze wurde unten unerträglich. Man rief: »Luft! Zu trinken!« Und der Witzbold von vorhin rief mit scharfer Stimme, die das Summen und Rauschen der Gespräche übertönte: »Mandelmilch! Limonade! Bier!«
Rival erschien sehr rot in seinem Fechtanzug. »Ich lasse gleich Erfrischungen bringen«, sagte er und lief zur Treppe. Aber jede Verbindung mit dem Erdgeschoss war abgeschnitten. Es wäre leichter gewesen, die Decke zu durchbrechen, als diese Mauer von Menschen, die auf den Stufen zusammengedrängt standen. Rival schrie:
»Reichen Sie die Eisgetränke für die Damen herüber.«
Fünfzig Stimmen wiederholten: »Eis, Eis.« Endlich erschien ein Tablett. Doch die Gläser, die darauf standen, waren leer. Die Getränke selbst waren unterwegs ausgetrunken.
Eine laute Stimme brüllte: »Man erstickt ja da unten, macht doch endlich Schluss, damit wir nach Hause können.«
Eine andere Stimme ertönte: »Einsammeln«, und das Publikum wiederholte lachend, trotzdem es vor Hitze keuchte: »Einsammeln, einsammeln, einsammeln.« Sechs Damen gingen zwischen den Bänken herum und man hörte das leise Geräusch von Geldstücken, die in die Börse fielen.
Du Roy nannte Frau Walter die Namen der berühmten Leute unter den Gästen. Es waren Lebemänner, Journalisten von großen und alten Zeitungen, die infolge ihrer Erfahrung und ihrem Renommee auf die Vie Française herabsahen. Sie haben so viele solcher politischen Finanzblätter sterben sehen, die aus einer verdächtigen Spekulation entstanden und durch den Sturz eines Ministeriums von der Bildfläche gefegt worden waren. Auch Maler und Bildhauer waren anwesend; bekanntlich meist Sportsleute, ein Dichter von der Akademie, der Aufsehen erregte, zwei Musiker und viele vornehme Ausländer, hinter deren Namen Du Roy die Silbe »Rast« setzte, was Rastaquouère bedeutete, um, wie er meinte, den Engländer nachzuahmen, die auf ihren Visitenkarten hinter dem Namen die Silbe »Esq.« setzten.
Irgendjemand rief Du Roy zu: »Guten Tag, lieber Freund!«
Es war der Graf de Vaudrec. Er entschuldigte sich bei den Damen und ging fort, um ihn zu begrüßen; als zurückkehrte, erklärte er:
»Er ist reizend, der Vaudrec, wie man bei ihm die Rasse fühlt.«
Frau Walter antwortete nichts. Sie war etwas müde und ihre Brust hob sich mühsam bei jedem Atemzug, wodurch Du Roys Augen auf sie gelenkt wurden. Von Zeit zu Zeit begegnete sich sein Blick mit dem der »Frau Direktor«, einem verlegenen, zögernden, flüchtigen Blick, der einen Augenblick auf ihm ruhte, um sich sofort wieder abzuwenden. »Schau, schau,« sagte er sich, »sollte ich die auch schon erobert haben?«
Die Geldsammlerinnen kamen vorbei, die Börsen waren bereits voll gefüllt mit Gold und Silber und ein neuer Zettel erschien auf dem Podium mit der Ankündigung: »Grrrroße Überraschung.« Die Mitglieder der Jury begaben sich auf ihre Plätze. Alles wartete.
Es erschienen zwei Frauen im Fechtkostüm mit dem Florett in der Hand. Sie trugen ein dunkles Trikot und ganz kurze Röckchen, die nur zur Hälfte die Schenkel bedeckten. Sie hatten, einen starken Schutzpolster auf der Brust an, sodass sie den Kopf hoch tragen mussten und nicht senken konnten. Sie waren hübsch und jung und lachten, als sie die Zuschauer begrüßten. Langer Beifall empfing sie.
Dann nahmen sie Stellung, während sich das Publikum galante und nette Scherze zuflüsterte. Ein liebenswürdiges Lächeln trat auf die Gesichter der Preisrichter, die jeden Treffer mit einem leichten Bravoruf begleiteten.
Den Zuschauern gefiel dieser Kampf und sie äußerten darüber ihre Freude. Sie erregten die Begierde der Männer und erweckten bei den Damen den angeborenen Sinn des Pariser Publikums für die etwas zweideutigen Keckheiten, für den knalligen Dirnenschick und für die Pseudoeleganz und Pseudograzie der Kabarett- und Operettensängerinnen.
Jedes Mal, wenn eine der Fechterinnen ausfiel, durchlief ein Zucken der Freude das Publikum. Besonders die eine, die dem Publikum den Rücken zuwandte, ließ den Mund und die Augen der Zuschauer aufsperren, und es war nicht gerade das Spiel der Handgelenke, was man am gierigsten betrachtete.
Sie erhielten tosenden Beifall.
Es folgte ein Säbelfechten, das aber kaum beachtet wurde; denn alle lauschten neugierig, was über ihnen eigentlich vorging. Seit einigen Minuten hatte man ein Geräusch vernommen, als ob man eine Wohnung ausräumte; die Möbel wurden lärmend umhergerückt und über den Fußboden geschleift. Plötzlich ertönte durch die Decke Klavierspielen und man hörte ganz deutlich ein rhythmisches Stampfen der Füße. Die Gäste oben hatten einen Ball veranstaltet, um sich dadurch zu entschädigen, dass sie nichts gesehen hatten.
Das Publikum im Fechtsaal brach zuerst in lautes Gelächter aus, dann aber erwachte bei den Damen die Tanzlust, sie kümmerten sich nicht darum, was auf dem Podium vorging und sprachen ganz laut miteinander. Man fand den Einfall der Zuspätgekommenen, einen Ball zu veranstalten, sehr witzig; da oben langweilten sich die Leute offenbar nicht, und nun wollte man auch hinauf.
Inzwischen waren zwei neue Kämpfer aufgetreten; sie salutierten und nahmen Stellung ein, so sicher und gebieterisch, dass alle Blicke ihre Bewegungen aufmerksam verfolgten. Sie fielen aus und richteten sich auf mit solcher elastischen Grazie, mit so maßvoller Energie, mit so sicherer Kraft und so ruhigen kunstgerechten Bewegungen, dass auch die laienhafte Menge überrascht und hingerissen wurde.
Ihre Genauigkeit beim Treffen, ihre besonnene Gewandtheit, ihre schnellen Bewegungen, die so gut berechnet waren, dass sie langsam erschienen, zogen die Blicke auf sich und fesselten sie durch die Macht der Vollkommenheit ihrer Kunst. Das Publikum fühlte, dass ihm hier etwas selten Schönes vorgeführt wurde, dass zwei große Künstler in ihrem Fach das Beste vorführten, was es an Geschicklichkeit, List, Erfahrung und physischer Kraft geben konnte. Niemand sprach ein Wort, so sehr waren alle Blicke an sie gefesselt. Dann, als sie den letzten Stoß gewechselt, und sich die Hand geschüttelt hatten, brach ein tobender Beifallssturm aus. Man stampfte mit den Füßen, man schrie und heulte. Jeder kannte ihre Namen: es waren Sergent und Ravignac.
Die aufgeregten Gemüter wurden streitsüchtig. Die Männer sahen ihre Nachbarn misstrauisch und feindlich an; man hätte eines Lächelns wegen leicht ein Duell provozieren können; sogar Leute, die nie ein Florett in der Hand gehalten hatten, probierten mit ihren Spazierstöcken alle möglichen Hiebe und Paraden.
Nach und nach strömte jedoch die Menge die kleine Treppe wieder hinauf. Man wollte endlich etwas zu trinken haben. Ein allgemeiner Unwille entstand, als man feststellte, dass die Tanzlustigen das Büfett bereits vollständig ausgeplündert hatten, dann mit der Erklärung fortgegangen waren, es wäre unerhört, zweihundert Menschen hierher zu bestellen und ihnen überhaupt nichts zu zeigen.
Nichts war mehr da, keine Süßigkeit, kein Stückchen Kuchen, kein Tropfen Champagner, keine Limonade, Bier, keine Früchte, nichts. Alles war geplündert, geraubt und fortgegessen.
Man ließ die Diener die Einzelheiten erzählen; sie bemühten sich dabei ernste Gesichter zu machen, konnten jedoch das Lachen kaum unterdrücken. »Die Damen waren wilder als die Männer,« versicherten sie, »sie haben gegessen und getrunken, bis sie krank wurden.« Es klang fast so, als schilderten Überlebende den Überfall und die Plünderung einer Stadt während eines Raubzuges.
Nun musste man also aufbrechen. Die Herren bedauerten die zwanzig Francs, die sie gespendet hatten und ärgerten sich über alle, die oben umsonst geschlemmt hatten.
Die Patronatsdamen hatten über dreitausend Francs gesammelt. Nach Abzug aller Unkosten blieben für die Waisenkinder des 6. Stadtbezirkes zweihundertzwanzig Francs übrig.
Du Roy hatte die Familie Walter hinausbegleitet und wartete auf seinen Landauer. Auf der Heimfahrt saß er Frau Walter gegenüber und begegnete wieder ihrem zärtlichen und flüchtigen Blick, der verlegen und verwirrt schien. »Ich glaube wahrhaftig, sie beißt an«, dachte er. Er lächelte dankbar und zufrieden, denn nun war er sicher, dass er wirklich Glück bei Frauen hatte, denn Madame de Marelle schien ihn auch, seitdem ihr Liebesverhältnis von Neuem begonnen hatte, rasend und leidenschaftlich zu lieben.
Er kam sehr vergnügt nach Hause.
Madeleine erwartete ihn im Salon.
»Ich habe Neuigkeiten«, sagte sie. »Die Marokkoangelegenheit wird immer verwickelter. Es ist sehr gut möglich, dass Frankreich schon binnen wenigen Monaten eine Expedition dorthin schicken wird. Auf jeden Fall wird man das benutzen, um das Ministerium zu stürzen, und dann bekommt Laroche-Mathieu endlich das Portefeuille des Auswärtigen.
Du Roy wollte seine Frau etwas necken, und tat so, als glaube er kein Wort. »Man würde doch nicht so töricht sein, mit den Dummheiten von Tunis von Neuem zu beginnen.«
Sie zuckte ungeduldig die Achseln. »Aber ich sage dir, es ist so, es ist so! Begreifst du denn nicht, dass es eine wichtige Geldfrage für sie ist. Heutzutage, mein Lieber, bei allen wichtigen politischen Angelegenheiten, muss man sich fragen: ›Wo steckt das Geschäft?‹ Aber nicht wie früher: ›Wo steckt die Frau?‹«
»Ah«, murmelte er mit gleichgültiger Miene, um sie noch mehr zu reizen.
»Du bist genau so naiv wie Forestier«, sagte sie wütend.
Sie wollte ihn verletzen und erwartete einen Zornesausbruch. Aber er lächelte und sagte:
»Wie Forestier, den du betrogen hast?«
»Oh! Georges!« murmelte sie getroffen.
»Was denn«, sagte er spöttisch. »Hast du mir nicht selbst gesagt, dass du Forestier betrogen hast?« Und im Tone tiefsten Mitleides setzte er hinzu: »Armer Teufel!«
Madeleine antwortete nichts und drehte ihm den Rücken; dann nach einer kurzen Pause sagte sie:
»Wir werden Dienstag Gäste haben. Frau Laroche-Mathieu kommt mit der Vicomtesse de Percemur zum Essen. Willst du noch Rival und Norbert de Varenne einladen? Ich will morgen Madame Walter und Madame de Marelle besuchen. Vielleicht kommt Madame Rissolin auch noch.«
Seit einiger Zeit nutzte sie den politischen Einfluss ihres Mannes aus, um neue Beziehungen anzuknüpfen, und die Frauen der Deputierten und Senatoren, die die Unterstützung der Vie Française brauchten, in ihr Haus zu ziehen.
»Sehr gut,« antwortete Du Roy, »Rival und Norbert werde ich einladen.«
Er rieb sich zufrieden die Hände, denn er hatte jetzt eine gute Waffe gefunden, um seine Frau zu ärgern und seinen heimlichen Hass, seine unklare und quälende Eifersucht, die in ihm seit jener Spazierfahrt im Bois erwacht war, zu befriedigen. Er redete nie anders mehr von Forestier, ohne darauf zu deuten, dass ihm Hörner aufgesetzt worden waren. Er fühlte, dass er damit Madeleine zum Rasen bringen konnte. Und zehnmal am Abend fand er Gelegenheit, den Namen dieses »Hahnreis von Forestier« in wohlwollender Ironie zu nennen.
Er hasste nicht mehr den Toten; er wollte ihn rächen.
Seine Frau schien es nicht zu hören und saß ruhig mit ihrem gleichgültigen Lächeln ihm gegenüber.
Da sie am nächsten Tag Frau Walter besuchen wollte, ging er etwas früher hin, um die Frau seines Chefs allein zu finden und sich zu überzeugen, ob sie wirklich in ihn verliebt war. Das amüsierte und schmeichelte ihm. Und dann … warum nicht … wenn es möglich ist. Um zwei Uhr war er auf dem Boulevard Malesherbes. Man führte ihn in den Salon; er wartete.
Bald erschien Frau Walter und reichte ihm freudig die Hand.
»Welch glücklicher Zufall führt Sie her?«
»Kein Zufall, nur das Verlangen, Sie zu sehen. Eine Macht hat mich zu Ihnen getrieben, ich weiß es selbst nicht warum; ich habe Ihnen auch gar nichts Bestimmtes zu sagen. Ich bin gekommen! Ich bin da! Können Sie mir diesen frühen Besuch und die Offenheit meiner Erklärung verzeihen?«
Er sagte das alles galant und scherzhaft, mit einem Lächeln auf den Lippen, aber mit Ernst in der Stimme.
Sie wurde rot und murmelte:
»Aber wirklich … ich verstehe nicht — Sie überraschen mich — —«
»Das ist eine heitere Liebeserklärung, um Sie nicht zu erschrecken«, fügte er hinzu. Sie setzten sich hin. Sie nahm die Worte als Scherz auf.
»Also, das ist eine ernste Erklärung?«
»Aber ja! Schon lange, sogar sehr lange hatte ich sie auf dem Herzen, aber ich wagte nicht, sie auszusprechen. Sie sollen so streng und kalt sein …«
Jetzt wurde sie wieder sicher und fragte:
»Warum haben Sie denn gerade heute gewählt?«
»Ich weiß es nicht.«
Dann sagte er ganz leise:
»Vielmehr, weil ich seit gestern nur an Sie denke.«
Sie wurde plötzlich bleich und murmelte:
»Genug jetzt von diesen Kindereien, sprechen wir von etwas anderem.«
Aber er fiel so plötzlich vor ihr auf die Knie, so unerwartet, dass sie einen Schreck kriegte. Sie wollte aufstehen, aber er hielt sie mit beiden Armen fest und flüsterte ihr leidenschaftlich zu:
»Ja, es ist wahr, ich liebe Sie seit langem, wahnsinnig. Antworten Sie mir nicht. Begreifen Sie es denn nicht? Ich bin wahnsinnig. Ich liebe Sie … Oh, wenn Sie wüssten, wie ich Sie liebe!«
Sie atmete schwer, keuchte, versuchte zu sprechen, aber kein Wort kam über ihre Lippen. Sie stieß ihn mit beiden Händen zurück, sie fasste ihn am Haar und versuchte seinen Küssen auszuweichen. Sie bog ihren Kopf nach links und nach rechts, mit einer schnellen hastigen Bewegung und schloss die Augen, um ihn nicht mehr zu sehen.
Er berührte durch das Kleid ihren Körper, er streichelte und betastete sie; ihr Widerstand schwand unter dieser hastigen und rohen Liebkosung. Er stand auf, um sie ganz an sich zu ziehen, aber in dieser Sekunde entwischte sie ihm und flüchtete von einem Sessel zum anderen. Eine Verfolgung kam ihm lächerlich vor; er ließ sich in einen Stuhl nieder, verbarg sein Gesicht in den Händen und schien krampfhaft zu schluchzen. Dann sprang er auf, rief: »Adieu, adieu!« und stürzte hinaus.
Er nahm im Vorzimmer seinen Spazierstock und ging ruhig die Treppe hinab, indem er sich sagte: »Wahrhaftig, ich glaube, die Sache geht gut.«
Er ging auf ein Telegrafenbüro und schickte Clotilde ein blaues Briefchen; er bat sie für morgen um ein Rendezvous.
Als er zur gewohnten Stunde heimkehrte, fragte er seine Frau:
»Nun, hast du alle deine Leute zum Diner beisammen?«
»Ja, nur Madame Walter hat mir noch nicht bestimmt zugesagt. Sie weiß nicht, ob sie frei sein wird; sie ist unentschlossen und erzählte mir Gott weiß was für Geschichten über ihre Pflichten und ihr Gewissen. Mir schien das etwas komisch zu sein. Es ist übrigens egal, ich hoffe, sie kommt schließlich doch.«
Er zuckte die Achsel.
»Ich glaube es auch, sie wird kommen.«
Trotzdem war er seiner Sache nicht ganz sicher und blieb etwas unruhig bis zum Tage des Diners.
Am selben Tage früh morgens erhielt Madeleine einen kurzen Brief von Frau Walter: »Ich habe mich mit großer Mühe für heute Abend frei gemacht. Ich komme mit größtem Vergnügen; leider kann mein Mann mich nicht begleiten.«
Du Roy dachte sich: »Es war ganz schlau von mir, dass ich nicht wieder hingegangen bin. Jetzt hat sie sich beruhigt, aber — Vorsicht!«
Ungeduldig erwartete er sie. Sie erschien sehr ruhig, etwas kühl und abweisend. Er benahm sich sehr bescheiden zurückhaltend und sogar demütig. Madame Laroche-Mathieu und Madame Rissolin kamen mit ihren Männern. Die Vicomtesse de Percemur sprach über die vornehme Welt. Madame de Marelle war reizend in ihrem geschmackvollen Fantasiekleid, es war ein eigentümliches schwarz-gelbes spanisches Kostüm, das ihre hübsche Figur, ihren Busen und die schönen Arme vorteilhaft zur Geltung brachte und ihrem Vogelgesichtchen einen energischen Ausdruck verlieh.
Du Roy führte Frau Walter zu Tisch, aber er sprach mit ihr nur über ernsthafte Dinge und mit einer etwas übertriebenen Ehrfurcht. Von Zeit zu Zeit blickte er Clotilde an. »Sie ist ja freilich hübscher und frischer«, dachte er. Dann fiel sein Blick auf seine Frau, die fand er auch nicht übel, obgleich er gegen sie eine zähe, versteckte und grimmige Wut hatte. Aber Frau Walter reizte ihn durch die Schwierigkeiten der Eroberung und durch die Abwechslung, die Männer immer lieben und begehren.
Sie wollte frühzeitig nach Hause.
»Ich werde Sie begleiten«, sagte er.
Sie weigerte sich, aber er bestand darauf.
»Warum wollen Sie nicht. Sie verletzen mich tief. Ich muss doch annehmen, dass Sie mir nicht verzeihen wollen. Sie sehen, wie ruhig ich bin.«
»Sie können Ihre Gäste nicht so im Stich lassen«, erwiderte sie.
Er lächelte:
»Ach was, in zwanzig Minuten bin ich wieder da. Kein Mensch wird es merken. Wenn Sie nein sagen, verletzen Sie mich bis ins Tiefste meines Herzens.«
»Gut, ich bin einverstanden«, murmelte sie.
Kaum waren sie im Wagen, da ergriff er ihre Hände und küsste sie leidenschaftlich.
»Ich liebe Sie, ich liebe Sie. Lassen Sie es mich Ihnen sagen. Ich rühre Sie nicht an. Ich will nur immerfort wiederholen, dass ich Sie liebe.«
Sie stammelte:
»Oh, … nachdem Sie mir versprochen haben — Das ist nicht recht … Das ist schlecht von Ihnen.«
Er tat, als müsse er sich mit Gewalt beherrschen; dann fuhr er mit verhaltener Stimme fort:
»Sehen Sie, wie ich mich beherrsche. Und doch … lassen Sie mich nur das eine sagen … Ich liebe Sie … lassen Sie mich es Ihnen täglich wiederholen … ja, gönnen Sie mir täglich einen Besuch von fünf Minuten … lassen Sie mich auf den Knien Ihnen diese Worte wiederholen und Ihr geliebtes Antlitz bewundern …«
Sie hatte ihm ihre Hand gelassen und wiederholte schweratmend:
»Nein, ich kann nicht, ich will nicht. Denken Sie doch, was man sagen wird, denken Sie an die Dienstboten, an meine Töchter, Nein, es ist ausgeschlossen.«
Er fuhr fort:
»Ich kann nicht ohne Sie leben. Ob bei Ihnen oder wo anders — ich muss Sie sehen, und wenn es täglich nur eine Minute wäre, damit ich Ihre Hand berühre, den Duft Ihres Kleides einatme, die Linie Ihres Körpers und Ihre großen schönen Augen, die mich wahnsinnig machen, betrachten kann.«
Sie hörte die banalen Liebesphrasen an, bebte am ganzen Körper und stammelte:
»Nein … nein, es ist unmöglich, schweigen Sie!«
Er flüsterte ihr ganz leise ins Ohr, denn er hatte begriffen, dass er diese unkomplizierte Frau nur allmählich erobern konnte, dass er sie bestimmen musste, ihm ein Rendezvous zu geben, zunächst, wo sie wollte und dann, wo er wollte.
»Hören Sie mich,« sagte er, »es muss sein … ich werde Sie sehen … ich werde auf Sie vor Ihrer Tür warten … wie ein Bettler … ich gehe hinauf … aber ich werde Sie sehen … ich muss Sie sehen … morgen.«
Sie wiederholte:
»Nein, nein, kommen Sie nicht. Ich werde Sie nicht: empfangen. Sie müssen an meine Töchter denken.«
»Dann sagen Sie mir, wo ich Sie treffen kann. … auf der Straße … wo es auch sei … zu jeder Zeit: … wann Sie wollen … nur dass ich Sie sehen darf … Ich werde Sie begrüßen und Ihnen sagen: ›Ich liebe Sie’, und werde gehen.«
Sie zögerte, wusste nicht, was sie tun sollte. Und da der Wagen schon vor ihrer Tür hielt, murmelte sie sehr schnell:
»Ich werde morgen um halb vier in die Trinité-Kirche kommen.«
Dann stieg sie aus und befahl dem Kutscher:
»Fahren Sie Herrn Du Roy nach Hause.«
Als er zurückkam, fragte ihn seine Frau: »Wo warst du denn so lange?«
»Ich musste ein wichtiges Telegramm aufgeben«, antwortete er leise.
Madame von Marelle trat auf ihn zu.
»Werden Sie mich nach Hause bringen, Bel-Ami«, fragte sie: »Sie wissen, dass ich nur unter dieser Bedingung so weit vom Hause Einladungen zum Diner annehme!«
Dann wandte sie sich an Madeleine.
»Du bist doch nicht eifersüchtig?«
»Nein, nicht die Spur«, antwortete Frau Du Roy langsam.
Die Gäste brachen auf, Frau Laroche-Mathieu sah wie ein kleines Provinzmädel aus. Sie war die Tochter eines Notars und heiratete Laroche, als er noch ein unbedeutender Rechtsanwalt war. Frau Rissolin war alt und prätentiös und machte den Eindruck einer alten Hebamme, deren Bildung aus einer Leihbibliothek stammte. Die Vicomtesse de Percemur schien alle Anwesenden zu verachten, und sehr ungern berührten ihre »Samtpfötchen« diese gemeinen Plebejerhände.
Clotilde, in einen Spitzenschal gehüllt, sagte beim Hinausgehen zu Madeleine:
»Dein Diner ist fabelhaft gelungen. Du wirst bald den besten politischen Salon in Paris haben.«
Als sie mit Georges allein war, umarmte sie ihn und sagte:
»Du, mein lieber Bel-Ami, von Tag zu Tag liebe ich dich mehr.«
Der Wagen schaukelte wie ein Boot. »Unser Zimmer ist doch viel schöner«, sagte sie. »O ja«, antwortete er, aber er dachte dabei an Frau Walter.