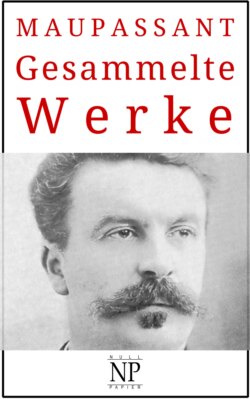Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 29
I.
ОглавлениеDie Kassiererin gab auf sein 5-Francs-Stück das Geld heraus und Georges Duroy verließ das Lokal. Stattlich gewachsen, richtete er sich auf mit der Haltung eines ehemaligen Unteroffiziers und drehte schneidig-militärisch seinen Schnurrbart zwischen den Fingern. Er warf auf die übriggebliebenen Gäste einen schnellen, flüchtigen Blick; einen jener Blicke des schönen Burschen, die unfehlbar treffen, wie der Raubvogel seine Beute.
Die Frauen blickten ihm neugierig nach: es waren drei kleine Nähmädchen, eine Musiklehrerin unbestimmten Alters, schlecht gekämmt, nachlässig gekleidet mit einem alten, verstaubten Hut und einem Kleid, das niemals sitzen wollte. Dazu zwei bürgerliche Frauen mit ihren Männern, Stammgäste des kleinen Lokals mit »festen Preisen«.
Auf der Straße blieb er einen Augenblick stehen und überlegte, was er unternehmen sollte. Es war der 28. Juni — in der Tasche blieben ihm 3 Francs 40 Centimes für den Rest des Monats übrig. Dafür konnte er sich zwei Mittagessen leisten, dann allerdings kein Frühstück, oder umgekehrt. Er überlegte sich, dass ein Frühstück nur 22 Sous, ein Mittagessen dagegen 30 kostete. Begnügte er sich bloß mit dem Frühstück, so würden ihm 1 Francs 20 Centimes verbleiben, das bedeutete zweimal Würstchen mit Brot und zwei Glas Bier auf dem Boulevard. Dies war sein kostspieliges Vergnügen, das er sich abends gönnte.
Daraufhin ging er die Rue Notre-Dame de Lorette hinunter.
So schritt er dahin, wie zurzeit, als er die Husarenuniform trug, in strammer Haltung mit etwas gespreizten Beinen, wie ein Reiter, der eben vom Pferde gestiegen ist. Ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, ging er seinen Weg durch die Straßenmenge. Er stieß die Passanten und wollte niemandem ausweichen. Seinen alten Zylinderhut rückte er etwas auf das eine Ohr, und laut klangen seine Schritte auf dem Pflaster. Verächtlich und herausfordernd betrachtete er die Menschen, die Häuser, die ganze Stadt: er — der schicke, schneidige Soldat, der zufällig Zivilist war.
Sein fertiggekaufter Anzug kostete nur 60 Francs, trotzdem trug er eine gewisse betont knallige Eleganz zur Schau; etwas ordinär, dafür echt und eindrucksvoll. Groß und schön gewachsen, hatte er dunkelblondes, rötliches, von Natur krauses Haar, das in der Mitte gescheitelt war; mit einem kecken Schnurrbart, der sich auf seiner Oberlippe kräuselte, und hellen, blauen Augen mit kleinen Pupillen, sah er dem Mordskerl aus einem Hintertreppenroman ähnlich.
Es war ein heißer Sommertag. Kein frischer Luftzug regte sich in Paris. Die Stadt glühte wie ein Kessel und erstickte in der schwülen Nacht. Die Straßenkanäle hauchten üblen Duft aus ihren Granitrachen, und aus den Küchen und Kellerräumen drangen ekle Gerüche von Spülwasser und alten Speiseresten auf die Straße.
Unter den Haustoren saßen die »concierges« (Hauswarte) in Hemdsärmeln rittlings auf ihren Strohsesseln und rauchten die Pfeife. Träge schlichen die Menschen dahin, mit entblößtem Kopf, den Hut in der Hand tragend.
Als Georges Duroy den Boulevard erreichte, blieb er stehen, unschlüssig, was er nun tun sollte. Er hatte Lust, in die Champs Elysée und die Avenue du Bois de Boulogne zu gehen, um unter den Bäumen etwas frische Luft zu schöpfen.
Aber ein anderes Verlangen regte sich in ihm, und zwar nach einem Liebesabenteuer. Wie ihm so ein Abenteuer in den Weg laufen sollte, davon hatte er keine Ahnung, aber seit drei Monaten wartete er darauf jeden Tag und jeden Abend. Dank seiner schönen, stattlichen Erscheinung hatte er wohl hier und da ein bisschen Liebe kosten dürfen; genügen tat ihm das nicht, er hoffte immer auf mehr und auf Besseres.
Mit heißem Blut aber leerer Tasche erregten ihn die Dirnen, die ihm an den Straßenecken zumurmelten: »Komm mit, feiner Junge«, doch er getraute sich nicht, ihnen zu folgen, denn bezahlen konnte er sie nicht, und dann träumte er auch von anderem, von etwas vornehmerer Liebe und minder gemeinen Küssen.
Trotzdem liebte er die Orte, wo es von jenen öffentlichen Mädchen wimmelte; er suchte gern ihre Ballokale, ihre Cafés, ihre Straßen auf. Er liebte, sie anzusprechen, sie zu duzen, ihre aufdringlichen Parfüms einzuatmen und ihre Nähe zu fühlen. Sie waren doch schließlich Frauen; Frauen, die zur Liebe bestimmt waren. Verachten tat er sie nicht, so wie jeder Mann sie verachtete, der im Schoß der Familie aufgewachsen ist.
Er lenkte seine Schritte nach der Madeleinekirche und folgte dem Menschenstrom, der sich, von der Hitze bedrückt, schwerfällig dahinwälzte.
Die Cafés waren überfüllt, dichtgedrängt saßen die Menschen am Bürgersteig, im grellen, blendenden Licht der erleuchteten Fenster. Vor ihnen auf kleinen runden oder viereckigen Tischen standen Gläser mit roten, gelben, grünen und in allen Farben schillernden Flüssigkeiten, und in den Karaffen sah man große, durchsichtige Eisstücke glänzen, die das schöne, klare Wasser kühlten.
Duroys Schritte wurden langsamer, und das Verlangen nach einem erfrischenden Getränk trocknete ihm die Kehle. Ihn packte ein glühender Durst, ein Durst eines heißen Sommerabends; er dachte immerfort an das köstliche Gefühl, wenn ihm etwas Kaltes durch die Kehle rinnt. Wenn er sich aber heute auch nur zwei Glas Bier gestattete, dann war es morgen mit seinem kargen Abendbrot vorbei, und die Stunden des Hungers am Monatsende waren ihm nur zu wohl bekannt.
Er sagte sich: »Bis zehn Uhr muss ich aushalten, und dann trinke ich einen Bock à l’Americain. Donnerwetter, habe ich jetzt einen Durst!« Und er blickte all diese Menschen an, die an den Tischen saßen, tranken und ihren Durst löschen konnten, so viel sie wollten. Und während er äußerlich keck und zuversichtlich an den Cafés vorüberging, taxierte er mit raschem Blick nach dem Aussehen und der Kleidung eines jeden Gastes, wie viel Geld er wohl mit sich trug. Eine Wut ergriff ihn gegen diese ruhig dasitzenden Leute. Wenn man ihre Taschen durchsuchte, so würde man Gold, Silber und Kleingeld finden. Durchschnittlich musste jeder wohl zwei Zwanzigfrancsstücke bei sich haben, etwa hundert Menschen saßen in jedem Café, und hundertmal zweimal zwanzig macht viertausend Francs. »Schweinehunde!« murmelte er vor sich hin und ging mit wiegenden Schritten weiter. Hätte er nur einen an irgendeiner dunklen Straßenecke fassen können, würde er ihm weiß Gott ohne Bedenken den Hals umgedreht haben, wie er es mit den Dorfhühnern an den Tagen der großen Manöver tat.
Er dachte an seine zwei Dienstjahre in Afrika und an die Art und Weise, wie man in den kleinen Vorposten im Süden den Arabern das Geld abnahm. Ein grausames, zufriedenes Lächeln glitt über seine Lippen, als er eines Streiches gedachte, der drei Männern vom Stamme der Uled-Alan das Leben kostete und ihm und seinen Kameraden zwanzig Hühner, zwei Schafe und Gold einbrachte und heiteren Gesprächsstoff für sechs Monate.
Die Schuldigen waren nie entdeckt worden, man hatte sie auch freilich nie gesucht, da der Araber sozusagen als natürliche Beute der Soldaten galt.
In Paris war das anders. Hier konnte man nicht mit dem Säbel an der Seite und dem Revolver in der Faust, fern vom wachsamen Auge der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, in voller Freiheit herumplündern.
Wahrhaftig, er dachte mit Wehmut an diese zwei Jahre in der Wüste zurück. Wie schade, dass er nicht da unten geblieben war! Er hatte sich Besseres erhofft, als er heimkehrte. Und nun … Ach ja, jetzt hatte er, was er wollte!
Er schnalzte mit der Zunge, als wollte er konstatieren, wie völlig ausgedörrt sein Mund schon wäre.
Langsam und müde schob sich die Menge an ihm vorüber, und er dachte immer noch: »Dieses Pack! All diese Idioten haben Geld in der Westentasche!« Er rempelte die Menschen an und pfiff dazu eine lustige Melodie. Männer, die er geschubst hatte, drehten sich schimpfend um, und die Frauen riefen entrüstet: »Ungezogener Lümmel!« Er ging am Vaudeville vorbei und blieb vor dem Café Americain stehen. Er fragte sich, ob er nicht doch ein Glas Bier trinken sollte, so quälte ihn der Durst. Ehe er sich entschloss, sah er auf die beleuchtete Uhr mitten auf dem Fahrdamm. Es war ein Viertel nach neun. Er kannte sich zu genau: sobald das Glas Bier vor ihm stünde, würde er es mit einem Zug hinunterschlucken. Was sollte er dann bis elf Uhr anfangen?
Er überlegte: »Ich gehe noch bis zur Madeleine und kehre dann langsam zurück.«
Als er an die Ecke des Place de l’Opera kam, begegnete er einem dicken jungen Manne, dessen Gesicht ihm irgendwie bekannt erschien.
Er folgte ihm und suchte sich zu erinnern, während er halblaut vor sich hinsprach: »Zum Teufel, wo kenne ich diesen Kerl her?«
Er ging und grübelte, ohne dass es ihm einfiel; dann plötzlich erschien ihm derselbe Mensch durch einen eigentümlichen Vorgang des Gedächtnisses weniger dick, jünger, in Husarenuniform. »Halt, Forestier!« rief er laut, beschleunigte seine Schritte und klopfte dem vor ihm Gehenden auf die Schulter. Dieser wandte sich um, blickte ihn an und sagte:
»Was wünschen Sie, mein Herr?«
Duroy lachte: »Erkennst du mich nicht?«
»Nein.«
»George Duroy von den 6. Husaren.«
Forestier streckte ihm beide Hände entgegen: »Du bist es, Alter! Wie geht es dir?«
»Ausgezeichnet. Und dir?«
»Mir geht es nicht allzu gut. Denke dir, meine Brust ist wie aus Papiermaché. Sechs Monate im Jahr quält mich ein Husten, die Folge einer Bronchitis, die ich mir in Bougival geholt habe kurz nach meiner Rückkehr nach Paris. Es sind jetzt schon vier Jahre her.«
»So, du siehst aber ganz gesund aus.«
Forestier nahm seinen alten Kameraden am Arm und erzählte ihm von seiner Krankheit, von den Ärzten, die er konsultiert hatte, deren Meinungen und Ratschlägen und der Schwierigkeit, in seiner Stellung ihren Verordnungen zu folgen. Er sollte den Winter im Süden zubringen, aber wie konnte er das? Er war verheiratet, Journalist, und hatte eine gute Stellung. »Ich redigiere den politischen Teil in La Vie Française, ich schreibe die Senatsberichte für den ›Salut‹, und im ›Planete‹ erscheinen hin und wieder literarische Feuilletons von mir. Ich habe meinen Weg gemacht.«
Duroy war überrascht und sah ihn erstaunt an. Forestier hatte sich sehr verändert, er war reifer geworden. Sein Gebaren, seine Haltung zeigten den gesetzten, selbstsicheren Mann und sein Bäuchlein wusste von guten Diners zu erzählen. Früher war er mager, klein und schlank, ein ausgelassener Lebemann und streitsüchtiger Radaumacher, stets angeheitert. Die drei Jahre in Paris hatten aus ihm einen ganz anderen, einen beliebten und ernsthaften Menschen gemacht, der schon einige weiße Haare an den Schläfen hatte, obgleich er nicht mehr als siebenundzwanzig Jahre zählte.
Forestier fragte: »Wo gehst, du hin?«
Duroy antwortete: »Nirgends. Ich mache einen Spaziergang, bevor ich nach Hause gehe.«
»Weißt du was, willst du mich vielleicht nach der Vie Française begleiten? Ich habe noch ein paar Korrekturen zu erledigen. Dann wollen wir zusammen ein Glas Bier trinken?«
»Sehr gern.«
Und Arm in Arm gingen sie weiter mit der leichten Vertraulichkeit, die zwischen Schulkameraden und Waffengefährten herrscht.
»Was machst du in Paris?« fragte Forestier.
Duroy zuckte die Achseln: »Kurz gesagt, ich krepiere vor Hunger. Als meine Dienstzeit vorbei war, wollte ich hierher kommen, um … um mein Glück zu machen, oder vielmehr, um in Paris leben zu können. Seit sechs Monaten bin ich bei der Verwaltung der Nordbahn angestellt. Ich verdiene fünfzehnhundert Francs im Jahr, keinen Centime mehr.«
Forestier murmelte: »Zum Teufel, das ist nicht viel!«
»Das glaube ich. Aber was soll ich sonst anfangen? Ich bin allein, ich kenne niemanden und habe keine Protektion. An gutem Willen fehlt es mir schon nicht, aber die Mittel?«
Sein Freund betrachtete ihn vom Kopf bis zu den Füßen, wie ein praktischer Mensch, der einen Gegenstand abschätzt; dann versetzte er in überzeugtem Ton:
»Sieh mal, mein Junge, hier hängt alles von deinem Auftreten ab. Ein findiger Kopf bringt es hier leichter bis zum Minister als bis zum Bürochef. Man muss sich aufdrängen und nicht schüchtern bitten. Aber wie, zum Henker, kommt es, dass du nichts Besseres gefunden hast als eine Stelle bei der Nordbahn?«
»Ich habe überall gesucht«, erwiderte Duroy, »und nichts gefunden. Augenblicklich habe ich zwar etwas in Aussicht, man bietet mir eine Stelle als Stallmeister in der Reitbahn von Pellerin an. Da bekomme ich mindestens dreitausend Francs.«
Forestier blieb plötzlich stehen:
»Tu das nicht. Das ist dumm, wo du doch zehntausend Francs verdienen könntest. Du verschließt dir mit einem Schlage die Zukunft. In deiner Schreibstube bist du wenigstens versteckt, niemand kennt dich, und wenn du dich stark genug fühlst, kannst du eines schönen Tages auch von dort aus Karriere machen. Aber wenn du Stallmeister bist, dann ist alles aus. Du kannst geradesogut Oberkellner in einem Restaurant werden, wo ganz Paris verkehrt. Wenn du erst einmal Leuten der Gesellschaft oder ihren Söhnen Reitunterricht gegeben hast, dann könnten sie sich nicht mehr daran gewöhnen, dich als ihresgleichen zu betrachten.«
Er schwieg, dachte einige Sekunden nach und fragte:
»Hast du das Abiturium gemacht?«
»Nein, ich bin zweimal durchgefallen.«
»Das tut nichts, wenn du deine Studien nur einigermaßen zu Ende geführt hast. Wenn von Cicero oder Tiberius die Rede ist, dann weißt du ungefähr, wer das ist?«
»Ja, ungefähr.«
»Gut, mehr weiß überhaupt niemand, mit Ausnahme von einem Dutzend Dummköpfen, die nicht imstande sind, sich selbst zu helfen. Jedenfalls ist es nicht schwer, als intelligent und gebildet zu gelten. Man darf sich nur nicht bei einer offenbaren Unwissenheit erwischen lassen. Man dreht und wendet sich, man weicht dem Hindernis aus, umgeht es und bewältigt das andere mit Hilfe eines Konversationslexikons. Alle Menschen sind dumm wie die Gänse und unwissend wie Karpfen.«
Er sprach in ruhig spöttischem Tone, wie einer, der die Welt kennt und blickte dabei lächelnd auf die vorübergehende Menge. Plötzlich aber begann er zu husten und blieb stehen, bis der Anfall vorüber war. Dann fuhr er in mutlosem Ton fort:
»Ist es nicht entsetzlich, dass ich diese Bronchitis nicht los werde? Und jetzt sind wir mitten im Hochsommer. Oh! Im Winter geh ich nach Menton, um mich auszukurieren. Mag kommen, was will, meine Gesundheit geht mir über alles.«
Sie waren jetzt am Boulevard Poissonière und standen vor einer großen Glastür, die von innen mit einer Zeitung beklebt war. Drei Leute waren stehengeblieben, um das Blatt zu lesen.
Über dem Tor stand in großen Buchstaben aus Gasflammen der Name der Zeitung: »La Vie Française« geschrieben. Und die Passanten, die plötzlich in das grelle Licht dieser drei Worte traten, wurden nun auf einmal deutlich sichtbar wie am hellichten Tage, um dann sofort wieder im Dunkel zu verschwinden.
Forestier öffnete die Tür:
»Geh rein«, sagte er.
Duroy ging hinein, stieg eine pomphafte, schmutzige Treppe hinauf, die man von der Straße aus ganz überblicken konnte, ging durch das Vorzimmer, in dem zwei Bürodiener seinen Gefährten grüßten, bis er in einen Warteraum gelangte. Die Räume waren verstaubt und abgenutzt, mit Tapeten aus schmutzigem, unechtem, grünem Samt, die voller Flecken und hier und da durchlöchert waren, als hätten die Mäuse sie angeknabbert.
»Setz dich,« sagte Forestier, »ich bin in fünf Minuten wieder da.«
Und er verschwand hinter einer der drei Türen, die aus diesem Zimmer führten.
Der seltsame, eigentümliche, unbeschreibliche Geruch eines Redaktionsbüros erfüllte den Raum. Duroy blieb unbeweglich, etwas eingeschüchtert und überrascht sitzen.
Von Zeit zu Zeit liefen Leute an ihm vorbei; sie kamen aus einer Tür und verschwanden durch die andere, noch ehe er Zeit hatte, sie anzusehen. Bald waren es junge, sehr junge Leute mit geschäftigem Gesichtsausdruck, die in der Hand ein Blatt Papier trugen, das bei ihrem Laufen im Winde flatterte. Manchmal waren es auch Setzer, unter deren von Tinte beschmutzten Leinenkitteln man reinweiße Hemdkragen und eine elegante Tuchhose von modernem Schnitt sah. Vorsichtig trugen sie bedruckte Papierstreifen, frische, noch feuchte Korrekturfahnen. Bisweilen trat ein kleiner Herr mit einer etwas auffallenden Eleganz, mit einer etwas zu engen Taille, mit Beinkleidern, die zu eng anlagen, und mit übermäßig spitzen Schnabelschuhen, ein, irgendein Reporter, der Neuigkeiten aus der Lebewelt brachte. Auch andere kamen, ernste, gewichtige Persönlichkeiten. Sie trugen Zylinderhüte mit ganz flachen Rändern, als ob sie sich durch diese Form von der ganzen übrigen Menschheit unterscheiden wollten.
Forestier erschien wieder, Arm in Arm mit einem hochgewachsenen, mageren Mann in den dreißiger Jahren. Dieser war in einen Frack, mit weißer Krawatte, gekleidet, hatte dunkles Haar, einen Schnurrbart mit scharfgedrehten Spitzen und eine dreiste, selbstbewusste Miene. Forestier sagte zu ihm:
»Adieu, verehrter Meister!«
Der andere drückte ihm die Hand: »Auf Wiedersehen, mein Lieber!« und stieg dann, einen Spazierstock unter dem Arm, pfeifend die Treppe hinab.
»Wer ist das?« fragte Duroy.
»Jaques Rival — du weißt doch? — der berühmte Chronist und Duellant. Er hat eben seine Korrektur durchgelesen. Garin, Montel und er gelten augenblicklich als die geistvollsten und wirksamsten Feuilletonisten in ganz Paris. Für zwei Artikel, die er wöchentlich schreibt, verdient er bei uns jährlich dreißigtausend Francs.
Beim Weitergehen begegneten sie einem kleinen dicken Herrn mit langen Haaren und unsauberem Äußeren, der schweratmend die Treppe hinaufkam.
Forestier grüßte sehr tief:
»Norbert de Varenne,« sagte er, »der Dichter der ›Erloschenen Sonne‹, auch ein hochbezahlter Mann. Jede Erzählung, die er herausgibt, kostet dreihundert Francs und die allerlängsten haben noch nicht zweihundert Zeilen …
Aber komm jetzt ins Café Napolitain, ich sterbe vor Durst!«
Kaum hatten sie sich an den Tisch gesetzt, als Forestier rief: »Zwei Bier!« und dann sein Glas mit einem Zuge herunterstürzte, während Duroy das Bier mit langsamen Schlucken trank und sorgsam auskostete, wie eine wundervolle und seltene Kostbarkeit. Sein Gefährte schwieg, er schien nachzudenken und fragte dann plötzlich:
»Warum willst du es nicht mit dem Journalismus versuchen?«
Der andere blickte ihn überrascht an, dann sagte er:
»Aber… das ist … ich habe doch noch nie etwas geschrieben.«
»Ach was, man versucht es, man fängt an. Ich könnte dich zum Beispiel gebrauchen, um Erkundigungen einzuziehen und um Besuche zu machen. Du bekämst zu Anfang zweihundertfünfzig Francs und die Droschken bezahlt. Soll ich mit dem Chef sprechen?«
»Aber natürlich möchte ich das, sehr gerne.«
»Also dann sei so gut und komme morgen zu mir zum Essen. Es werden nur fünf oder sechs Personen sein: der Chef, Herr Walter, seine Frau, Jaques Rival und Norbert de Varenne, die du ja soeben gesehen hast, und schließlich noch eine Freundin meiner Frau. Also abgemacht?«
Duroy zögerte, errötete und wurde verwirrt. Endlich murmelte er:
»Es ist nur … ich habe keinen passenden Anzug …«
Forestier war starr.
»Was? Du hast keinen Frack? Teufel noch mal! Das ist doch etwas Unentbehrliches! In Paris kann man ein Bett vielleicht entbehren, einen Frack nie. Dann griff er plötzlich in seine Westentasche, zog eine Handvoll Geld hervor und legte zwei Zwanzigfrancsstücke vor seinen alten Freund hin, wobei er in einem herzlichen und vertrauten Ton sagte:
»Du gibst sie mir wieder, wenn du kannst. Leihe oder kaufe dir die nötigen Kleidungsstücke, indem du eine Anzahlung gibst. Jedenfalls erwarte ich dich morgen um halb acht in. meiner Wohnung, 17 Rue Fontaine, zu Tisch.«
Duroy war verwirrt, aber er nahm das Geld und stammelte:
»Du bist wirklich zu liebenswürdig, ich danke dir herzlich … Verlass dich darauf, ich werde es nie vergessen.«
»Gut, gut!« fiel ihm der andere ins Wort. »Nicht wahr, wir trinken noch ein Bier?« Und er rief: »Kellner, noch zwei Bock!«
Dann, als sie ausgetrunken hatten, fragte der Journalist:
»Willst du noch ein Stündchen bummeln?«
»Aber gewiss!«
Und sie brachen auf und gingen in der Richtung nach Madeleine.
»Was sollen wir tun?« fragte Forestier. »Man sagt, in Paris hat man stets was zu tun, wenn man bummelt. Das ist nicht wahr. Wenn ich abends bummeln will, weiß ich nie, wohin ich gehen soll. Eine Fahrt ins Bois macht nur Spaß, wenn noch ein Weib dabei ist, und da hat man nicht immer eins bei der Hand. Die Cafés mit Musik mögen meinen Drogisten mit seiner Frau zerstreuen, mich nicht. Was also tun? Nichts! Man müsste hier einen Sommergarten haben, wie den Park Monceau, der nachts geöffnet wäre, wo man ausgezeichnete Musik hörte und unter den Bäumen Erfrischungen nehmen könnte. Das wäre kein eigentliches Vergnügungslokal, aber ein Ort, wo man sich behaglich aufhalten könnte. Man müsste hohe Eintrittspreise nehmen, um hübsche Damen herbeizulocken. Man sollte da auf kiesbestreuten Fußwegen herumspazieren können, die elektrisch beleuchtet wären, und sich setzen können, wenn man Lust hätte, um von fern und nah Musik anzuhören. So etwas gab es früher bei Muzard, aber das war zu sehr Ballokal, zu viel Tanzmusik und zuwenig Platz, zuwenig Schatten und Dunkelheit. Es müsste ein sehr schöner, sehr großer Garten sein. Das wäre herrlich! … Also, wo willst du hin?«
Duroy war noch immer verlegen und wusste nicht, was er vorschlagen sollte. Endlich entschloss er sich:
»Ich kenne die Folies Bergère noch gar nicht, da möchte ich ganz gern einmal hin.«
»Donnerwetter!« rief Forestier, »die Folies Bergère? Da werden wir ja kochen wie im Backofen. Aber meinetwegen, es ist dort immer lustig.«
Sie gingen wieder zurück, um die Rue du Faubourg-Montmartre zu erreichen.
Die erleuchtete Fassade des Theaters warf grellen Schein auf die vier Straßen, die sich an dieser Stelle kreuzten. Eine Reihe von Droschken wartete auf den Schluss der Vorstellung.
Forestier ging hinein, Duroy hielt ihn zurück:
»Wir haben ja noch keine Billetts.«
Worauf der andere sehr selbstbewusst erwiderte:
»Wenn ich dabei bin, braucht man nicht zu bezahlen.«
Als er sich den drei Kontrolleuren näherte, grüßten sie ihn, und dem mittelsten reichte er die Hand. Der Journalist fragte: »Haben Sie noch eine gute Loge frei?«
»Aber gewiss, Herr Forestier.«
Er nahm den Zettel, der ihm gereicht wurde, öffnete die gepolsterte, kupferbeschlagene Tür, und sie befanden sich im Theaterraum.
Tabakdunst verschleierte wie ein leichter Nebel den Hintergrund, die Bühne und die entfernten Teile des Theaters. Dieser Nebel, der ununterbrochen in feinen bläulichen Streifen aus sämtlichen Zigarren und Zigaretten der Besucher emporstieg, ballte sich an der Decke und bildete unter der mächtigen Wölbung einen Wolkenhimmel von Rauch um den Kronleuchter und über der dicht mit Zuschauern besetzten Galerie.
In der geräumigen Vorhalle am Eingang, die zu den Wandelgängen führte, schweiften aufgeputzte Mädchen inmitten einer Menge dunkelgekleideter Männer umher, eine Gruppe von Frauen wartete auf die Ankömmlinge, und hinter den drei Schanktischen thronten drei geschminkte, welke Verkäuferinnen von Getränken und Liebe. In den hohen Scheiben hinter ihnen spiegelten sich ihre Rücken und die Gesichter der Vorübergehenden.
Forestier drängte sich schnell durch alle diese Gruppen und schritt rasch vorwärts, wie ein Mann, auf den man Rücksicht zu nehmen hat. Er trat an die Logenschließerin heran und sagte:
»Loge siebzehn!«
»Bitte, hier, mein Herr!«
Sie wurden in einen kleinen hölzernen Kasten eingeschlossen, der keine Decke hatte, rot tapeziert war und vier Stühle gleicher Farbe enthielt, die so eng aneinander standen, dass man sich kaum zwischen ihnen hindurchschieben konnte. Die beiden Freunde setzten sich. Nach rechts und links schlossen sich in weitem Bogen, dessen Enden auf die Bühne stießen, eine lange Reihe ähnlicher Kästen an, wo gleichfalls Menschen saßen, von denen man nur Kopf und Brust sehen konnte.
Auf der Bühne machten drei junge Männer in eng anliegenden Trikots, ein großer, ein mittlerer und ein ganz kleiner, abwechselnd Trapezkunststücke. Zunächst trat der große mit kurzen, schnellen Schritten an die Rampe vor, lächelte und grüßte mit einer Kusshand. Unter dem Trikot sah man die Muskeln seiner Arme und Beine arbeiten; er drückte seine Brust möglichst kräftig heraus, um seinen etwas zu dicken Bauch zu verbergen. Sein Gesicht glich dem eines Friseurgehilfen, und ein tadelloser Scheitel teilte sein Haar genau in der Mitte des Kopfes. Mit graziösem Sprung fasste er das Trapez und umkreiste es dann, mit den Händen daran hängend, wie ein rollendes Rad. Bisweilen hing er mit ausgestreckten Armen und steifem Körper unbeweglich wagerecht in der leeren Luft, indem er sich allein durch die Kraft seiner Handgelenke festhielt. Dann sprang er ab, grüßte nochmals lächelnd unter dem lauten Beifall des Parketts und trat wieder an die Wand zurück und zeigte bei jedem Schritt dem Publikum das Spiel seiner Muskeln.
Duroy hatte wenig Interesse für die Darbietung. Er wandte seinen Kopf und beobachtete unaufhörlich die hinter ihm vorbeiflutende Menge von Männern und Kokotten.
Forestier sagte: »Sieh dir mal die Leute im Parkett an, nichts als Spießbürger mit ihren Frauen und Kindern, alles brave, dumme Gesichter, die sich das hier ansehen wollen. In den Logen sitzen die Stammgäste der Boulevards, einige Künstler und Halbweltdamen, hinter uns findest du die seltsamste Mischung, die es in Paris geben kann. Was das für Männer sind? Beobachte sie mal: alles mögliche, alle Berufe und Klassen, aber das Gesindel überwiegt. Da sind die Kommis, Bankangestellte, Beamte, Verkäufer, ferner Reporter, Zuhälter, Offiziere in Zivil, Bummler im Frack, die grade im Restaurant gegessen haben und von der Großen Oper zu den Italienern rennen, und schließlich noch eine ganze Menge verdächtiger Individuen, aus denen man nicht recht klug wird. Was die Frauen angeht, so gibt es hier nur eine Art: die Halbwelt vom Americain. Sie verkaufen sich für ein oder zwei Goldstücke, wobei sie von Fremden auch fünf nehmen, und winken ihren ständigen Kunden zu, wenn sie frei sind. Man kennt sie alle seit zehn Jahren, man sieht sie jeden Abend das ganze Jahr hindurch in denselben Lokalen, mit Ausnahme, wenn sie einmal eine heilsame Kur im Frauengefängnis von St. Lazare oder im Lourcine durchmachen.«
Duroy hörte nicht mehr zu. Eins von diesen Mädchen lehnte sich über die Loge und sah ihn an. Es war eine üppige Brünette mit weißgeschminktem Gesicht und schwarzen Augen, die mit dem Farbstift unterstrichen waren, und riesigen, angemalten Augenbrauen. Über ihrer allzu starken Brust spannte sich die dunkle Seide ihres Kleides, und ihre geschminkten, blutroten Lippen gaben ihr etwas Tierisches, Sinnliches, Wildes, das aber trotzdem anziehend wirkte.
Sie winkte mit einer Kopfbewegung einer ihrer Freundinnen zu, die gerade vorbeikam, einer ebenfalls korpulenten, rothaarigen Kokotte, und sprach zu ihr so laut, dass man es hören konnte:
»Sieh mal her, das ist ein hübscher Junge. Wenn er mich für zweihundert Francs haben wollte, ich würde nicht nein sagen.«
Forestier drehte sich um und schlug Duroy lächelnd auf die Schenkel: »Das gilt dir, du hast Erfolg, mein Lieber, ich gratuliere!«
Der frühere Unteroffizier wurde rot und mechanisch tastete er nach den zwei Goldstücken in seiner Westentasche. Der Vorhang fiel und das Orchester begann einen Walzer zu spielen.
Duroy fragte: »Wollen wir nicht auch einmal durch den Wandelgang gehen?«
»Wie du willst.«
Sie verließen ihre Loge und waren sofort von dem Strom der Menge umgeben. Gedrückt, gepresst, hin und her gestoßen, gingen sie weiter und ein Wald von Hüten wogte vor ihren Augen. Zwischen Ellenbogen, Brüsten und Rücken der Männer drängten sich behänd paarweise die Kokotten hindurch, die sich hier so recht in ihrem Element, wie Fische im Wasser, zu fühlen schienen.
Duroy war entzückt. Er ließ sich treiben und wurde von der stickigen Luft, die durch Tabak, Menschenausdünstungen und Dirnenparfüms verpestet war, berauscht. Aber Forestier schwitzte, keuchte und hustete.
»Gehen wir in den Garten«, sagte er.
Sie wandten sich nach links und kamen in eine Art Wintergarten, wo zwei geschmacklose Fontänen ein bisschen kühle Luft schafften. Unter den paar Taxusbäumen und Thujas saßen Männer und Frauen an Zinktischen und tranken.
»Noch ein Bier?« fragte Forestier.
»Ja, gern.«
Sie setzten sich und beobachteten das Publikum. Von Zeit zu Zeit blieb ein herumspazierendes Mädchen stehen und fragte mit ordinärem Lächeln:
»Laden Sie mich nicht ein?« — Und wenn Forestier erwiderte : »Ja, zu einem Glas Wasser aus dem Springbrunnen«, so entfernte sie sich mit einem ärgerlichen Schimpfwort.
Aber die dicke Brünette tauchte wieder auf. Sie kam in übermütiger Haltung, Arm in Arm mit der dicken Rothaarigen. Sie bildeten wirklich ein hübsches, gut ausgesuchtes Frauenpaar.
Sobald sie Duroy erblickte, lächelte sie, als hätten sich ihre Augen schon vertraute und verschwiegene Dinge gesagt. Sie nahm einen Stuhl und setzte sich ruhig ihm gegenüber und ließ ihre Freundin auch Platz nehmen. Dann rief sie mit lauter Stimme:
»Kellner, zwei Grenadine!«
Erstaunt sagte Forestier:
»Du genierst dich wirklich nicht!«
»Ich bin in deinen Freund verliebt«, antwortete sie. »Er ist wirklich ein schöner Kerl. Ich glaube, ich könnte seinetwegen Dummheiten begehen.«
Duroy wusste vor Verlegenheit nicht, was er sagen sollte. Er drehte an seinem wohlgepflegten Schnurrbart und lächelte nichtssagend vor sich hin. Der Kellner brachte die Limonaden und die beiden Freundinnen tranken sie in einem Zuge aus. Dann standen sie auf und die Brünette nickte Duroy wohlwollend zu und gab ihm mit ihrem Fächer einen leichten Schlag auf den Arm: »Danke, mein Schatz. Du bist nicht sehr geschwätzig.«
Dann gingen sie fort, sich in den Hüften wiegend.
Forestier begann zu lachen:
»Sag mal, alter Freund, weißt du, dass du wirklich Erfolg bei Weibern hast? So was muss man pflegen, damit kann man sehr weit kommen.« Er schwieg eine Sekunde, dann setzte er hinzu mit dem träumerischen Ton von Leuten, die laut denken: »Durch sie erreicht man auch am meisten. Und als Duroy immer noch vor sich hin lächelte, ohne etwas zu erwidern, fragte er: »Bleibst du noch hier? Ich will nach Hause, ich habe genug.«
»Ja,« murmelte der andere, »ich bleibe noch etwas. Es ist ja noch nicht spät.«
Forestier stand auf. »Auf Wiedersehen, also bis morgen. Vergiss nicht, um halb acht abends, 17 Rue Fontaine.«
»Abgemacht, auf morgen, danke!« — Sie drückten sich die Hände, und der Journalist ging fort.
Sobald er fort war, fühlte Duroy sich frei. Er tastete vergnügt von Neuem nach den beiden Goldstücken in seiner Westentasche. Dann erhob er sich und mischte sich unter die Menge, die er suchend durchforschte.
Bald erblickte er die beiden Mädchen, die Brünette und die Rothaarige, die immer noch in stolzer Haltung durch die Menge zogen.
Er ging direkt auf sie zu. Als er ihnen ganz nahe war, verlor er wieder den Mut.
Die Brünette sagte: »Na, hast du deine Sprache wiedergefunden?«
Er stotterte: »Allerdings!« Ein zweites Wort konnte er aber nicht hervorbringen.
Alle drei blieben stehen und hielten die Bewegung der Spaziergänger auf, die einen Wirbel um sie bildeten.
Die Brünette fragte ihn plötzlich: »Kommst du zu mir?«
Er zitterte vor Begierde und erwiderte schroff:
»Ja, aber ich habe nur ein Goldstück in der Tasche.«
Sie lächelte gleichgültig: »Das tut nichts.«
Sie nahm ihn beim Arm, als Zeichen, dass sie ihn erobert hatte.
Als sie das Lokal verließen, überlegte er, dass er sich mit den anderen zwanzig Francs ohne Schwierigkeiten für den nächsten Abend einen Frack leihen könnte.