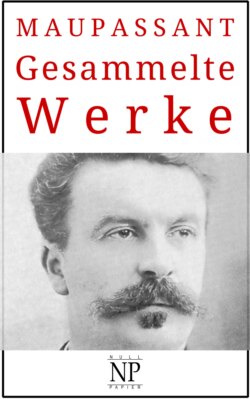Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 41
IV.
ОглавлениеDer Platz vor der Trinité-Kirche lag menschenleer in der glühenden. Julisonne. Eine drückende Hitze lastete über Paris, als wenn die schwere Luft von dort oben verbrannt und auf die Stadt herabgefallen wäre; es war eine dicke, schwüle; und versengende Luft, die den Lungen weh tat.
Das Wasser im Springbrunnen rieselte lässig herab. Es schien ermattet vom Springen, schlaff und müde, und das Wasser in dem Bassin, in dem Blätter und Papierfetzen herumschwammen, sah blaugrün, schwer und trübe aus. Ein Hund, der auf den steinernen Rand gesprungen war, badete in dieser verdächtigen Flüssigkeit. Ein paar Menschen, die auf den Bänken in den Anlagen herumsaßen, blickten voll Neid auf das Tier.
Du Roy zog seine Uhr. Es war erst drei Uhr; er hatte noch eine halbe Stunde Zeit. Er musste lachen, wenn er an dieses Rendezvous dachte: »Die Kirchen dienen zu allem möglichen,« sagte er sich, »sie trösten sie darüber, einen Juden geheiratet zu haben, geben ihr eine oppositionelle Haltung in der Politik, eine passende Stellung in der vornehmen Welt und ein Obdach für galante Abenteuer. Es ist nämlich die Gewohnheit, sich der Religion zu bedienen, wie man einen entoutcas-Schirm gebraucht. Ist das Wetter schön, dient er als Spazierstock, scheint die Sonne, so ist er ein Sonnenschirm, wenn es regnet ein Regenschirm, und wenn man überhaupt nicht ausgeht, lässt man ihn im Vorzimmer stehen. Und so gibt es Hunderte, die sich aus dem lieben Gott nichts machen und doch nicht gestatten, dass man ihn lästert und ihn dabei gern als Vermittler gebrauchen. Wenn man einer solchen Frau vorschlüge, in ein Absteigequartier zu gehen, so würde sie es mit Entrüstung zurückweisen und als Schande betrachten, aber sie findet gar nichts darin, am Fuße des Altars eine Liebesgeschichte anzuspinnen. Er ging langsam am Springbrunnen auf und ab und sah nochmals nach der Uhr auf dem Kirchturm, die im Vergleich zu seiner zwei Minuten vorging. Er dachte, dass es wohl drinnen angenehmer sein würde und ging hinein.
Die kühle Kellerluft des steinernen Gewölbes umfing ihn. Er atmete sie mit Behagen ein und ging dann durch das Kirchenschiff, um die Örtlichkeit zu übersehen. Aus der Tiefe des mächtigen Bauwerks tönte ein anderer regelmäßiger Schritt herüber; bald hielt er inne, bald hallte er wieder laut auf den Steinfliesen. Er suchte neugierig nach diesem Spaziergänger. Es war ein dicker, kahlköpfiger Herr, der mit der Nase in der Luft und den Hut hinter dem Rücken herumging. Hier und da kniete eine alte Frau, das Gesicht in die Hände vergraben. Ein Gefühl der Einsamkeit, des Verlassenseins und der Ruhe erfüllte seinen Geist, und das Licht, das durch die farbigen Scheiben fiel, tat den Augen wohl. Du Roy fand es hier drinnen »recht behaglich«. Er ging wieder an die Tür und sah abermals nach der Uhr. Es war erst ein viertel nach drei. Er setzte sich am Haupteingang und bedauerte sehr, dass er hier keine Zigarette rauchen dürfe. Vom anderen Ende der Kirche, in der Nähe des Chors, ertönten nach wie vor die langsamen, schallenden Schritte des dicken Herrn. Jemand kam herein. Du Roy drehte sich hastig um. Es war eine arme, einfache Frau im Wollrock; gleich beim ersten Stuhl fiel sie auf die Knie und verharrte hier mit gefalteten Händen, den Blick gen Himmel erhoben, die Seele im Gebet versunken.
Du Roy beobachtete sie; es interessierte ihn, welcher Kummer, welcher Schmerz oder welche Verzweiflung diese arme Seele in die Kirche getrieben hatte. Tiefstes Elend sah man ihr an. Vielleicht hatte sie einen Mann, der sie halbtot prügelte oder ein sterbendes Kind?
»Armes Wesen,« dachte er, »es gibt so viele, die leiden müssen!« Und er zürnte gegen die erbarmungslose Natur. Dann überlegte er sich, dass diese armseligen Leute wenigstens daran glaubten, dass dort oben ein Auge über sie wache und dass im Himmel ihr irdischer Lebenswandel mit der Bilanz von Soll und Haben verbucht sei. — Dort oben. — Wo denn eigentlich?
In der Stille der Kirche versank Du Roy in weltumspannende Träumereien. Er begann in Gedanken die ganze Schöpfung zu umfassen und er murmelte ganz leise vor sich hin: »Wie das alles eigentlich dumm ist.« Das Rauschen eines Kleides ließ ihn hochfahren.
Sie war es.
Er stand auf und ging schnell auf sie zu. Sie reichte ihm nicht die Hand und sagte nur ganz leise:
»Ich habe nur ein paar Augenblicke Zeit. Ich muss gleich wieder nach Hause. Knien Sie neben mir nieder, damit wir nicht auffallen.« Sie durchschritt das Kirchenschiff und suchte, wie jemand, der das Haus genau kannte, nach einem passenden ungestörten Platz. Ihr Gesicht war mit einem dichten Schleier bedeckt und sie ging mit gedämpften, kaum hörbaren Schritten. Als sie den Chor erreicht hatten, drehte sie sich um und sprach mit einer geheimnisvollen, kaum hörbaren Stimme, wie man in der Kirche zu sprechen pflegt:
»Es ist besser an der Seite; hier kann man zu leicht gesehen werden.«
Sie verbeugte sich tief vor dem Tabernakel des Hauptaltars und bog: dann nach rechts ein und ging wieder in der Richtung nach dem Eingange zurück. Plötzlich schien sie einen Entschluss zu fassen, nahm einen Betstuhl und kniete nieder. Georges nahm den danebenstehenden und so knieten sie unbeweglich in der Haltung von Betenden.
»Ich danke Ihnen, danke,« flüsterte er, »ich liebe Sie über alles. Ich möchte Ihnen das immerfort sagen, Ihnen erzählen, wie bei mir die Liebe zu Ihnen begonnen, wie ich beim ersten Mal, als ich Sie sah, von Ihrem Reiz und Ihrer Anmut bezaubert wurde … Wollen Sie mir einmal erlauben, Ihnen mein ganzes Herz auszuschütten, Ihnen all das zu erklären.«
Sie hörte zu, anscheinend tief in Gedanken versunken, als hätte sie überhaupt nichts vernommen.
»Ich bin wahnsinnig, dass ich Sie so mit mir sprechen lasse, wahnsinnig, dass ich gekommen bin, wahnsinnig, dass zu tun, was ich tue; Sie glauben zu lassen, dass dieses Abenteuer irgendeine Fortsetzung finden könnte. Vergessen Sie, es muss sein, und sprechen Sie nie davon.«
Sie wartete. Er suchte nach einer überzeugenden leidenschaftlichen Antwort, da er jedoch seine Worte durch Liebkosungen nicht verstärken konnte, fühlte er sich wie gelähmt.
»Ich erwarte nichts,« fuhr er fort, »ich erhoffe nichts. Ich liebe Sie. Sie können tun, was Sie wollen, ich werde es Ihnen immer wieder sagen, so leidenschaftlich und so eindringlich, dass Sie schließlich daran glauben werden. Ich werde meine Liebe und Zärtlichkeit in Sie eindringen lassen, Wort für Wort, Stunde für Stunde, Tag für Tag, bis sie Sie schließlich ergreifen, Sie milde stimmen und zuletzt auch Sie zu mir sagen müssen: ›Ich liebe Sie.’«
Er fühlte, wie ihre Schulter ihn zitternd berührte und wie ihre Brust bebte, dann flüsterte sie hastig:
»Auch ich liebe Sie.«
»O mein Gott!«
Sie fuhr mit bebender Stimme fort:
»Durfte ich Ihnen das sagen? Ich fühle mich schuldig und verachtungswert … ich … die ich zwei Töchter habe … aber ich kann nicht mehr … ich kann nicht … Ich hätte nie geglaubt … ich hätte nie gedacht … es war eben stärker als ich … Hören Sie … Hören Sie doch … Ich habe nie jemanden geliebt … nur Sie allein … ich schwöre es Ihnen, ich liebe Sie seit einem Jahr heimlich im Innern meines Herzens. Oh, was habe ich gelitten, ja, was habe ich mit mir kämpfen müssen … Ich kann nicht mehr, ich liebe Sie.«
Sie weinte in ihre Hände, die sie über ihrem Gesicht gefaltet hatte; ihr ganzer Körper zitterte, erschüttert von der leidenschaftlichen Erregung.
Georges flüsterte:
»Geben Sie mir Ihre Hand, dass ich sie berühre, dass ich sie an mich drücke.«
Langsam zog sie ihre Hand von ihrem Gesicht. Er sah, dass ihre Wangen ganz feucht vom Weinen waren. Ein Tropfen hing noch am Rande der Wimpern, bereit, herunter zu rollen.
Er ergriff ihre Hand und presste sie.
»Oh, ich möchte diese Tränen küssen.«
Sie sprach mit dumpfer und gebrochener Stimme, sodass es fast wie ein Seufzer klang:
»Missbrauchen Sie nicht meine Schwäche … ich habe den Kopf verloren.«
Er hatte Lust, zu lächeln. Wie konnte er sie an diesem Ort missbrauchen. Er presste ihre Hand an sein Herz und sagte: »Fühlen Sie es klopfen?«
Denn er war am Ende seiner leidenschaftlichen Redensarten und er wusste nicht mehr, was er sagen sollte.
Doch seit einigen Augenblicken kam der regelmäßige Schritt des dicken Herrn immer näher. Er war die Altäre entlang gegangen und kam nun wenigstens schon das zweite Mal das rechte Seitenschiff herunter. Frau Walter hörte ihn nun ganz nah neben dem Pfeiler, der sie vor ihm verbarg, sie zog ihre Hand aus Georges Umklammerung und verbarg von Neuem ihr Gesicht.
So blieben sie wieder unbeweglich nebeneinander knien, als hätten sie beide ein glühendes Gebet zum Himmel emporgesandt. Der dicke Herr ging an ihnen vorbei und warf auf sie einen gleichgültigen Blick, er verschwand nach dem unteren Teil der Kirche und hielt immer noch seinen Hut auf dem Rücken.
Du Roy dachte jetzt daran, dass er irgend woanders als in der Trinité-Kirche ein Rendezvous erhalten müsste.
»Wo werde ich Sie morgen sehen?« fragte er.
Sie antwortete nicht. Sie schien leblos; sie schien ganz wie ein versteinerter Ausdruck vom Gebet.
Er fuhr fort:
»Wollen Sie, dass wir uns im Parc Monceau treffen?«
Sie nahm ihre Hände vom Gesicht und wandte es ihm zu, es war tränenüberströmt, bleich und entstellt vor Schmerz. Sie sagte mit abgerissener Stimme:
»Lassen Sie mich … lassen Sie mich jetzt … gehen Sie … gehen Sie fort, nur fünf Minuten … ich leide so sehr in Ihrer Nähe … ich halte es nicht mehr aus … gehen Sie … lassen Sie mich beten … allein … fünf Minuten. Ich kann nicht … lassen Sie mich Gott um Vergebung anflehen … Er soll mir vergeben … Er soll mich retten … Lassen Sie mich … fünf Minuten lang.«
Der Ausdruck ihres Gesichtes war dermaßen verstört und schmerzerfüllt, dass er ohne ein Wort zu sagen aufstand; dann versetzte er nach einem kurzen Zaudern:
»Ich komme nach einer Weile wieder.«
Sie machte mit dem Kopf ein Zeichen, als wollte sie sagen: »Ja, nach einer Weile.« Und er ging zum Chor hinunter.
Nun versuchte sie zu beten, mit übermenschlicher Anstrengung wollte sie Gott anrufen und flehte mit zitterndem Körper und verzweifelter Seele um Erbarmen. Sie schloss wütend die Augen, um ihn nicht zu sehen, ihn, der sie eben verlassen hatte. Sie verscheuchte ihn aus ihren Gedanken, sie wehrte sich gegen ihn, doch an Stelle der himmlischen Erscheinung, die sie mit schwerem Herzen und gebrochener Seele erflehte, kam ihr der gekräuselte Schnurrbart des jungen Mannes nicht aus dem Sinne.
Seit einem Jahr kämpfte sie Tag für Tag und Abend für Abend gegen die immer zunehmende Leidenschaft, gegen dieses Bild, das sich in ihre Träume drängte, ihre Sinne quälte und ihr die Ruhe raubte. Sie fühlte sich gefangen wie ein wildes Tier in einem Netz, geknebelt und wehrlos diesem Manne ausgeliefert, der sie bezwungen und erobert hatte, einzig und allein durch seinen Schnurrbart und die Farbe seiner Augen.
Und jetzt in der Kirche in Gottes Nähe, fühlte sie sich noch schwächer, noch verlassener als bei sich zu Hause. Sie konnte nicht mehr beten, sie musste immerfort an ihn denken. Sie litt bereits darunter, dass er fort war, und doch kämpfte sie verzweifelt. Sie wehrte sich und rief mit der ganzen Kraft ihrer Seele um Hilfe. Sie wäre lieber gestorben, als so zu fallen, sie, die sie noch nie einen Fehltritt begangen hatte. Sie murmelte wirre, flehende Gebete, aber sie hörte nur auf Georges Schritte, die in den fernen Gewölben immer leiser und leiser wurden. Sie begriff, dass es nun mit ihrer Kraft zu Ende und dass jeder Widerstand vergeblich sei. — Trotzdem wollte sie nicht nachgeben. Sie zitterte am ganzen Leibe und fühlte sich so schwach und zusammengebrochen, dass sie gleich umfallen, auf dem Boden sich herumwälzen und heftige und schrille Schreie ausstoßen würde. Da hörte sie rasche Schritte herannahen. Sie wandte den Kopf, es war ein Priester. Sie stand auf, lief mit gefalteten Händen auf ihn zu und stammelte:
»Oh, retten Sie mich! Retten Sie mich!«
Er blieb überrascht stehen:
»Was wünschen Sie, Madame?«
»Ich will, dass Sie mich retten; haben Sie Erbarmen mit mir. Wenn Sie mir nicht zu Hilfe kommen, bin ich verloren!«
Er sah sie an, und dachte, ob sie vielleicht wahnsinnig wäre.
»Was kann ich für Sie tun?« fragte er.
Es war ein junger, hochgewachsener, etwas dicker Geistlicher, mit vollen, etwas schlaffen Backen, die, trotzdem sie sauber rasiert waren, einen gräulichen Schimmer hatten; es war ein schöner Stadtvikar, aus einem reichen Stadtviertel, der an wohlhabende Sünderinnen gewöhnt war.
»Hören Sie meine Beichte,« sagte sie, »und geben Sie mir einen Rat, helfen Sie mir und sagen Sie, was ich tun soll.«
»Ich höre die Beichte alle Sonnabende von drei bis sechs«, erwiderte er.
Aber sie fasste ihn am Arm und wiederholte:
»Nein, nein! nein! Sofort, sofort! Es muss sein! Er ist hier in dieser Kirche! Er erwartet mich!«
»Wer erwartet Sie denn?« fragte der Priester.
»Ein Mann, der mich verderben will, der mich verführen wird, wenn Sie mich nicht retten … Ich kann nicht mehr vor ihm fliehen … ich bin zu schwach … so schwach … so schwach …«
Sie warf sich vor ihm auf die Knie und schluchzte:
»Erbarmen Sie sich meiner, mein Vater! Retten Sie mich, im Namen Gottes, retten Sie mich!«
Sie hielt ihn an seinem schwarzen Priesterrock fest, damit er nicht fort konnte und er blickte unruhig nach allen Seiten, ob nicht irgendein übelwollendes oder zu frommes Auge die Frau zu seinen Füßen sehen konnte. Da er schließlich einsah, dass er sie nicht los würde, sagte er:
»Stehen Sie auf, ich habe zum Glück den Schlüssel zum Beichtstuhl bei mir.«
Er wühlte in seiner Tasche und zog einen Ring mit einer Menge Schlüssel daran heraus. Er suchte einen davon heraus und ging mit schnellem Schritt zu einer kleinen Holzhütte, in welcher die Frommen ihre Seelen von allen Sünden entlasten. Er trat durch die Mitteltür herein und schloss hinter sich ab, während Frau Walter sich in dem schmalen Seitenteil niederwarf und leidenschaftlich und inbrünstig stammelte:
»Segnen Sie mich, mein Vater, denn ich habe gesündigt.«
Du Roy hatte einen Gang um den Chor gemacht und schritt nun das linke Seitenschiff hinunter. Er war gerade in der Mitte, als er dem dicken, kahlköpfigen Herrn begegnete, der immer noch im langsamen, gemessenen Schritt auf und ab wanderte. »Was mag dieser Sonderling hier zu suchen haben?« fragte sich der junge Mann. Auch der Herr hatte seinen Schritt verlangsamt und blickte George:; an, mit dem sichtlichen Wunsch, mit ihm ein Gespräch anzufangen. Als er ganz nahe war, grüßte er und fragte sehr höflich:
»Ich bitte sehr um Verzeihung, aber könnten Sie mir vielleicht sagen, wann ist diese Kirche erbaut worden?«
»Wahrhaftig,« antwortete Du Roy, »ich weiß das leider nicht. Ich glaube so vor etwa zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren. Übrigens bin ich zum ersten Male hier.«
»Ich auch. Ich habe sie noch nie gesehen.«
Nun fuhr der Journalist neugierig fort:
»Sie scheinen sie sehr sorgfältig zu besichtigten.«
Der andere erwiderte bedächtig:
»Nein, ich besichtige sie gar nicht, ich warte auf meine Frau, die ich hier treffen sollte, sie hat sich sehr verspätet.«
Er schwieg und nach einer kurzen Pause fuhr er fort:
»Es ist furchtbar heiß draußen.«
Du Roy betrachtete ihn, und fand, dass er recht anständig aussah; plötzlich kam es ihm vor, dass er eine Ähnlichkeit mit Forestier hatte.
»Sie sind aus der Provinz?« fragte er.
»Ja, ich komme aus Rennes. Und Sie, mein Herr, Sie sind wohl aus Neugier in diese Kirche gekommen?«
»Nein, ich warte auf eine Frau.«
Der Journalist grüßte ihn und ging lächelnd weiter. Er näherte sich dem Hauptportal und sah dieselbe arme Frau immer noch beten und knien. »O Gott,« dachte er, »die hat Ausdauer im Beten.« Er war nicht mehr gerührt und empfand mit dieser Armen auch kein Mitleid mehr.
Er ging vorbei und schritt langsam das rechte Seitenschiff hinauf, um Frau Walter abzuholen.
Von weitem spähte er nach der Stelle, wo er sie verlassen hatte und war sehr erstaunt, als er sie nicht mehr sah. Er glaubte, er hätte sich in dem Pfeiler getäuscht und ging bis zum letzten durch und kehrte wieder zurück. Also war sie doch fort. Wütend und überrascht blieb er stehen. Dann dachte er, dass sie ihn vielleicht suche, und ging noch einmal durch die ganze Kirche herum. Er fand sie nicht und setzte sich auf denselben Stuhl, vor dem sie gekniet hatte, in der Hoffnung, sie käme dorthin wieder; er wartete.
Bald erregte ein kaum hörbares Murmeln seine Aufmerksamkeit. In dieser Ecke der Kirche hatte er niemanden bemerkt. Woher kam dieses leise Geflüster? Er stand auf, um es herauszufinden und erblickte in der nächsten Seitenkapelle einen Beichtstuhl. Der Saum eines Kleides ragte aus ihm heraus. Er trat heran, um die Frau näher zu betrachten. Er erkannte sie. Er verspürte ein heftiges. Verlangen, sie an den Schultern zu packen und aus diesem Kasten herauszureißen. Dann aber dachte er: »Ach was, heute ist der Pfaffe an der Reihe und morgen ich.« Er setzte sich ruhig gegenüber den Beichtstühlen wieder hin und wartete ab. Und er begann, innerlich über das Abenteuer zu lachen.
Er wartete lange. Endlich erhob sich Frau Walter und wandte sich um. Sie sah ihn an, ging auf ihn zu und sagte mit ernstem und strengem Gesichtsausdruck: »Mein Herr, ich bitte, mich nicht zu begleiten, mir nicht zu folgen und auch nicht mehr allein mich zu besuchen. Sie würden nicht empfangen werden. Leben Sie wohl.«
Dann ging sie in würdiger Haltung fort. Er ließ sie gehen, denn es war sein Grundsatz, die Dinge nicht auf die Spitze zu treiben. Als nun der Priester etwas erregt aus seinem Versteck kam, ging er gerade auf ihn zu, sah ihm scharf ins Auge und knurrte ihn an:
»Wenn Sie nicht diesen langen Rock trügen, oh, welch hübsches Paar Maulschellen ich Ihnen auf Ihre ekelhafte Schnauze kleben würde.«
Dann machte er kehrt und kam pfeifend aus der Kirche heraus.
Im Portal stand der dicke Herr, den Hut auf dem Kopf, die Hände auf dem Rücken. Er schien des Wartens müde und spähte auf den weiten Platz und die Straßen, die sich dort kreuzten.
Als Du Roy an ihm vorbeiging, begrüßten sie sich.
Der Journalist hatte weiter nichts zu tun und so begab er sich auf die Redaktion der Vie Française. Schon beim Eintreten sah er an den erregten Gesichtern der Laufburschen, dass etwas Außergewöhnliches passiert sei und er trat ohne weiteres in das Zimmer des Chefs ein.
Der Vater Walter schien aufgeregt und diktierte stehend in abgehackten Sätzen einen Artikel. Zwischen den einzelnen Absätzen erteilte er den Reportern, die ihn umgaben, verschiedene Aufträge, gab Boisrenard einige Verhaltungsmaßregeln und riss Briefe auf.
Als Du Roy hereintrat, stieß der Chef einen Freudenschrei aus.
»Ah, Gott sei Dank, da ist Bel-Ami!«
Er stockte etwas verlegen, mitten im Satz und entschuldigte sich.
»Ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie so genannt habe, aber ich bin augenblicklich etwas aufgeregt durch all diese Geschichten. Und außerdem höre ich meine Frau und meine Töchter von morgens bis abends Sie nur Bel-Ami nennen, bis ich mir das schließlich selbst angewöhnt habe. Sie sind mir deshalb nicht etwa böse?«
Georges lachte:
»Aber keineswegs. Dieser Beiname hat nichts, was mir missfallen könnte.«
Vater Walter fuhr fort:
»Dann werde ich Sie auch Bel-Ami nennen, wie es alle Welt tut. Also hören Sie zu: Es sind große Ereignisse geschehen. Das Ministerium ist bei einer Abstimmung von 310 gegen 102 Stimmen gestürzt. Unsere Ferien sind nun wieder verschoben, vertagt ad calendas graecas, und wir haben schon den 28. Juli, Spanien hat sich wegen Marokko aufgeregt und darüber sind Durand und seine Freunde gestürzt. Wir sitzen jetzt bis zum Hals im Dreck. Marrot hat den Auftrag erhalten, ein neues Kabinett zu bilden. Zum Kriegsminister nimmt er den General Bouton d’Acte und zum Auswärtigen unseren Freund Laroche-Mathieu. Er selbst behält das Portefeuille des Inneren und den Vorsitz im Ministerrat. Wir werden ein Regierungsblatt werden. Ich diktiere eben den Leitartikel, eine schlichte Erklärung unserer politischen Grundsätze, das den neuen Ministern die nötige Direktive geben soll.«
Der brave Mann lächelte und fuhr fort:
»Natürlich müssen es auch die Grundsätze sein, denen sie auch zu folgen gedenken. Aber ich brauche nun irgendetwas Interessantes, einen aktuellen Sensationsartikel über die marokkanische Frage. Ich weiß nicht genau was. Könnten Sie mir so etwas verschaffen?«
Du Roy dachte eine Sekunde nach, dann antwortete er:
»Ich habe das, was Sie suchen. Ich gebe Ihnen einen ausführlichen Bericht über die Lage unserer sämtlichen afrikanischen Kolonien, links Tunis, Algier in der Mitte und rechts Marokko. Ich erzähle über die Völkerstämme, die diese weiten Gebiete bewohnen und schildere eine Entdeckungsreise über die marokkanische Grenze bis an die große Oase Figuig, die bis jetzt kein Europäer betreten hat, und die die eigentliche Ursache des gegenwärtigen Konfliktes ist. Ist das Ihnen so recht?«
»Ausgezeichnet«, rief Vater Walter aus. »Und der Titel?«
»Von Tunis bis Tanger.«
»Wunderbar!«
Und Du Roy suchte nun in den alten Nummern der Vie Française seinen ersten Artikel, die Erinnerungen eines afrikanischen Jägers, heraus. Nun konnte er umgetauft, umgearbeitet und anders aufgesetzt, von Anfang bis zu Ende vortrefflich ausgewertet werden, denn es war darin die Rede von der Kolonialpolitik, von der Bevölkerung Algiers und von einer Reise in die Provinz Oran.
In dreiviertel Stunden wurde der Artikel umgemodelt, zurechtgemacht, auf die aktuellen Fragen zugespitzt und mit den nötigen Schmeicheleien für das neue Ministerium versehen.
Der Direktor las den Artikel und erklärte:
»Großartig … wundervoll … vorzüglich! Sie sind ein kostbarer Mann. Mein aufrichtiges Kompliment!«
Als Du Roy zum Essen nach Hause kam, war er, trotz seines Misserfolges in der Trinitékirche, doch mit seinem Tage sehr zufrieden. Er fühlte übrigens, dass er auch diesen Kampf gewonnen hatte.
Seine Frau erwartete ihn in fieberhafter Aufregung, und als sie ihn erblickte, rief sie ihm sofort entgegen:
»Weißt du, dass Laroche-Mathieu Minister des Auswärtigen ist?«
»Jawohl, ich habe deshalb sogar einen Artikel über Algier geschrieben.«
»Was denn?«
»Du kennst ihn doch; den ersten, den wir zusammen geschrieben haben: ›Die Erinnerungen des afrikanischen Jägers’, umgearbeitet und zurechtgemacht, entsprechend der heutigen Lage.«
Sie lächelte.
»Ach ja, der passt sehr gut.««
Nach einem kurzen Nachsinnen setzte sie hinzu:
»Ich denke über die Fortsetzung nach, die du doch damals schreiben solltest und die du so … hast liegen lassen. Wir könnten uns eigentlich jetzt gleich daranmachen, das würde eine hübsche und sehr aktuelle Artikelserie geben.«
Er antwortete, indem er sich vor die Suppe hinsetzte:
»Vortrefflich, uns steht jetzt nichts mehr im Wege, da doch der arme betrogene Ehemann Forestier tot ist.«
Sie erwiderte in einem harten beleidigten Ton:
»Diese Art Witze sind mehr als unpassend, und ich möchte dich bitten, damit endlich Schluss zu machen. Ich habe es lange genug angehört.«
Er war gerade im Begriff, mit einer ironischen Bemerkung zu antworten, als man ihm ein Telegramm, brachte, das ohne Unterschrift nur die Worte enthielt: »Ich habe den Kopf verloren, verzeihen Sie mir und kommen Sie morgen um vier Uhr nach dem Park Monceau.« Nun verstand er die Sache. Er war freudig erregt und sagte zu seiner Frau, indem er das blaue Papierchen in die Tasche gleiten ließ:
»Ich werde es nicht mehr tun, mein Liebling, es war dumm, ich sehe es ein.«
Und er begann zu essen.
Während der Mahlzeit wiederholte er sich immerfort die Worte: »Ich habe den Kopf verloren. Verzeihen Sie mir und kommen Sie morgen um vier Uhr nach dem Park Monceau.« Also sie gab nach, das hießt mit anderen Worten: »Ich ergebe mich. Ich gehöre Ihnen. Wo und wann Sie wollen.«
Er begann zu lachen. Madeleine fragte:
»Was hast du?«
»Nichts Besonderes, ich dachte an einen Pfaffen, den ich vorher getroffen hatte und der eine so komische Fratze hatte.«
Du Roy erschien tags darauf pünktlich zu seinem Rendezvous. Auf den Bänken saßen Bürger, die von der Hitze erschöpft waren. Ein paar stumpfsinnige Kindermädchen schlummerten, während die Kinder im Sande spielten und sich herumwälzten.
Er traf Frau Walter in der kleinen alten Ruine, wo eine Quelle sprudelte. Sie ging um den engen Säulenkreis herum, mit einem verlegenen und unruhigen Ausdruck. Er begrüßte sie, und sie sagte:
»Es sind so viele Menschen hier in diesem Garten.«
Er benutzte die Gelegenheit.
»Ja, das ist wahr, sollen wir nicht wo anders hingehen?«
»Aber wohin?«
»Das ist egal, nehmen wir eine Droschke zum Beispiel. Sie können den Vorhang an Ihrer Seite runterlassen und dann sind Sie ganz in Sicherheit.«
»Ja, das ist mir lieber; hier sterbe ich vor Angst.«
»Gut, dann treffen wir uns in fünf Minuten. Ich erwarte Sie mit einer Droschke vor dem Tor, das auf den äußeren Boulevard führt.«
Er ging mit schnellen Schritten davon.
Als sie im Wagen zusammensaßen, fragte sie ihn:
»Was haben Sie dem Kutscher gesagt? Wohin fahren wir?«
»Machen Sie sich keine Sorgen,« antwortete Georges, »er weiß Bescheid.«
Er hatte ihm die Adresse seiner Wohnung in Rue Constantinople gegeben.
»Sie ahnen nicht,« fuhr sie fort, »wie ich leide und wie ich mich quäle, alles um Ihretwillen! Ich war hart gestern in der Kirche, aber ich wollte Sie fliehen um jeden Preis. Ich fürchte mich, mit Ihnen allein zu sein. Haben Sie mir verziehen?«
Er drückte ihr die Hände.
»Ja, ja, was würde ich Ihnen nicht verzeihen, ich, der Sie so liebt!«
Sie sah ihn flehend an:
»Hören Sie, Sie müssen mir versprechen, mich zu schonen, dass Sie …, dass Sie nicht … sonst könnte ich Sie nie wiedersehen.«
Er antwortete zuerst gar nichts; er lächelte unter seinem Schnurrbart, mit einem Lächeln, das die Frauen verwirrte … Dann sagte er sehr leise :
»Ich bin Ihr Sklave.«
Und nun erzählte sie ihm, wie sie ihn liebte, wie sie das bemerkt hatte, als er Madeleine Forestier heiraten wollte. Sie sprach von Einzelheiten, von den kleinen Tatsachen. Plötzlich schwieg sie. Der Wagen hielt und Du Roy öffnete die Tür.
»Wo sind wir?« fragte sie.
»Steigen Sie aus,« erwiderte er, »und gehen Sie in dies Haus; dort werden wir es bequemer haben.«
»Wo sind wir denn eigentlich?«
»Bei mir. Es ist meine Junggesellenwohnung, die ich genommen habe … für einige Tage … um die Möglichkeit zu haben, Sie zu sehen.«
Sie klammerte sich an das Polster des Wagens fest und stammelte:
»Nein, nein, ich will nicht! Ich will es nicht!«
»Ich schwöre Ihnen, Sie zu schonen«, sagte er mit energischer Stimme. »Kommen Sie, Sie sehen doch, dass wir beobachtet werden, die Menschen werden sich ansammeln. Kommen Sie, steigen Sie aus.«
Und er wiederholte:
»Ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen nichts antun werde!«
Ein Weinhändler sah sie neugierig an. Sie wurde von Schreck ergriffen und eilte ins Haus.
Sie wollte die Treppe hinaufsteigen, aber er hielt sie zurück:
»Hier im Erdgeschoss«, sagte er.
Sobald sie im Zimmer waren, ergriff er sie wie eine Beute. Sie wehrte sich, kämpfte, stammelte: »Oh, mein Gott! Oh, — — mein Gott!« — — —
Er küsste ihr die Augen, die Haare, den Mund, den Hals; sie versuchte seinen Küssen zu entweichen und trotzdem erwiderte sie seine Küsse wider Willen. Plötzlich hörte sie auf zu kämpfen; sie war besiegt und ließ sich von ihm entkleiden. Schnell und geschickt wie eine geübte Kammerzofe zog er ihr eins nach dem anderen ihrer Kleidungsstücke aus.
Das Korsett riss sie ihm aus den Händen heraus, um ihr Gesicht darin zu verbergen, und nun stand sie elfenbeinnackt inmitten ihrer Hüllen, die ihr zu Füßen gefallen waren. Er ließ ihr die Schuhe an und trug sie auf den Armen aufs Bett. Da stammelte sie ihm mit gebrochener Stimme ins Ohr:
»Ich schwöre Ihnen, … ich schwöre Ihnen, ich habe noch nie einen Geliebten gehabt.«
Wie ein junges Mädchen, das gesagt hatte: »Ich schwöre Ihnen, dass ich noch eine Jungfrau bin.«
Er dachte: »Das ist mir wirklich ganz gleichgültig.«