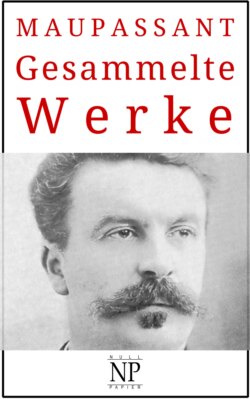Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 35
VII.
ОглавлениеForestiers Abwesenheit machte die Stellung Duroys in der Redaktion der Vie Française noch einflussreicher. Außer den Lokalberichten unterzeichnete er auch mehrere Leitartikel, denn der Chef verlangte, dass ein jeder die Verantwortung für seine Aufsätze selbst trüge. Er hatte hin und wieder kleine Zeitungsfehden, die er stets geistreich und geschickt durchfocht, und seine fortwährenden Beziehungen zu Staatsmännern bereiteten ihn allmählich darauf vor, ein gewandter und scharfblickender Redakteur zu werden.
Er sah nur einen dunklen Punkt an seinem Horizont. Er kam von einem kleinen, oppositionellen Blatt, das sich »Die Feder« nannte. Die Zeitung, die ihn oder vielmehr in ihm den Nachrichtenredakteur der Vie Française beständig angriff, nannte ihn den Überraschungschef des Herrn Walter und veröffentlichte täglich Niederträchtigkeiten, boshafte Bemerkungen und Verleumdungen aller Art gegen ihn.
Eines Tages sagte Jaques Rival zu Duroy:
»Sie lassen sich viel gefallen.«
»Was wollen Sie,« stammelte der andere, »es sind keine direkten Angriffe.«
Als er eines Nachmittags den Redaktionssaal betrat, hielt ihm Boisrenard die letzte Nummer der »Feder« hin.
»Lesen Sie! Es steht schon wieder eine unangenehme Bemerkung gegen Sie darin.«
»Worüber denn?«
»Nichts von Bedeutung, über die Verhaftung einer Frau Aubert durch einen Agenten der Sittenpolizei.«
Georges Duroy nahm die Zeitung und las einen Artikel mit der Überschrift: »Duroy amüsiert sich.«
»Der prominente Reporter der Vie Française teilt heute der Welt mit, dass die Frau Aubert, deren Verhaftung durch einen Beamten der verhassten Sittenpolizei wir gestern meldeten, nur in unserer Einbildung existiere. Nun wohnt aber die betreffende Person am Montmartre 18 Rue d’Ecureuil. Wir verstehen übrigens vollkommen, welche Vorteile die Agenten der ›Walterbank‹ daran haben können, die Interessen des Polizeipräfekten, der ihre Geschäfte begünstigt, in Schutz zu nehmen. Was aber den betreffenden Reporter angeht, so soll er uns lieber mitteilen, woher er alle seine wunderbaren Sensationsnachrichten bezieht: Todesnachrichten, die am nächsten Tage dementiert werden, Berichte über Schlachten, die nicht stattgefunden haben, oder ein Telegramm über die bedeutsame Ansprache irgendeines Monarchen, der überhaupt gar nicht gesprochen hat, kurz, alle die Mitteilungen, die so fruchtbringend für das Waltersche Geschäft sind. Oder auch ein paar kleine Indiskretionen über eine Soirée bei einer vielgenannten Dame oder schließlich die Lobreden auf gewisse neue Produkte, welche für einige unserer Kollegen eine so ergiebige Einnahmequelle bilden.«
Der junge Mann war bestürzt und sprachlos; er verstand nur, dass etwas für ihn sehr Unangenehmes in dem Artikel stand.
Boisrenard fuhr fort:
»Wer hat Ihnen diese Nachricht gebracht?«
Duroy dachte nach, konnte sich aber nicht gleich entsinnen. Dann fiel es ihm plötzlich ein:
»Ja … es war Saint-Potin.«
Darauf las er den Absatz der »Feder« nochmals und wurde plötzlich feuerrot und empört über den Vorwurf der Bestechlichkeit.
»Was,« rief er aus, »man behauptet, ich würde bezahlt für …«
Boisrenard unterbrach ihn:
»Ja, Gott, es ist sehr unangenehm für Sie, denn Sie wissen, der Chef ist in solchen Sachen sehr peinlich. So etwas könnte sich sonst wiederholen …«
Saint-Potin trat gerade herein; Duroy eilte ihm entgegen:
»Haben Sie den Artikel in der Feder gelesen?«
»Jawohl, und ich komme eben von der Frau Aubert. Sie existiert tatsächlich, ist aber nie verhaftet worden. Dies Gerücht ist gänzlich unbegründet.«
Duroy ging nunmehr zum Chef, der ihn etwas kühl und misstrauisch empfing. Herr Walter hörte sich den Fall an und sagte:
»Gehen Sie selbst zu der Frau hin und dementieren Sie es in einer Weise, dass man nicht wieder so etwas über Sie schreibt; ich meine die Folgen; sie können sehr peinlich sein für die Zeitung, für mich und auch für Sie. Mehr noch als das Weib Cäsars muss der Journalist über jeden Verdacht erhaben sein.«
Duroy stieg mit Saint-Potin in eine Droschke und rief dem Kutscher zu:
»18 Rue de l’Ecureuil am Montmartre.«
Es war ein riesiges Mietshaus, in dem sie sechs Stockwerke hinaufklettern mussten. Eine alte Frau in einer wollenen Jacke öffnete ihnen die Tür:
»Was wollen Sie denn wieder von mir?« fragte sie, als sie Saint-Potin erblickte.
Er erwiderte:
»Der Herr hier ist Polizeiinspektor und möchte gern Näheres über Ihre Angelegenheit erfahren.«
Sie ließ sie hereintreten und erzählte:
»Es waren seitdem noch zwei Herren von einer Zeitung hier, ich weiß aber nicht von welcher.«
Dann wandte sie sich zu Duroy:
»Also der Herr wünscht es zu wissen?«
»Ist es wahr, dass Sie von einem Agenten, der Sittenpolizei festgenommen wurden?« fragte Duroy.
Sie warf die Hände hoch:
»Nie im Leben, mein lieber Herr, nie im Leben! So lag die Sache: Ich habe einen Schlächter, er ist ein ganz guter Schlächter, aber er wiegt die Ware nicht richtig ab. Ich habe es mehrere Male bemerkt, doch nichts gesagt, aber neulich lasse ich mir zwei Pfund Koteletts geben, weil nämlich meine Tochter und Schwiegersohn zum Essen kommen wollten, und da seh ich, wie er mir eine Menge Knochenabfälle zuwiegt. Es waren zwar Kotelettknochen, aber nicht von meinen Koteletten. Ich hätte ja ein Ragout daraus machen können, das ist wahr. Aber wenn ich Koteletts verlange, so will ich nicht die Knochenabfälle der anderen haben. Ich will sie also nicht nehmen, und da schimpft er auf mich: ›Alte Ratte‹, sagt er; und ich antworte ihm: ›Alter Gauner.‹ Kurz, ein Wort gab das andere und wir haben uns so beschimpft, dass bald etwa hundert Personen vor dem Laden standen, die lachten und lachten immerfort. Endlich kam ein Polizeibeamter und führte uns beide zum Revier, damit wir uns vor dem Kommissar verantworten sollten. Wir gingen hin und wurden bald entlassen, ohne uns jedoch miteinander auszusöhnen. Jetzt kaufe ich mein Fleisch wo anders und gehe auch nicht mal an der Tür vorbei, damit es nicht wieder Krach gibt.«
Sie schwieg und Duroy fragte:
»Ist das alles?«
»Das ist die ganze Wahrheit, mein guter Herr.«
Die Alte bot ihm ein Glas Johannisbeerwein an, das er jedoch dankend ablehnte, und verlangte, dass das Falschwiegen des Schlächters in dem Bericht erwähnt wurde. Sie kehrten auf die Redaktion zurück, und Duroy schrieb folgende Erwiderung:
»Ein anonymer Schmierer aus der Feder scheint mit mir Streit zu suchen wegen einer alten Frau, die nach seiner Behauptung von einem Agenten der Sittenpolizei verhaftet worden ist. Ich bestreite das. Ich war persönlich bei dieser Frau Aubert, die mindestens sechzig Jahre alt ist. Sie hat mir selbst genau über ihren Streit mit dem Schlächter, der ihr die Koteletts angeblich falsch gewogen hätte, erzählt, worauf beide vor den Polizeikommissar geführt wurden.
Das ist die ganze Wahrheit.
Was die übrigen Verdächtigungen des Redakteurs der Feder angeht, so übergehe ich sie mit tiefster Verachtung. Man antwortet grundsätzlich nicht auf solche Dinge, wenn sie anonym sind.
Georges Duroy.«
Herr Walter und Jaques Rival, die soeben erschienen, fanden beide die Notiz vollkommen ausreichend, und es wurde beschlossen, dass sie am selben Tage an den Schluss der Lokalnachrichten gesetzt würde.
Duroy ging frühzeitig nach Hause, er war erregt und unruhig. Was würde der andere antworten? Wer konnte es sein? Wozu dieser schamlose Angriff? Bei der rücksichtslosen Art der Journalisten konnten aus dieser dummen Geschichte böse, sehr böse Folgen entstehen. Er schlief schlecht. Als er am nächsten Morgen die Notiz in der Zeitung las, fand er sie gedruckt viel herausfordernder und aggressiver als im Manuskript. Er hätte, so schien es ihm, gewisse Ausdrücke mäßigen können.
Den ganzen Tag über war er wie im Fieber und schlief auch die folgende Nacht schlecht.
Er stand beim Morgengrauen auf, um sich die Nummer der Feder zu kaufen, die die Antwort auf seine Entgegnung bringen sollte.
Es war wieder kälter geworden; es fror. Das Wasser in den Rinnsteinen war gefroren, es schien aber, als fließe es und bildete um die Bürgersteige Eisbände.
Die Zeitungen waren bei den Händlern noch nicht zu haben, und Duroy entsann sich jenes Tages, als zum ersten Male seine »Erinnerungen eines afrikanischen Jägers« erschienen waren. Hände, Füße und namentlich die Fingerspitzen schmerzten ihn vor Kälte und er begann im Kreise um den Kiosk herumzulaufen, in dem die Verkäuferin über ihren kleinen Ofen gebückt saß, sodass nichts weiter zu sehen war als die Nasenspitze und ein paar rote Backen unter einer wollenen Kapuze.
Endlich schob der Zeitungsträger den dicken Ballen durch die Öffnung und Duroy erhielt sofort seine Feder.
Mit raschen Blicken suchte er zunächst seinen Namen, fand aber anfangs nichts. Schon wollte er erleichtert aufatmen, da sah er eine Notiz zwischen zwei fetten Strichen:
»Herr Duroy von der Vie Française will uns berichtigen und lügt dabei selbst. Er gibt wenigstens zu, dass eine Frau Aubert tatsächlich existiert und dass ein Beamter sie zum Polizeirevier gebracht hat. Er braucht hinter dem Wort ›Beamter‹ noch die zwei Worte ›der Sittenpolizei‹ hinzuzufügen und die Sache ist richtig. Aber leider ist es mit der Ehrlichkeit einiger Journalisten gerade so weit her wie mit ihrem Talent. Hiermit zeichne ich:
Louis Langremont.«
Georges Herz klopfte heftig, und er ging nach Hause, um sich umzuziehen, ohne recht zu verstehen, was er eigentlich tat. Also, man hatte ihn beschimpft, und zwar derart, dass es kein Zurück mehr gab. Und warum? Wegen nichts. Wegen einer alten Frau, die sich mit ihrem Schlächter gezankt hatte. Er zog sich rasch an und begab sich sofort zu Herrn Walter, obgleich es kaum acht Uhr war. Herr Walter war schon auf und las die Feder.
»Nun ja«, sagte er mit einem ernsten Gesicht, als er Duroy erblickte. »Sie können nicht mehr zurück.«
Der junge Mann erwiderte nichts, und der Chef fuhr fort:
»Suchen Sie sofort Rival auf, er wird Ihre Interessen vertreten.«
Duroy murmelte ein paar unverständliche Worte und ging direkt zu Jaques Rival, der noch schlief.
Als es klingelte, sprang er aus dem Bett und las schnell die Notiz.
»Verdammt,« rief er, »da müssen wir ran. Wen werden Sie als zweiten Sekundanten wählen?«
»Ich weiß das wirklich nicht!«
»Boisrenard? — Was meinen Sie?«
»Gut, Boisrenard.«
»Sind Sie ein guter Fechter?«
»Gar nicht!«
»Verflucht! Und wie steht es mit dem Pistolenschießen?«
»Schießen kann ich etwas.«
»Gut. Sie werden sich üben, während ich mich mit allem weiteren befasse. Warten Sie eine Minute.«
Er ging in sein Ankleidezimmer und kam bald gewaschen, rasiert und in eleganter Toilette zurück. »Kommen Sie mit!« sagte er.
Er wohnte im Erdgeschoss eines kleinen Hauses und führte Duroy in den Keller hinab, einen riesigen Keller, der in einen Fecht- und Schießplatz umgewandelt war. Sämtliche Öffnungen nach der Straße hatte er verstopfen lassen. Er zündete eine Reihe Gasflammen an, die bis zum Ende des zweiten Kellers reichten. Im Hintergrunde stand eine eiserne, blau und rot angemalte Figurenscheibe eines Mannes. Dann legte er zwei Pistolen nach dem neuesten Hinterladersystem auf den Tisch und begann mit kurzer, scharfer Stimme zu kommandieren wie auf dem Kampfplatz:
»Fertig?
Feuer — eins — zwei — drei!«
Duroy gehorchte willenlos; er hob den Arm, zielte, schoss, und da er die Puppe mehrmals in den Bauch traf, denn er hatte in seiner Kindheit oft mit einer alten Sattelpistole seines Vaters auf die Spatzen im Hof geschossen, so erklärte Jaques Rival befriedigt:
»Gut — sehr gut — sehr gut — es wird gehen. Schießen Sie so bis Mittag. Hier liegen Patronen. Haben Sie keine Angst, sie zu verbrauchen. Ich hole Sie zum Frühstück ab und teile Ihnen alles Nähere mit.«
Und er verschwand.
Duroy blieb allein; er schoss noch ein paarmal, dann setzte er sich hin und begann nachzudenken. Wie töricht war doch die ganze Geschichte. Was bewies ein Duell? War ein Schuft kein Schuft mehr, wenn er sich geschlagen hatte? Was hatte ein beleidigter Ehrenmann davon, sein Leben gegen einen Gauner aufs Spiel zu setzen? Seine Gedanken schweiften im Dunkeln herum, und er dachte daran, was Norbert de Varenne ihm von der Geistesarmut der Menschen, von der Beschränktheit ihres Gesichtskreises und von ihrer törichten Kindermoral gesagt hatte.
Und er sagte ganz laut: »Wahrhaftig, er hatte recht.«
Dann verspürte er Durst; er hörte hinter sich Wasser tropfen, erblickte einen Duschapparat und ging hin, um aus der hohlen Hand zu trinken. Dann verfiel er wieder in Gedanken. Es war so trübe hier im Keller, so düster und traurig wie in einem Grab, und das ferne, dumpfe Rollen der Wagen hörte sich an wie das Nahen eines Sturmes. Wie spät mochte es sein? Die Stunden verstrichen hier unten, wie sie in einem Gefängnis verstreichen mussten, ohne dass irgendein anderes Zeichen ihren Wechsel ankündet, außer dem Erscheinen des Kerkermeisters, der das Essen bringt. Und so wartete er sehr lange.
Plötzlich hörte er Stimmen und Schritte und Jaques Rival erschien in Begleitung von Boisrenard. Sobald er Duroy erblickte, rief er:
»Alles in Ordnung.«
Duroy glaubte zunächst, die Angelegenheit sei durch einen Entschuldigungsbrief beigelegt; er atmete erleichtert auf und stammelte:
»Ah … ich danke Ihnen.«
Rival fuhr fort:
»Der Langremont scheint einen dicken Kopf zu haben, er hat alle unsere Bedingungen angenommen. Fünfundzwanzig Schritt, einmaliger Kugelwechsel mit Aufheben der Pistole. Man hat dann viel mehr Sicherheit im Arm als beim Senken der Waffe. Geben Sie acht, Boisrenard, was ich Ihnen gesagt habe.«
Er ergriff eine Pistole und schoss, während er dem anderen auseinandersetzte, um wie viel sicherer man zielen konnte, wenn man die Pistole hob. Dann sagte er:
»Jetzt wollen wir frühstücken gehen, es ist zwölf Uhr schon vorüber.«
Und sie gingen in ein benachbartes Restaurant. Duroy war ganz still geworden. Er zwang sich zu essen, damit es nicht aussehen sollte, als ob er Angst hätte; dann ging er mit Boisrenard im Laufe des Tages in die Redaktion und tat zerstreut und mechanisch seine Arbeit; alle fanden ihn sehr mutig. Spät am Nachmittag kam Jaques Rival zu ihm, und sie verabredeten, dass Duroy von seinen Sekundanten am nächsten Morgen um sieben Uhr abgeholt werden sollte, um nach Bois du Vésinet zu fahren, wo das Duell stattfinden sollte.
Das war alles so unerwartet gekommen, so ganz ohne seine Teilnahme, ohne dass er ein Wort gesprochen hatte, ohne dass er seine Meinung äußerte, ohne dass er etwas annehmen oder verweigern konnte, und mit solch einer Geschwindigkeit, dass er verlegen und verwirrt blieb, ohne recht zu wissen, was vorging.
Er speiste mit Boisrenard und ging dann gegen neun Uhr abends nach Hause. Sobald Duroy allein war, ging er einige Zeit mit großen, lebhaften Schritten in seinem Zimmer auf und ab. Er war zu aufgeregt, um an etwas zu denken. Ein einziger Gedanke füllte ihn aus:
— Morgen ein Duell — ohne dass diese Vorstellung in ihm etwas anderes erweckte, als eine gewisse, starke Erregung. Er war Soldat, er hatte auf die Araber geschossen, allerdings ohne große persönliche Gefahr, so wie man auf der Jagd auf ein Wildschwein schießt.
Schließlich hatte er gehandelt, wie er handeln musste. Er hatte sich so gezeigt, wie er sollte. Man würde von. ihm sprechen, ihn loben — ihn beglückwünschen. Dann sprach er laut vor sich hin, wie man in großer, seelischer Erregung spricht:
»Was für ein Vieh ist dieser Mensch!«
Er setzte sich und begann nachzudenken. Er betrachtete die Visitenkarte seines Gegners, die ihm Rival gegeben hatte, damit er seine Adresse behielt. Zum zwanzigsten Mal las er: Louis Langremont, 176, Rue Montmartre. Weiter nichts.
Er betrachtete diese Buchstaben, die ihm geheimnisvoll vorkamen, die ihn beunruhigten. »Louis Langremont.« Wer war dieser Mann? Wie alt? Welcher Gestalt? Welches Gesicht? War es nicht empörend, dass ein Fremder, ein Unbekannter ohne jeden Grund sein Leben zerstören konnte, nur durch die Laune einer alten Frau, die sich mit ihrem Schlächter gezankt hatte. Und er wiederholte nochmals: »Was für ein Vieh!«
Und mit einem starren Blick guckte er die Karte an. Ein Zorn gegen dieses Stück Papier erfüllte ihn, ein Zorn, in den sich ein seltsames, banges Gefühl einmischte. Diese Geschichte war zu dumm. Er ergriff eine herumliegende Nagelschere und stieß damit mitten in den gedruckten Namen, als ob er ihn damit erdolchen wolle. Also, er sollte sich schlagen, und zwar mit Pistolen. Warum hatte er nicht den Degen gewählt? Er wäre dann auf alle Fälle mit einer leichten Verwundung davongekommen, während man bei einer Pistole nie im Voraus wissen konnte.
»Ich muss fest bleiben«, sagte er.
Der Klang seiner Stimme erschreckte ihn, und er blickte sich um. Er trank ein Glas Wasser und ging zu Bett. Er löschte das Licht und schloss die Augen.
Er konnte nicht einschlafen, es war ihm heiß unter seiner Decke, obwohl es im Zimmer sehr kalt war.
Er hatte Durst.
»Sollte ich mich etwa fürchten?« dachte er, indem er aufstand, um Wasser zu trinken.
Warum klopfte sein Herz so wild bei jedem bekannten Geräusch in seinem Zimmer? Wenn seine Kuckucksuhr schlug, fuhr er beim leisen Knarren der Feder jedes Mal zusammen; er fühlte sich beengt und musste ein paar Augenblicke den Mund öffnen, um Luft zu bekommen.
»Sollte ich Angst haben?« begann er zu philosophieren.
Nein, sicher hatte er keine Angst, denn er war entschlossen, bis zum Ende zu gehen, da er den festen Willen hatte, zu kämpfen ohne zu zittern. Aber er fühlte sich so tief erregt, dass er sich fragte: »Kann man trotz seines Willens Angst haben?« Und dieser Zweifel, diese schreckliche Befürchtung ergriff ihn. Wenn diese Macht stärker als sein Wille war, ihn gewaltig und unwiderstehlich lähmte, was würde dann geschehen? Ja, was konnte dann passieren?
Sicher würde er auf den Kampfplatz gehen, weil er das wollte. Aber wenn er zittern würde? Wenn er besinnungslos würde?
Und er dachte über seine Stellung, über seinen Ruf, über seine Zukunft nach.
Und ein merkwürdiges Verlangen, aufzustehen und in den Spiegel zu schauen, überkam ihn. Er zündete das Licht an. Als er sich in dem Spiegel beobachtete, kam er sich ganz fremd vor, und es war ihm, als hätte er sich nie gesehen. Seine Augen kamen ihm riesig vor und er war blass, blass, sicher sehr blass.
Blitzschnell ging ihm ein Gedanke durch den Kopf: »Morgen um diese Zeit bin ich vielleicht schon eine Leiche!« Und sein Herz begann rasend zu klopfen.
Er ging zu seinem Bett und sah sich, auf dem Rücken liegend, unter derselben Decke, die er eben verlassen hatte. Er hatte das hohle Gesicht eines Toten und seine Hände lagen weiß und unbeweglich da.
Eine Furcht vor seinem Bett ergriff ihn und, um es nicht mehr zu sehen, öffnete er das Fenster und guckte hinaus. Die kalte Nachtluft ließ seinen ganzen Körper zittern und schwer atmend wich er vom Fenster zurück.
Es fiel ihm ein, Feuer zu machen. Er schürte es langsam an, ohne sich umzudrehen. Seine Hände zitterten nervös, wenn er einen Gegenstand anfasste. Sein Kopf brannte, seine Gedanken waren schmerzhaft und verworren. Er fühlte sich berauscht, als ob er Wein getrunken hätte, und immerfort fragte er sich: »Was soll ich tun? Was soll aus mir werden?«
Er begann wieder auf und ab zu gehen, ununterbrochen, mechanisch.
»Ich muss energisch sein, sehr energisch.«
Dann sagte er sich: »Ich muss an meine Eltern schreiben, für den Fall, dass mir etwas passiert.«
Er setzte sich wieder hin, nahm einen Bogen Papier und schrieb. »Lieber Papa, liebe Mama …«
Aber diese einfache Anrede fand er zu vertraulich, bei einem so tragischen Vorfall. Er zerriss das erste Blatt und begann von Neuem:
»Mein lieber Vater, meine liebe Mutter. Mit Tagesanbruch habe ich ein Duell, und da es geschehen kann, dass …«
Hastig stand er auf und traute sich nicht weiter zu schreiben.
Dieser Gedanke zerschmetterte ihn: »Ich werde ein Duell haben.« Es war unvermeidlich. Was ging nun in ihm vor? Er wollte sich schlagen; diese Absicht war fest; und trotzdem schien es ihm, als hätte er nicht einmal so viel Willenskraft, um zum Kampfplatz zu gehen. Von Zeit zu Zeit klapperten seine Zähne mit leisem, hartem Geräusch und er fragte sich: »Ob mein Gegner schon ein Duell gehabt hat? Ist er ein guter Schütze? Ist er als solcher bekannt und geschätzt?« Er hatte nie seinen Namen gehört. Aber wenn dieser Mann kein guter Pistolenschütze wäre, würde er kaum ohne weiteres, so ohne jedes Zaudern diese gefährliche Waffe annehmen.
Dann malte sich Duroy ihr Zusammentreffen aus, die Haltung seines Gegners und seine eigene. Er zermarterte sich das Gehirn mit den geringsten Einzelheiten des Kampfes, und plötzlich sah er vor seinem Gesicht das kleine schwarze Loch des Pistolenlaufes, aus dem die Kugel kommen würde.
Und plötzlich ergriff ihn eine furchtbare Angst, er bekam einen Anfall wilder Verzweiflung. Sein ganzer Körper zitterte und bebte. Er presste die Zähne zusammen, um nicht zu schreien. Er hatte ein Bedürfnis, sich auf der Erde zu wälzen, etwas zu beißen, zu vernichten.
Er bemerkte plötzlich ein Glas auf seinem Kamin, und es fiel ihm ein, dass er in seinem Schranke eine fast volle Flasche Schnaps stehen hatte, denn noch von seiner Soldatenzeit her hatte er die Gewohnheit, jeden Morgen ein Gläschen zu trinken.
Er ergriff die Flasche, setzte sie an den Mund und trank gierig, in langen Zügen. Er stellte sie erst hin, als ihm der Atem ausblieb. Sie war zum Drittel leer. Eine glühende Hitze verbrannte ihm plötzlich den Magen, ergoss sich durch seine Glieder, und durch die Betäubung bekam er neuen Mut.
»Das ist das richtige Mittel«, sagte er sich. Und da ihm sehr warm wurde, öffnete er das Fenster.
Der Tag graute still und kalt. Die Sterne schienen zu sterben und in dem tiefen Eisenbahneinschnitt verblichen die grünen, roten und weißen Signallichter. Die ersten Lokomotiven verließen den Schuppen und fuhren pfeifend davon, um die ersten Züge zu holen. Die anderen pfiffen grell in der Ferne, wiederholten ihren Morgenruf, wie die Hähne auf dem Lande.
»Ich werde vielleicht das alles nicht mehr sehen«, dachte Duroy. Nun fühlte er, dass er von Neuem weich wurde. Da nahm er sich mit Gewalt zusammen. »Ich darf an nichts denken bis zum Moment der Begegnung. Das ist das einzige Mittel, um den Mut nicht zu verlieren.«
Er begann sich anzukleiden. Beim Rasieren guckte er in den Spiegel, und es überkam ihn nochmals eine Schwäche, als er daran dachte, dass er vielleicht zum letzten Male sein Gesicht sähe.
Da trank er einen Schluck aus der Flasche und zog sich schnell an.
Es fiel ihm sehr schwer, über die nächste Stunde hinwegzukommen. Er ging auf und ab durch das Zimmer und zwang sich mit Gewalt zur äußeren Ruhe und Kaltblütigkeit. Als er an seiner Tür klopfen hörte, wäre er fast auf den Rücken gefallen, so heftig fuhr er vor Schreck zusammen. Das waren seine Zeugen. Also, es war Zeit.
Sie waren in Pelze gehüllt. Rival drückte seinem Klienten die Hand und erklärte:
»Es ist eine sibirische Kälte. Geht es gut?« fragte er.
»Ja, sehr gut.«
»Sind Sie ruhig?«
»Ja, sehr ruhig.«
»Also, es wird schon gehen. Haben Sie etwas getrunken und gegessen?«
»Ja, ich brauche nichts mehr.«
Für das Ereignis hatte sich Boisrenard ein gelb-grünes ausländisches Ordensbändchen angelegt, das Duroy noch nie bei ihm gesehen hatte. Sie gingen hinunter.
In dem Landauer saß ein Herr und wartete auf sie. Rival stellte vor:
»Doktor Le Brument.«
»Ich danke«, murmelte Duroy und drückte ihm die Hand.
Dann wollte er sich auf die Vorderbank setzen, aber er fühlte etwas Hartes. Das war der Pistolenkasten, wie er zu seinem Entsetzen bemerkte.
»Nein, nein, der Duellant und der Arzt auf den Rücksitz!« wiederholte Rival nochmals.
Duroy verstand ihn endlich und sank neben dem Doktor aufs Polster. Als die beiden Sekundanten eingestiegen waren, fuhr der Kutscher los. Er wusste schon, wohin er fahren sollte.
Aber die Pistolenkiste belästigte alle, am meisten Duroy, der sie lieber nicht gesehen hätte. Man versuchte, sie hinter die Rücken zu stellen, sie störte aber furchtbar; dann stellte man sie zwischen Rival und Boisrenard — sie fiel immer runter. Schließlich legte man sie auf den Boden.
Die Fahrt verlief sehr eintönig, obgleich der Arzt Anekdoten erzählte. Rival antwortete allein darauf, Duroy hätte gern Geistesgegenwart gezeigt, er fürchtete aber, aus der Rolle zu fallen und seine Aufregung zu verraten; ihn quälte die Angst, er könnte zu zittern beginnen.
Der Wägen hatte bald freies Feld erreicht. Es war gegen neun Uhr früh an einem jener rauen Wintermorgen, wo die ganze Natur glänzend, hart und spröde ist wie ein Kristall. Die Bäume im Raureif sahen aus, als ob sie Eis geschwitzt hätten; der Boden dröhnte unter den Schritten. Die trockene Luft trug weit die leisesten Geräusche, und der blaue Himmel funkelte wie ein Spiegel. Die Sonne warf auf die erfrorene Erde ihre hellen Strahlen, die nicht zu wärmen vermochten.
Rival sagte zu Duroy:
»Ich habe die Pistolen bei Gastine Renette gekauft. Er hat sie selbst geladen; der Kasten ist versiegelt. Übrigens wird das Los entscheiden, ob diese oder die unseres Gegners benutzt werden.«
Duroy antwortete mechanisch:
»Ich danke Ihnen.«
Dann gab Rival Instruktionen bis ins kleinste, denn sein Schutzbefohlener sollte in keinem Falle irgendeinen Fehler begehen. Alles, was er sagte, wiederholte er dabei mehrere Male.
»Wenn gefragt wird: Sind Sie fertig, meine Herren? so müssen Sie mit lauter Stimme antworten: Ja!
Beim Kommando ›Feuer!‹ heben Sie rasch den Arm und schießen, ehe bis drei gezählt wird.«
Duroy wiederholte es in Gedanken:
»Bei dem Kommando ›Feuer‹ hebe ich den Arm. — Bei dem Kommando ›Feuer‹ hebe ich den Arm. — Bei dem Kommando ›Feuer‹ hebe ich den Arm.« —
Er lernte es auswendig, wie Schulkinder ihre Aufgaben lernen, indem sie dieselben bis zur Bewusstlosigkeit vor sich hinsprechen, um sie recht fest dem Gedächtnis einzuprägen.
Der Wagen kam in einen Wald, bog nach rechts in eine Allee ein und dann wieder nach rechts. Plötzlich öffnete Rival die Wagentür und rief dem Kutscher zu:
»Dort den kleinen Weg hinein.«
Nun fuhr der Wagen auf einem Weg mit zwei tiefen Gleisen, der rechts und links von einem dichten Unterholz umgeben war, dessen altes, vorjähriges Laub von Eis bedeckt war und zitterte.
Duroy murmelte immer noch: »Bei dem Kommando ›Feuer‹ hebe ich den Arm.« Und er dachte, dass irgendein Unfall mit dem Wagen vielleicht noch alles gutmachen könnte. Wie gern hätte er ihn umgeworfen! Welches Glück, wenn er sich ein Bein bräche!
Doch Duroy bemerkte bald am Ende einer Lichtung einen anderen Wagen, der dort hielt, und vier Herren, die auf und ab gingen, um sich die Füße zu wärmen.
Er musste seinen Mund auf tun, so schwer wurde ihm das Atmen.
Die Sekundanten stiegen zuerst aus, dann der Arzt und zuletzt der Duellant. Rival nahm den Pistolenkasten und schritt mit Boisrenard den beiden Fremden entgegen, die auf sie zukamen. Duroy sah, wie sie sich etwas feierlich begrüßten, dann in der Lichtung auf und ab gingen und bald auf den Boden, bald zu den Bäumen hinauf blickten, als suchten sie etwas, was fallen oder fortfliegen könnte. Dann zählten sie die Schritte ab und stießen mit großer Mühe ein paar Stöcke in die gefrorene Erde. Dann traten sie zu einer Gruppe zusammen und losten »Kopf oder Schrift« wie spielende Kinder.
Der Doktor Le Brument fragte Duroy:
»Fühlen Sie sich wohl? Haben Sie irgendeinen Wunsch?«
»Nein, ich brauche nichts. Danke sehr.«
Es war ihm, als sei er verrückt geworden, als schliefe, als träumte er, und etwas Übernatürliches sei über ihn gekommen und umgäbe ihn.
Hatte er Furcht? Vielleicht! Er wusste es nicht.
Alles war so seltsam und eigenartig um ihn herum geworden.
Jaques Rival kam zurück und sagte zu ihm leise mit befriedigter Stimme:
»Alles ist fertig. Wir haben Glück mit unseren Pistolen.«
Duroy war das völlig gleichgültig.
Man zog ihm den Mantel aus. Er ließ es geschehen. Man befühlte ihm die Gehrocktaschen, um sich zu vergewissern, dass er kein Papier oder eine schützende Brieftasche darin trüge.
Er wiederholte für sich wie ein Gebet: »Bei dem Kommando ›Feuer‹ hebe ich den Arm.«
Nun führte man ihn zu einem der Stöcke, die in den Boden gebohrt waren und gab ihm eine Pistole in die Hand. Da sah er dicht vor sich einen Menschen stehen, einen kleinen, kahlköpfigen, dickbäuchigen Mann mit einer Brille. Das war sein Gegner. Er sah ihn ganz deutlich; doch er dachte nur an das eine: »Bei dem Kommando ›Feuer‹ hebe ich den Arm und schieße.« Eine Stimme ertönte in der tiefen Stille, eine Stimme, die ganz aus der Ferne zu kommen schien:
»Sind Sie fertig, meine Herren?«
Georges rief:
»Ja.«
Darauf kommandierte dieselbe Stimme:
»Feuer!«
Er hörte nichts mehr, er sah nichts mehr, er überlegte nichts mehr. Er fühlte nur, wie er den Arm erhob und mit aller Kraft auf den Hahn drückte.
Er hörte nichts, aber er sah sofort an der Mündung seines Pistolenlaufes eine leichte Rauchwolke. Und da der Mann ihm gegenüber noch in derselben Haltung stehenblieb, so erblickte er über dem Kopf des Gegners eine zweite kleine Rauchwolke.
Sie hatten alle beide geschossen. Es war aus.
Seine Sekundanten befühlten und betasteten ihn, knöpften ihm den Rock auf und fragten ängstlich:
»Sind Sie nicht verwundet?«
Er antwortete auf gut Glück:
»Nein, ich glaube nicht!«
Übrigens war Langremont ebenso unverletzt wie sein Gegner, und Jaques Rival murmelte in sehr missvergnügtem Ton:
»Mit diesen verfluchten Pistolen ist es immer dieselbe Geschichte: man knallt vorbei oder schießt sich tot. Ein ekelhaftes Zeug.«
Duroy rührte sich nicht. Er war erstarrt vor freudiger Überraschung: Alles war vorüber. Man musste ihm die Waffe abnehmen, die er noch fest und krampfhaft in der Hand hielt. Jetzt war ihm zumute, als hätte er mit der ganzen Welt gekämpft. Es war vorüber! Welches Glück! Er fühlte sich plötzlich so tapfer, dass er am liebsten noch jemanden gefordert hätte.
Die Sekundanten hatten noch eine Besprechung. Sie verabredeten eine Zusammenkunft, um das Protokoll aufzunehmen. Dann stieg man wieder in den Wagen, und der Kutscher, der auf dem Bock lachte, knallte mit der Peitsche und fuhr davon.
Sie frühstückten alle vier auf dem Boulevard und plauderten über das große Ereignis des Tages. Duroy schilderte seine Eindrücke:
»Es hat mir gar nichts gemacht, ganz und gar nichts. Sie müssen das auch übrigens bemerkt haben.«
Rival antwortete:
»Ja, Sie haben sich wacker gehalten.«
Als das Protokoll aufgenommen war, legte man es Duroy vor, damit er es in den Lokalnachrichten veröffentlichte. Er war sehr erstaunt, zu lesen, dass er zwei Kugeln mit Herrn Louis Langremont gewechselt hätte, und etwas beunruhigt fragte er Rival:
»Wir haben doch nur einmal geschossen?«
»Natürlich einmal,« lächelte der andere, »jeder eine Kugel, macht zwei Kugeln.«
Und Duroy, der die Erklärung einleuchtend fand, erhob weiter keinen Widerspruch. Vater Walter umarmte ihn:
»Bravo! Bravo! Sie haben die Fahne der Vie Française verteidigt. Bravo!«
Abends besuchte Duroy alle angesehensten Zeitungen und die wichtigsten Boulevardcafes. Zweimal traf er dabei mit seinem Gegner zusammen, der sich gleichfalls überall zeigte. Sie grüßten sich nicht. Wäre einer von ihnen verwundet gewesen, so hätten sie sich die Hände gedrückt. Übrigens schwor jeder von ihnen mit vollster Überzeugung, er hätte die Kugel des anderen pfeifen gehört.
Am nächsten Morgen erhielt Duroy gegen elf Uhr ein blaues Briefchen:
»O Gott, welche Angst hab’ ich ausstehen müssen. Komme sofort zur Rue Constantinople, mein Liebster, damit ich Dich umarme. Wie tapfer Du bist — ich liebe Dich. — Clo.«
Er ging alsbald hin. Sie fiel ihm um den Hals und bedeckte ihn mit Küssen.
»Ach, Liebling, wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich war, als ich heute Morgen in den Zeitungen las! Oh, erzähle mir, sage mir alles, ich will es wissen.«
Er musste alle Einzelheiten erzählen. Sie sagte:
»Was für eine schlimme Nacht musst du vor dem Duell verbracht haben?«
»Keineswegs; ich habe gut geschlafen.«
»Ich hätte kein. Auge zugetan. Und wie ist es auf dem Kampfplatz verlaufen?«
Er gab einen dramatischen Bericht:
»Wir standen uns gegenüber, nur zwanzig Schritt voneinander entfernt, kaum viermal so weit wie dieses Zimmer. Jaques fragte, ob wir fertig wären, dann kommandierte er: ›Feuer!‹ Ich erhob sofort den Arm, zielte gut, aber ich machte den Fehler, auf seinen Kopf zu zielen. Meine Waffe ging etwas schwer, und ich bin an leicht schießende Pistolen gewöhnt, sodass der Schuss durch den Widerstand des Hahnes zu hoch ging. Sehr weit kann er aber nicht fehlgegangen sein. Übrigens schießt der Halunke auch nicht schlecht. Seine Kugel fuhr mir dicht an der Schläfe vorüber. Ich habe den Windhauch verspürt.«
Sie saß auf seinen Knien und hielt ihn mit ihren Armen umschlungen, als wollte sie an der Gefahr teilnehmen; sie flüsterte:
»Mein armer Liebling! Mein armer Liebling!«
Als er mit seiner Erzählung fertig war, sagte sie:
»Oh, du weißt nicht; ich kann nicht mehr ohne dich leben. Ich muss dich sehen, aber solange mein Mann in Paris ist, geht das gar nicht so leicht. Morgens hätte ich oft eine Stunde frei, ehe du aufgestanden bist, und ich könnte dich umarmen kommen, aber ich will nicht wieder in dieses scheußliche Haus. Was machen wir nur?«
Er hatte plötzlich einen Einfall und fragte:
»Was zahlst du hier Miete?«
»Hundert Francs.«
»Gut; ich übernehme die Wohnung auf meine Rechnung und ziehe hierher um. Meine alte passt nicht mehr für meine neue Stellung.«
Sie dachte ein paar Augenblicke nach, dann sagte sie:
»Nein, das will ich nicht!«
»Warum denn nicht?« fragte er erstaunt.
»Darum.«
»Das ist kein Grund. Die Wohnung passt mir glänzend. Ich bin hier und ich bleibe hier.«
Er begann zu lachen:
»Übrigens ist sie ja auf meinen Namen gemietet.«
Doch sie weigerte sich nach wie vor:
»Nein, nein, ich will nicht!«
»Warum nicht? Sag’s doch!«
Da flüsterte sie ihm leise ins Ohr:
»Weil du Weiber hierher brächtest, und das will ich nicht!«
Er war entrüstet:
»So was täte ich nie im Leben, ich verspreche es dir.«
»Du tust es ja doch.«
»Ich schwöre es dir.«
»Wirklich?«
»Wahrhaftig. Mein Ehrenwort. Das ist unser Heim hier, es gehört nur uns.«
Sie umarmte ihn leidenschaftlich:
»Dann ist es mir recht, mein Liebling. Aber du musst wissen, wenn du mich betrügst, nur einmal betrügst, dann ist es zwischen uns aus, endgültig aus, und für immer!«
Er schwor nochmals und verwahrte sich gegen ihren Verdacht, und sie verabredeten, er sollte noch am selben Tage umziehen, damit sie ihn besuchen konnte, wenn sie an der Tür vorbeikäme.
Darauf sagte sie zu ihm:
»Jedenfalls komme Sonntag zu uns zum Essen. Mein Mann findet dich reizend.«
Er fühlte sich geschmeichelt:
»Ah, wirklich?«
»Ja, du hast sein Herz gewonnen. Und dann noch eins: du hast mir doch erzählt, du wärest auf dem Lande auf einem Schloss aufgewachsen, nicht wahr?«
»Ja. Aber was …?«
»Dann musst du auch etwas von Landwirtschaft verstehen?«
»Ja.«
»Nun gut, dann unterhalte dich mit ihm über Gartenbau und Ernte, er liebt das sehr.«
»Gut, ich werde es mir merken.«
Dann verließ sie ihn, nachdem sie ihn endlos geküsst hatte. Das Duell hatte ihre Liebe nur noch mehr entflammt.
Duroy aber dachte auf dem Wege zur Redaktion: »Was ist sie doch für ein wunderliches Ding. Wie ein Vogel! Man weiß nie, was sie will und was sie möchte. Und diese merkwürdige Ehe! Welcher Tollkopf hat diesen Alten mit diesem leichtsinnigen Wesen zusammengekoppelt? Wie ist dieser Herr Inspektor auf den Gedanken gekommen, dieses Studentenmädel zu heiraten? Ein Rätsel. War es vielleicht Liebe? Wer weiß?!«
Dann kam er zu dem Schluss: »Jedenfalls ist sie eine reizende Geliebte. Und ich werde mich hüten, mit ihr zu brechen.«