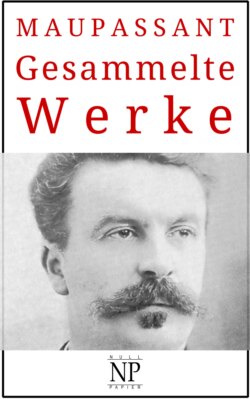Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 34
VI.
ОглавлениеEs war am nächsten Morgen ein trauriges Erwachen für Georges Duroy. Er zog sich langsam an, setzte sich ans Fenster und begann über das Vorgefallene nachzudenken. Er fühlte sich am ganzen Körper wie zerschlagen, als ob er gestern eine Menge Stockhiebe erhalten hätte. Endlich trieb ihn die Notwendigkeit, irgendwo Geld aufzutreiben, fort und er begab sich zu Forestier.
Sein Freund empfing ihn in seinem Arbeitszimmer, die Füße am Kaminfeuer: »Na, warum so früh?«
»Eine sehr wichtige Angelegenheit. Ich habe eine Ehrenschuld.«
»Beim Spiel?«
Er überlegte und gestand: »Ja, beim Spiel.«
»Wie viel?«
»Fünfhundert Francs.«
Er brauchte nur zweihundertundvierzig.
Forestier fragte misstrauisch:
»Wem schuldest du sie?«
Duroy wusste nicht gleich, was er antworten sollte: »Einem … einem Herrn … einem Herrn de Carleville.«
»So … wo wohnt er denn?«
»Er wohnt in der … in der …«
Forestier lachte: »In der Straße, wo sich Hunde und Katzen gute Nacht sagen, nicht wahr? Den Herrn kenne ich, mein Lieber. Wenn du zwanzig Francs willst, so viel stehen dir noch zur Verfügung, mehr aber nicht.«
Duroy nahm die zwanzig Francs.
Dann ging er von Tür zu Tür zu allen seinen Bekannten, und um fünf Uhr hatte er glücklich achtzig Francs zusammengebracht. Ihm fehlten noch zweihundert Francs; da entschloss er sich kurz, das Geld für sich zu behalten und murmelte: »Um dieses Frauenzimmer werde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. Ich werde es bezahlen, wenn ich kann.«
Vierzehn Tage lang lebte er sparsam, regelmäßig und zurückgezogen. Er hatte den Kopf voll energischer Entschlüsse, dann aber ergriff ihn ein großes Verlangen nach Liebe. Es war ihm, als wären Jahre vergangen, seit er eine Frau besessen hatte, und wie ein Matrose, der toll wird, wenn er wieder an Land geht, erregte ihn jeder Weiberrock, dem er begegnete.
Da ging er eines Abends nach Folies-Bergère, in der Hoffnung, Rahel dort zu treffen. In der Tat sah er sie gleich beim Eintritt, denn sie verließ dieses Lokal nie. Lächelnd ging er auf sie zu und wollte ihr die Hand reichen; aber sie maß ihn von Kopf bis zu den Füßen:
»Was wünschen Sie von mir?«
Er versuchte zu lachen: »Ach, mach’ doch keine Faxen!«
Da drehte sie ihm heftig den Rücken und sagte:
»Ich verkehre nicht mit Lumpen!«
Sie hatte die gröbste Beleidigung ausgesucht. Er fühlte, wie das Blut ihm zu Kopf stieg und ging allein nach Hause.
Forestier, der krank und elend war und immerfort hustete, machte ihm auf der Redaktion das Leben so schwer wie möglich. Es schien, als zerbräche er sich den Kopf, um ihm die peinlichsten und unangenehmsten Aufträge zu geben. Eines Tages sagte er in einem Augenblick nervöser Erregung nach einem schweren Hustenanfall zu Duroy, als er ihm eine verlangte Auskunft nicht verschaffen konnte: »Wahrhaftig, du bist noch dümmer, als ich geglaubt hatte.«
Der andere hätte ihn fast geohrfeigt, doch er nahm sich zusammen, ging fort und brummte: »Warte nur, dich kriege ich noch.« Dabei flog ihm blitzschnell ein Gedanke durch den Kopf und er fügte hinzu: »Ich setze dir Hörner auf, Alter.« Dann ging er und rieb sich die Hände vor Vergnügen über diesen Plan.
Er wollte schon am nächsten Tage mit der Ausführung beginnen und machte zunächst Frau Forestier einen Besuch.
Er fand sie lesend auf dem Sofa liegen. Sie reichte ihm die Hand, ohne sich zu rühren. Sie wandte ihm nur den Kopf zu und sagte:
»Guten Tag, Bel-Ami!«
Es war ihm, als ob er eine Ohrfeige bekam.
»Warum nennen Sie mich so?«
Sie antwortete lächelnd: »Ich habe vergangene Woche Madame de Marelle getroffen, und ich habe erfahren, wie man Sie bei ihr getauft hat.«
Das liebenswürdige Gesicht der jungen Dame beruhigte ihn etwas. Weshalb hätte er auch Angst haben sollen.
Sie fuhr fort:
»Sie verwöhnen sie! Mich besucht man aber nur, wenn es einem gerade einfällt, am sechsunddreißigsten eines Monats, nicht wahr?«
Er nahm neben ihr Platz und betrachtete sie mit völlig neuem Interesse, wie ein Sammler ein seltenes Kunstwerk. Sie war bezaubernd, ihre Haare waren blond, von zartem, warmem Goldton, und sie schien wie zur Liebe geschaffen zu sein. Er dachte: »Sie ist sicherlich schöner als die andere.« Er zweifelte nicht an seinem Erfolg, er brauchte nur die Hand auszustrecken — so schien es ihm — und sie zu nehmen, wie man eine Frucht pflückt.
Er sagte entschlossen:
»Es war besser, dass ich Sie nicht besucht habe.«
»Wieso? Warum?« fragte sie, ohne ihn zu verstehen.
»Warum? Ahnen Sie es denn nicht?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Weil ich verliebt in Sie bin … Oh, nur ein bisschen, ein klein wenig … und weil ich es nicht ganz werden will.«
Sie schien weder erstaunt, noch verletzt, noch geschmeichelt; sie lächelte weiter mit demselben gleichgültigen Lächeln und antwortete ruhig:
»Ach, Sie hätten trotzdem ruhig kommen können; in mich war noch nie jemand lange verliebt.«
Er war erstaunt, mehr sogar über den Ton als über den Inhalt; er fragte:
»Warum?«
»Weil das zwecklos ist, und ich es gleich zu verstehen gebe. Hätten Sie Ihre Befürchtung früher verraten, so hätte ich Sie beruhigt und Sie im Gegenteil gebeten, mich recht oft zu besuchen.
Er rief pathetisch aus:
»Vorausgesetzt, dass man absolut Herr ist über seine Gefühle!«
Sie wandte sich zu ihm um:
»Mein lieber Freund. Für mich ist ein verliebter Mann aus der Reihe der Lebenden ausgeschaltet. Er wird zum Idioten, und nicht nur das, sondern auch gemeingefährlich. Mit denen, die in mich verliebt sind — oder die es sich einbilden und behaupten —, breche ich jeden näheren Verkehr ab, denn erstens langweilen sie mich und zweitens sind sie mir auch verdächtig, wie ein toller Hund, der in jedem Augenblick einen Anfall kriegen kann. Ich setze sie daher so lange in geistige Quarantäne, bis ihre Krankheit vorüber ist. Merken Sie sich das. Ich weiß genau, dass für Sie die Liebe nur eine Art Hunger ist, während sie für mich im Gegenteil eine Art von … von … von Seelengemeinschaft sein müsste, wie sie es aber leider im Bewusstsein der Männer gar nicht gibt. Sie halten sich an die Worte und ich an den Inhalt. Aber … bitte, sehen Sie mir mal ins Gesicht.«
Sie lächelte nicht mehr, ihr Gesichtsausdruck war ruhig und kühl. Sie fuhr fort und legte Nachdruck auf jedes Wort:
»Ich werde nie, nie Ihre Geliebte sein! Verstehen Sie mich? Es ist daher völlig zwecklos, und es wäre für Sie sogar schlimm, wenn Sie weiter diesen Wunsch hegen … Und nun, wo … die Operation vollzogen ist … wollen wir Freundschaft schließen — wollen Sie? — Richtige wahre Freundschaft ohne Hintergedanken?«
Nun begriff er, dass angesichts dieser unwiderruflichen Entscheidung jeder Versuch fruchtlos wäre. Er zog sofort die Konsequenzen daraus; er hielt ihr beide Hände hin, aufrichtig entzückt, eine so bedeutsame Verbündete für seine Tätigkeit und sein Leben zu finden.
»Ich bin der Ihrige, gnädige Frau, in welcher Form es auch sei!« An dem Ton seiner Stimme hörte sie, dass er es aufrichtig meinte, und sie gab ihm ihre Hand.
Er küsste sie, richtete sich wieder auf und sagte schlicht:
»Weiß Gott, wenn ich eine Frau wie Sie gefunden hätte, wie glücklich wäre ich gewesen, sie zu heiraten.«
Dieses Mal war sie gerührt und geschmeichelt. Seine Worte liebkosten sie, wie alle Komplimente, die ins Herz der Frau treffen, und sie warf ihm rasch einen jener dankbaren Blicke zu, die die Männer zu ihren Sklaven machen.
Da er nicht recht wusste, wie er die Unterhaltung fortsetzen sollte, legte sie ihre Hand auf seinen Arm und sagte mit sanfter Stimme:
»Ich will gleich mein Amt als Freundin antreten. Sie sind recht ungewandt, mein Lieber.«
Sie zauderte und fragte dann:
»Darf ich ganz offen sprechen?«
»Ja.«
»Ganz und gar?«
»Ja.«
»Nun also! Besuchen Sie doch Frau Walter; sie hält von Ihnen viel; Sie müssen sich Mühe geben, ihr zu gefallen. Da können Sie Ihre Komplimente anbringen, obgleich sie eine anständige Frau ist; verstehen Sie mich wohl, sie ist durchaus anständig! Bilden Sie sich nichts ein … setzen Sie keine Hoffnungen auf irgendwelche Streiche. Führen Sie sich bei ihr gut ein und Sie können dort viel erreichen. Ich weiß, Sie nehmen bei der Zeitung vorläufig eine untergeordnete Stellung ein. Aber fürchten Sie nichts; man empfängt dort alle Redakteure mit dem gleichen Wohlwollen. Gehen Sie hin, glauben Sie mir!«
Er sagte lächelnd:
»Ich danke Ihnen, Sie sind ein Engel … ein Schutzengel!«
Dann ging die Unterhaltung auf andere Dinge über. Er blieb lange bei ihr, denn er wollte ihr beweisen, dass er gern bei ihr weilte; als er sich verabschiedete, fragte er sie nochmals:
»Also abgemacht, wir sind Freunde?«
»Abgemacht!«
Und da er die Wirkung seines letzten Kompliments bemerkt hatte, so unterstrich er es noch mit den Worten: »Sollten Sie einmal Witwe werden, bitte ich, mich vorzumerken.«
Dann aber ging er schnell hinaus, damit sie nicht erst die Zeit fand, böse zu werden.
Die Sache mit dem Besuch bei Frau Walter war Duroy etwas peinlich, denn er war ja nicht aufgefordert, sich bei ihr vorzustellen, und er wollte keine Taktlosigkeit begehen. Allerdings zeigte ihm der Chef viel Wohlwollen, und wusste seine Arbeit hoch zu schätzen und zog ihn mit Vorliebe zu schwierigen Aufträgen heran; warum sollte er nicht die Gelegenheit wahrnehmen, sich auch in sein Haus einzuführen?
Eines Tages stand er früh auf, ging in die Markthalle und kaufte für zwölf Francs zwanzig Stück prachtvoller Birnen. Er verpackte sie sorgfältig in einem Körbchen, um den Anschein zu erwecken, als kämen sie von weit her, übergab sie dem Portier im Hause seines Chefs und legte noch seine Karte bei, auf der geschrieben stand:
»Georges Duroy bittet Madame Walter ergebenst, ihr einige Früchte senden zu dürfen, die er heute früh aus der Normandie erhalten hat.«
Am nächsten Tage fand er in seinem Briefkasten in der Redaktion ein Kuvert mit der Karte der Frau Walter, die Herrn Georges Duroy herzlichst dankte und ihm mitteilte, dass sie jeden Sonnabend zu Hause sei.
Am nächsten Sonnabend machte er seinen Besuch. Herr Walter bewohnte auf dem Boulevard Malesherbes ein Doppelhaus, das ihm selbst gehörte und dessen Hälfte er als praktischer und sparsamer Geschäftsmann vermietete. Ein Pförtner mit dicken Beinen in weißen Strümpfen, in einer prächtigen Schweizer Livree mit goldenen Knöpfen und scharlachroten Aufschlägen, der zwischen den beiden Toreinfahrten hauste, öffnete das Tor sowohl für den Hauswirt als auch für den Mieter und verlieh durch seine Haltung den beiden Eingängen das stolze Aussehen eines reichen und vornehmen Privathauses.
Die Gesellschaftsräume lagen im ersten Stock. Zuerst kam man in ein Vorzimmer mit Gobelins und Portieren. Zwei Diener saßen schläfrig auf Sesseln. Einer von ihnen nahm Duroy den Überzieher ab, der andere ergriff seinen Spazierstock, öffnete eine Tür, ging dem Gaste ein paar Schritte voraus, trat dann zur Seite und ließ ihn vorbei, indem er seinen Namen in ein leeres Zimmer hineinrief. Der junge Mann fühlte sich zuerst sehr unsicher und sah sich nach allen Seiten um, bis er zuletzt in einem Spiegel mehrere sitzende Menschen erblickte, die ziemlich weit zu sein schienen. Er ging zuerst nach der verkehrten Richtung, da der Spiegel seine Augen getäuscht hatte, dann durchschritt er zwei leere Salons und kam in ein kleines Boudoir mit blauseidenen Tapeten, die mit goldenen Knöpfen verziert waren. Hier saßen vier Damen um einen runden Tisch und plauderten bei einer Tasse Tee.
Trotz der Sicherheit, die Duroy sich durch seinen Aufenthalt in Paris und vor allen Dingen durch seinen Reporterberuf, der ihn immer wieder mit hervorragenden Menschen in Berührung brachte, erworben hatte, fühlte er sich durch die ganze Inszenierung seines Empfangs und die großen leeren Salons, die er durchwandern musste, etwas verschüchtert. Er stammelte:
»Madame, ich habe mir gestattet …«, und suchte dabei mit den Augen die Frau des Hauses.
Sie reichte ihm die Hand, die er mit einer Verbeugung ergriff, und sagte zu ihm:
»Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Duroy, mich zu besuchen.« Und sie wies ihn auf einen Sessel, auf den er, statt sich hinzusetzen, hinabfiel, da er ihm viel höher zu sein schien, als er tatsächlich war.
Die Damen, die einen Augenblick geschwiegen, hatten ihre Unterhaltung wieder aufgenommen. Man sprach über die plötzlich eingetretene Kälte, die aber noch nicht stark genug war, um Schlittschuh laufen zu können, und die auch nicht imstande war, die herrschende Typhusepidemie zu verscheuchen. Jede Dame äußerte ihre Meinung über das Auftreten des heftigen Frostes in Paris, dann plauderte man darüber, welche Jahreszeit eigentlich die angenehmste war und kramte alle jene banalen Begründungen aus, die in den Köpfen sich ablagern, wie Staub auf den Möbeln.
Die Tür ging leise auf und Duroy wandte sich um. Er erblickte durch zwei große Wandscheiben eine sehr korpulente Dame, die näherkam. Gleichzeitig erhob sich im Boudoir eine der Besucherinnen, verabschiedete sich und ging hinaus. Der junge Mann folgte ihr mit den Blicken durch die anderen Zimmer und sah, wie auf ihrem schwarzen Rücken die Jettperlen blitzten.
Als die Unruhe, die dieser Personenwechsel hervorgerufen, sich gelegt hatte, kam man plötzlich ohne Übergang auf Marokko und den Krieg im Orient zu sprechen, ebenso auf die schwierige Lage Englands im fernsten Afrika. Die Damen redeten, als ob sie eine Gesellschaftskomödie, die sie schon oft wiederholt hatten, auswendig hersagten.
Jetzt erschien ein neuer Gast. Es war eine kleine Blondine mit Löckchen, die den Aufbruch einer großen, hageren, nicht mehr ganz jungen Person veranlasste.
Man sprach nun von den Aussichten des Herrn Linet für seine Wahl in die Akademie. Die neu erschienene Dame war überzeugt, er würde von Herrn Cabanon-Lebas geschlagen werden, dem Verfasser der schönen und formvollen Bearbeitung des »Don Quichotte« in Versen für die französische Bühne.
»Wissen Sie, dass sein Stück im nächsten Winter im Odeon aufgeführt wird?«
»Ach wirklich. Ich gehe bestimmt hin und sehe mir diesen literarischen Versuch an.«
Frau Walter antwortete sehr graziös, verbindlich und mit ruhiger Unparteilichkeit, sie war nie um eine Redewendung verlegen, ihre Meinung stand immer im Voraus fest.
Doch sie merkte, dass es dunkel wurde und ließ die Lampe hereinbringen, während sie gleichzeitig auf die Unterhaltung hörte, die ununterbrochen wie ein Wasserbach plätscherte. Dabei fiel ihr ein, dass sie vergessen hatte, beim Graveur die Einladungskarten für das nächste Diner zu bestellen.
Sie war etwas zu stark, aber noch schön, und befand sich in jenem gefährlichen Alter, wo der Niedergang nahe ist. Sie erhielt ihre Schönheit durch alle möglichen Bemühungen und Maßregeln, durch Hygiene und kosmetische Mittel. Alles, was sie tat, war besonnen, überlegt und vernünftig; sie gehörte zu den Frauen, deren Geist geradlinig ist wie ein französischer Garten. Da gibt es nirgends Überraschungen, aber alles ist niedlich und reizend. Sie hatte einen feinen diskreten und sicheren Verstand, der ihr die Fantasie vollkommen ersetzte, dabei war sie gütig, ruhig, wohlwollend, weitherzig für jedermann und für alles. Sie bemerkte, dass Duroy noch nichts gesagt hatte, dass niemand mit ihm redete, und dass er sich deshalb etwas unbehaglich zu fühlen schien. Die Damen sprachen noch immer von ihrem Lieblingsthema, der Akademie, da fragte sie:
»Herr Duroy, Sie müssten doch über die Frage besser orientiert sein als jeder andere. Wem würden Sie den Vorzug geben?«
Er antwortete, ohne zu zaudern:
»In dieser Frage, Madame, würde ich nie den strittigen Punkt über die literarischen Verdienste des einen oder des anderen Kandidaten ins Auge fassen, wohl aber ihr Alter und ihren Gesundheitszustand. Ich würde nicht nach ihren Aussichten, sondern nach ihren Krankheiten fragen. Ich würde mich nicht erkundigen, ob sie Lope de Vega in französische Verse übertragen, sondern nach dem Zustand ihrer Lebern, Herzen, Nieren und Rückenmarke. Für mich sind eine gute Herzerweiterung oder eine Nierenentzündung und vor allem ein hübscher Anfang einer Rückenmarkschwindsucht hundertmal mehr wert als eine vierzig Bände dicke literarisch-wissenschaftliche Arbeit über den Begriff der Vaterlandsliebe in der Literatur der wilden Völkerschaften.«
Ein erstauntes Schweigen folgte dieser Erklärung.
Frau Walter fragte lächelnd: »Warum denn eigentlich?«
Er antwortete: »Weil ich bei allen Dingen nur danach frage, welche Freude sie den Damen machen können. Nun aber interessiert man sich in Wirklichkeit für die Akademie doch nur dann, wenn ein Akademiker stirbt. Je mehr davon sterben, desto glücklicher müssen sie sein. Aber damit sie bald sterben, müsste man immer Alte und Kranke ernennen.«
Da die Damen noch etwas betroffen waren, fuhr er fort: »Übrigens geht es mir ebenso wie Ihnen. Ich lese die Pariser Nachrichten über den Tod eines Akademikers. Ich stelle sofort die Frage: Wer wird an seine Stelle treten? Und ich stelle meine Liste auf. Das ist ein Spiel, ein hübsches, kleines Spiel, das man in allen Pariser Salons beim Hinscheiden eines Unsterblichen spielt: das Spiel des Todes und der vierzig Greise.«
Man war immer noch einigermaßen erstaunt, begann aber jetzt zu lachen, so treffend war seine Bemerkung.
Nun schloss er, während er gleichzeitig aufstand: »Sie, meine Damen, ernennen die Akademiker, und Sie ernennen sie, um sie sterben zu sehen. Wählen Sie also alte, die ältesten, und nach dem Rest fragen Sie nicht.«
Mit graziöser Haltung ging er dann hinaus.
Als er fort war, fragte eine der Damen:
»Wer ist es eigentlich? Ein sehr witziger Mensch!«
»Einer unserer Redakteure«, erwiderte Frau Walter. »Er hat vorläufig noch keine hervorragende Stellung an der Zeitung, aber ich bin überzeugt, dass er bald hochkommen wird.«
Duroy ging fröhlich, mit großen, tanzenden Schritten den Boulevard Malesherbes hinunter und murmelte zufrieden:
»Ein guter Abgang.«
Am Abend söhnte er sich mit Rahel wieder aus.
Die folgende Woche brachte ihm zwei Ereignisse: er wurde zum Leiter des Nachrichtenteils ernannt und erhielt eine Einladung von Frau Walter zum Diner. Er begriff sofort, dass ein innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen bestand.
Die Vie Française war vor allen Dingen ein Börsenblatt, denn ihr Begründer war ein Finanzmann, der die Presse und sein Deputiertenmandat nur als Mittel zum Zweck betrachtete. Die Gutmütigkeit und wohlwollende Neutralität allem gegenüber war für ihn eine Waffe, und er spekulierte stets unter der lächelnden Maske des braven Mannes. Aber für alle seine Geschäfte benutzte er nur Menschen, die er vorher nach jeder Richtung hin beobachtet und erprobt hatte, und die er für schlau, geschickt und gerieben hielt. Duroy schien ihm an der Spitze des lokalen Nachrichtendienstes eine sehr brauchbare Persönlichkeit zu sein.
Bisher hatte der Redaktionssekretär Boisrenard diesen Posten verwaltet. Er war ein alter Journalist, korrekt, pünktlich und gewissenhaft wie ein Beamter. Seit dreißig Jahren war er Redaktionssekretär von elf verschiedenen Zeitungen, ohne seine Handlungs- und Anschauungsweise irgendwie zu ändern. Er wechselte die Redaktionen wie die Restaurants, und er merkte kaum, dass die Küche immer eine andere war. Politische und religiöse Anschauungen blieben ihm fremd. Er war der Zeitung, in der er gerade angestellt war, ergeben, arbeitete fleißig und wurde wegen seiner Erfahrung geschätzt. Trotzdem hielt er sehr auf seine Berufsehre, und er hätte sich nie zu etwas hergegeben, was er von seinem journalistischen Berufsstandpunkt für unehrenhaft, inkorrekt und unsauber gehalten hätte. Herr Walter achtete ihn deshalb zwar sehr hoch, aber gerade an der Spitze des lokalen Teils, der seiner Ansicht nach das Mark der Zeitung bildete, hätte er zuweilen doch gern eine andere Persönlichkeit gesehen. Denn hier wurden die Neuigkeiten lanciert, die Gerüchte in Umlauf gesetzt, durch die man auf das Publikum und auf die Kurse einwirkte. Zwischen zwei Berichten über Gesellschaftsabende muss man die wichtigen Nachrichten unauffällig einschieben und sie mehr andeuten als aussprechen. Zwischen den Zeilen muss man erraten lassen, was man eigentlich will, da muss man eine Neuigkeit so zu dementieren wissen, dass man sie erst recht glaubt, und etwas so bestätigen, dass jeder zu zweifeln beginnt. In den Lokalnachrichten muss jeder Tag für Tag wenigstens eine Zeile finden, die ihn interessiert, damit jedermann sie liest. Man muss dabei an alle und an alles denken, an alle Gesellschaftskreise und an alle Berufe, an Paris und an die Provinz, an die Armee und an die Maler, an die Geistlichkeit und an die Universität, an die Beamten und die Halbweltdamen.
Der Mann, der an der Spitze des Nachrichtenteils steht und das Heer der Reporter dirigiert, muss stets auf dem Posten sein, misstrauisch, vorausschauend, verschlagen, vorsichtig und gewandt sein, er muss den richtigen Instinkt haben, mit einer unfehlbaren Witterung begabt sein, um die falsche Nachricht auf den ersten Blick zu erkennen, um zu beurteilen, was gesagt und was verschwiegen werden muss, um sofort zu begreifen, was auf das Publikum wirken wird, und es dann so vorzubringen, dass die Wirkung vervielfältigt wird. Boisrenard besaß zwar eine lange Praxis, aber es fehlte ihm an Übersicht und Talent. Vor allen Dingen ließ er die angeborene Spitzfindigkeit vermissen, um tagaus, tagein die neuen Gedanken des Chefs zu wittern.
Duroy wusste die Sache glänzend zu meistern, er war eine hervorragende Errungenschaft der Redaktion dieses Blattes, das nach dem Ausdrucke Norbert de Varennes »auf den Strömungen des Staates und auf den Unterströmungen der Politik schwamm«.
Die geistigen Leiter und die eigentlichen Redakteure der Vie Francaise waren ein halbes Dutzend Deputierte, die an allen Spekulationen des Direktors interessiert waren. Man nannte sie in der Kammer die »Walter-Clique«, und beneidete sie, weil sie mit ihm und durch ihn offenbar viel Geld verdienten. Forestier war als politischer Redakteur nur der Strohmann dieser Geschäftsleute, der Vollstrecker der von ihnen eingeflößten Ideen. Sie soufflierten ihm seine großen Artikel, die er immer zu Hause schrieb, »um Ruhe zu haben«, wie er sagte.
Um dem Blatt jedoch einen literarischen und gesellschaftlichen, pariserischen Anstrich zu geben, hatte man ihm zwei berühmte Schriftsteller verschiedener Art und verschiedenen Charakters zur Seite gestellt: Jaques Rival, der aktuelle Plaudereien schrieb, und Norbert de Varenne, den Dichter der neuen Schule und fantasievollen Erzählungskünstler. Dann hatte man aus der großen Schar der »Journalisten für alles« um billiges Geld noch ein paar Kritiker für Kunst, Malerei, Musik und Bühne engagiert und außerdem einen Redakteur für Gerichtsverhandlungen und einen für Rennsport. Zwei Damen der Gesellschaft schickten unter dem Pseudonym »Rosa Domino« und »Samtpfötchen« ihre Berichte aus der vornehmen Welt in die Redaktion; sie behandelten Fragen der Mode und der Etikette und brachten allerlei Indiskretionen über bekannte Damen.
Und so schwamm die Vie Française »auf den Strömungen und Unterströmungen« der Politik und der Börse, gelenkt und geleitet von allen diesen verschiedenen Händen und Köpfen.
Duroy befand sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Freude über seine Ernennung, als er eine Einladungskarte erhielt, auf der stand: »Herr und Frau Walter bitten Herrn Georges Duroy, ihnen die Ehre zu erweisen, am Donnerstag, den 20. Januar, bei ihnen zu speisen.«
Diese neue Gunst, die mit der anderen so hübsch zusammentraf, erfüllte ihn mit solcher Freude, dass er die Einladung küsste, als wäre sie ein Liebesbrief gewesen. Dann begab er sich zum Kassierer, um die wichtige Gehaltsfrage zu besprechen.
Der Nachrichtenredakteur erhielt im Allgemeinen monatlich eine bestimmte Summe, von der er seine Reporter und ihre mehr oder weniger wichtigen Nachrichten zu honorieren hatte.
Für Duroy waren zunächst zwölfhundert Francs monatlich ausgesetzt, und er nahm sich vor, davon einen guten Teil für sich zu behalten.
Auf seine dringenden Vorstellungen hatte der Kassierer ihm endlich vierhundert Francs Vorschuss gegeben. Zuerst hegte Duroy tatsächlich die Absicht, an Madame de Marelle die zweihundertundvierzig Francs, die er ihr schuldete, zurückzugeben. Er überlegte sich aber, dass ihm dann nur hundertundsechzig Francs verblieben, eine Summe, die gänzlich unzureichend war, um seine neue Stellung in gebührender Weise zu bestreiten, und er verschob die Rückgabe auf spätere Zeiten. Zwei Tage lang beschäftigte er sich mit der Einrichtung, denn er übernahm einen besonderen Tisch nebst Brieffächern in dem allgemeinen Redaktionssaal. Er saß an dem einen Ende des Saales, während Boisrenard mit seinem trotz vorgeschrittener Jahre rabenschwarzen Haar, den Kopf über ein Blatt Papier gebeugt, an dem anderen Ende arbeitete.
Der lange Tisch in der Mitte des Saales war für die fliegenden Reporter reserviert. Gewöhnlich diente er als Sitzbank; man saß entweder am Rande mit herunterhängenden Beinen, oder in der Mitte: nach türkischer Art; so saßen die Reporter oftmals auf diesem Tische zu fünft oder zu sechst und spielten hartnäckig Fangball. Duroy hatte an diesem Spiel gleichfalls Geschmack gefunden und begann, dank der Anleitung von Saint-Potin, ziemlich gut zu spielen.
Forestier, der immer leidender wurde, hatte ihm sein zuletzt gekauftes Bilboquet aus Antillenholz anvertraut, das ihm selbst ein bisschen zu schwer war, und Duroy schwang mit kräftiger Hand die große schwarze Kugel am Ende der Schnur, wobei er leise zählte: »Eins — zwei — drei — vier — fünf — sechs —«
Er hatte zum ersten Male zwanzig Treffer hintereinander an dem Tage, wo er bei Madame Walter speisen sollte. »Heute ist ein guter Tag,« dachte er, »ich habe Erfolg«; denn die Gewandtheit im Fangballspiel verlieh in der Redaktion der Vie Francaise eine Art Vorrang.
Er verließ zeitig die Redaktion, um sich in Ruhe umkleiden zu können. Während er die Rue de Londres entlangschritt, sah er vor sich plötzlich eine kleine Dame, die ihrer ganzen Haltung nach Madame de Marelle sein musste. Er fühlte, wie es ihm heiß zu Kopf stieg und sein Herz begann laut zu klopfen. Er ging über den Fahrdamm, um sie im Profil sehen zu können. Sie blieb stehen, um gleichfalls hinüberzugehen. Er hatte sich getäuscht; er atmete auf.
Schon oft hatte er sich die Frage vorgelegt, wie er sich benehmen sollte, wenn er ihr begegnete? Sollte er sie grüßen oder sollte er so tun, als sehe er sie nicht?
»Ich werde sie nicht sehen«, dachte er.
Es war kalt; in den Rinnsteinen war das Wasser gefroren. Die Trottoire lagen grau und trocken im Laternenlicht.
Als der junge Mann nach Hause kam, sagte er sich: »Ich muss eine neue Wohnung haben. Mit der geht es nicht mehr.« Er fühlte sich nervös und lustig. Er wäre imstande gewesen, über die Dächer zu klettern, und er wiederholte immer laut vor sich hin, indem er von seinem Bett zum Fenster ging: »Das Glück kommt! Das Glück kommt! Ich muss an Papa schreiben.«
Von Zeit zu Zeit hatte er nach Hause geschrieben, und diese Briefe brachten immer Freude in das kleine normannische Wirtshaus, das dicht an der Straße lag, hoch oben auf dem Hügel, von dem man Rouen und das weite Tal der Seine übersehen konnte.
Von Zeit zu Zeit erhielt er auch ein blaues Briefchen, dessen Adresse mit zitternder Hand geschrieben war, und er las immer die gleichen Zeilen am Anfange des väterlichen Briefes:
»Mein lieber Sohn! Aus diesem Briefe sollst Du erfahren, dass es Deiner Mutter und mir gut geht. Es gibt nicht viel Neues bei uns. Trotzdem möchte ich Dir mitteilen … usw.«
Und im Innern seines Herzens bewahrte er Interesse für die Ereignisse, welche in seinem Dorf vorkamen, für die Nachbarschaft, für den Stand der Äcker und Ernten! Und er wiederholte, während er seine weiße Krawatte knotete:
»Ich muss morgen an Papa schreiben. Wie hätte sich der Alte gefreut, wenn er mich heute Abend sähe!«
Und plötzlich stand vor seinen Augen die kleine, verräucherte Küche seines Elternhauses hinter der leeren Gaststube; die Kessel, die ihren gelben Schimmer an den Wänden entlang warfen, die Katze vor dem Herd, die dampfende Suppenterrine mitten auf dem alten, hölzernen Tisch, und ein Licht, das zwischen zwei Tellern brannte.
Er sah auch den Mann und die Frau, seinen Vater und seine Mutter; die beiden alten Bauern mit langsamen Bewegungen, wie sie ihre Suppe löffelten. Er kannte die kleinsten Runzeln ihrer alten Gesichter, jede Bewegung von ihren Körpern. Er wusste sogar, was sie sich sagten, jeden Abend, wenn sie einander gegenüber saßen. »Ich muss sie doch mal wieder besuchen!« dachte er.
Als er mit seiner Toilette fertig war, blies er das Licht aus und ging hinunter. Auf dem Boulevard versuchten ein paar Dirnen ihn anzureden. Und als hätten sie ihn beleidigt und verkannt, rief er ihnen mit verächtlicher Stimme zu:
»Lasst mich doch endlich in Ruhe!« Für wen hielten sie ihn? Konnten sie denn die Männer nicht unterscheiden? In seinem Frack, den er angezogen hatte, um bei sehr reichen, sehr bekannten und sehr einflussvollen Leuten zu speisen, fühlte er sich als eine neue Persönlichkeit, als wäre er ein Mann der wirklich großen Gesellschaft geworden.
Mit ruhiger Sicherheit betrat er das Vorzimmer, das von hohen Bronzekandelabern erleuchtet war, und gab mit natürlicher Handbewegung Stock und Überzieher den beiden Dienern, die ihm entgegenkamen.
Alle Räume waren hell erleuchtet. Frau Walter empfing ihre Gäste in dem zweiten und größten Zimmer. Sie begrüßte ihn mit einem bezaubernden Lächeln, und er schüttelte den beiden Herren, die vor ihm gekommen waren, die Hand. Es waren die Abgeordneten Firmin und Laroche-Mathieu, die heimlichen Mitredakteure der Vie Française. Herr Laroche-Mathieu galt bei der Zeitung als besondere Autorität, da sein Einfluss, in der Kammer sehr bedeutend war. Man war auch allgemein überzeugt, dass er eines Tages Minister würde.
Dann kam das Ehepaar Forestier. Sie trug ein rosa Kleid, das ihr glänzend stand. Duroy sah mit Erstaunen, wie intim sie mit den beiden Abgeordneten war. Sie plauderte über fünf Minuten in der Ecke am Kamin ganz leise mit Laroche-Mathieu. Charles sah sehr verändert und mitgenommen aus. Er war seit einem Monat beträchtlich abgemagert und hustete unaufhörlich, wobei er immerfort sagte: »Ich müsste mich endlich entschließen, den Rest des Winters im Süden zu verbringen.«
Norbert de Varenne und Jaques Rival kamen zusammen. Dann öffnete sich eine Tür im Hintergrunde des Saales und Herr Walter erschien mit zwei jungen Mädchen von sechzehn und achtzehn Jahren, die eine hübsch, die andere hässlich.
Duroy wusste zwar, dass sein Chef Familienvater war; trotzdem war er sehr erstaunt. An die Töchter seines Vorgesetzten hatte er nur wie an weit entlegene Länder gedacht, die man niemals zu Gesicht bekommt. Außerdem hatte er sie sich als kleine Mädchen vorgestellt und sah sie nun fast erwachsen vor sich. Bei diesem Anblick wurde er innerlich etwas verlegen, eine Verlegenheit, die man beim Umlernen empfindet.
Sie wurden ihm vorgestellt, reichten ihm die Hand und setzten sich dann an einen kleinen Tisch, der wohl besonders für sie bestimmt war; dort begannen sie in einem Haufen von Seidenknäueln zu wühlen, die in einem Flechtkörbchen lagen.
Man erwartete noch jemand, und die Gäste standen schweigend in kleinen Gruppen herum, in jener ungemütlichen Stimmung, die vor dem Essen zu herrschen pflegt, wenn sich dazu Leute aus allen möglichen geistigen Sphären zusammenfinden, nachdem sie am Tage den verschiedensten Beschäftigungen nachgegangen sind.
Duroy hatte, weil er sonst nicht wusste, was er tun sollte, seine Augen auf die Wand gerichtet. Da rief ihm Herr Walter aus ziemlicher Entfernung zu, offenbar in der Absicht, seine Kunstsammlung zur Geltung zu bringen:
»Sie wollen meine Gemälde sehen?«
Das »meine« wurde nachdrücklich betont.
»Ich werde sie Ihnen gleich zeigen.« Und er nahm eine Lampe, damit sein Gast die Einzelheiten besser konnte.
»Hier sind die Landschaften«, sagte er.
In der Mitte der Wandfläche hing ein großes Bild von Guillemet, eine normannische Küste im Sturm. Darunter eine Waldlandschaft von Harpignies, dann eine algerische Ebene von Guillaumet mit einem Kamel am Horizont, einem riesigen, hochbeinigen Kamel, das einem fantastischen Denkmal glich.
Herr Walter ging zur nächsten Wand und trug feierlich wie ein Zeremonienmeister vor:
»Die große Kunst.«
Es waren vier Gemälde: »Ein Besuch im Krankenhause« von Gervex, »Eine Schnitterin« von Bastien Lepage, »Eine Witwe« von Bouguereau und »Eine Hinrichtung« von Jean Paul Laurens. Dieses letzte Bild stellte einen Priester aus Vendée dar, der von einem Trupp Soldaten an der Mauer seiner eigenen Kirche durch Erschießen hingerichtet wurde.
Ein Lächeln glitt über das ernste Gesicht des Hausherrn, als sie zur nächsten Wand kamen.
»Hier hängen die Humoristen.«
Man sah zunächst ein kleines Bild von Jean Béraud, das hieß: »Oben und unten.« Es stellte eine hübsche Pariserin dar, welche die Treppe eines Omnibusses in voller Fahrt hinaufstieg. Ihr Kopf befand sich in Höhe des Verdecks, und die Herren, die oben saßen, betrachteten mit zufriedener Miene das niedliche Gesicht, das zu ihnen emporkletterte, während die unten auf der Plattform stehenden, die Beine der jungen Frau mit einem Ausdruck von Verdruss und Begierde anschauten.
Herr Walter hielt die Lampe so hoch er konnte und wiederholte mit zweideutigem Lächeln:
»Wie meinen Sie? Ist es nicht drollig? Ist es nicht drollig?«
Dann erklärte er weiter:
»Das hier ist ›Die Rettung‹ von Lambert.«
Mitten auf einem abgedeckten Tisch saß ein junger Kater und beobachtete gespannt und erstaunt eine Fliege, die in ein Glas Wasser geraten war. Eine Pfote schwebte in der Luft; das Tier schien bereit zu sein, mit einer raschen Bewegung das unglückliche Insekt aus dem Wasser zu haschen. Aber es konnte sich nicht entschließen! Was würde es tun?
Dann zeigte der Hausherr ein Detaille: »Der Unterricht«. Das Bild stellte einen Soldaten in der Kaserne dar, der einen Pudel im Trommeln unterrichtete. »Das ist so geistreich!« sagte er.
Duroy war begeistert und lachte zustimmend:
»Wie entzückend! Wie entzückend! Wie entzü …«
Plötzlich hielt er inne; er hörte hinter sich die Stimme von Madame de Marelle, die soeben gekommen war. Der Chef fuhr fort, seine Gemäldesammlung zu beleuchten und zu erklären. Er zeigte noch ein paar Bilder und sagte dann:
»Ich habe noch welche in den anderen Räumen, aber es sind Bilder von Künstlern, die noch nicht berühmt sind. Dieses Zimmer hier ist mein Kunstsalon. Ich kaufe momentan sehr viele Bilder von ganz jungen Malern. Ich hänge sie in mein Privatzimmer und warte ruhig, bis die Schöpfer berühmt werden.«
Dann setzte er ganz leise hinzu:
»Es ist augenblicklich die richtige Zeit, um Bilder zu kaufen. Die Kunst geht betteln. Die Maler haben keinen Sou … sie müssen verkaufen.«
Doch Duroy sah nichts mehr und hörte zu, ohne ein Wort zu verstehen. Madame de Marelle war da und stand hinter ihm. Was sollte er tun? Wenn er sie grüßte, würde sie ihm womöglich den Rücken drehen oder ihm irgendeine Beleidigung ins Gesicht werfen. Und wenn er sich nicht näherte, was würde man dann denken?
»Ich will jedenfalls Zeit gewinnen«, dachte er. Er war so aufgeregt, dass er einen Augenblick daran dachte, irgendeinen Vorwand zu finden, um weggehen zu können.
Die Gemäldebesichtigung war zu Ende. Der Chef stellte die Lampe hin und begrüßte die Neuangekommene, während Duroy sich von Neuem in die Bilder vertiefte, als könne er sich vor Bewunderung von ihnen nicht losreißen. In seinem Kopf herrschte ein vollkommenes Durcheinander. Was sollte er nun tun? Er hörte hinter sich sprechen, er unterschied die Stimmen und vernahm die Unterhaltung; plötzlich rief Frau Forestier:
»Sagen Sie, bitte, Herr Duroy.«
Er eilte zu ihr hin, und sie empfahl ihm eine Freundin, die ein Fest geben wollte, und er sollte es in der Vie Française erwähnen.
»Aber selbstverständlich, gnädige Frau,« stotterte er, »mit größtem Vergnügen.«
Madame de Marelle stand jetzt ganz in seiner Nähe. Er wagte nicht mehr, sich umzudrehen und wieder fortzugehen. Nun glaubte er den Verstand zu verlieren; sie sagte ganz laut:
»Guten Tag, Bel-Ami! Sie kennen mich wohl gar nicht mehr?«
Hastig drehte er sich herum; sie stand vor ihm, lächelnd, mit frohem, liebestrahlendem Gesichtsausdruck. Sie reichte ihm die Hand. Er nahm sie zitternd, wobei er immer noch an eine Hinterlist, an eine verborgene Bosheit glaubte. Sie fuhr fröhlich fort:
»Was ist denn aus Ihnen geworden? Was tun Sie? Warum lassen Sie sich nicht mehr sehen?«
Er hatte seine Fassung noch nicht wiedergewonnen und stammelte:
»Ach, ich habe so viel zu tun gehabt, gnädige Frau! Herr Walter hat mir einen neuen Posten anvertraut, der mir große Arbeit macht.«
Sie sah ihm ins Gesicht. In ihrem Blick konnte er nichts anderes entdecken als Wohlwollen und Zuneigung.
»Ich weiß es,« erwiderte sie, »das ist aber kein Grund, Ihre Freunde zu vergessen.«
Sie wurden getrennt durch den Eintritt einer dicken, dekolletierten Dame mit roten Armen und roten Wangen, die sehr auffallend gekleidet war. Sie ging langsam und trat so schwer auf, dass man bei jeder Bewegung der gewaltigen Oberschenkel ihr riesiges Gewicht zu spüren glaubte.
Da sie anscheinend mit größter Rücksicht und Zuvorkommenheit behandelt wurde, wandte sich Duroy an Frau Forestier:
»Wer ist denn diese Dame?«
»Die Vicomtesse de Percemur, die unter dem Namen ›Samtpfötchen‹ schreibt.«
Er war starr und hätte am liebsten laut aufgelacht:
»Samtpfötchen! Das sollen Samtpfötchen sein! Und ich habe mir darunter eine junge, schöne Frau wie Sie gedacht. Na, das ist glänzend, ausgezeichnet!«
Ein Diener erschien in der Tür und meldete:
»Es ist angerichtet.«
Das Diner war zwanglos und lustig, eines jener Diners, bei denen man von allem redet und nichts sagt.
Duroy saß zwischen der hässlichen Tochter des Hausherrn, Fräulein Rose, und Madame de Marelle. Diese Nachbarschaft war ihm doch etwas peinlich, wenn sie auch vortrefflich bei Laune zu sein schien und ununterbrochen plauderte. Er war zuerst befangen und verwirrt, wie ein Musiker, der den Ton verloren hat. Allmählich fand er aber auch seine Sicherheit wieder. Sie sahen sich gegenseitig immer häufiger an, und ihre Blicke befragten einander und verstrickten sich so innig und verliebt wie früher. Plötzlich schien es ihm, als ob unter dem Tische etwas seinen Fuß streifte. Langsam schob er sein Bein vor, bis es an das seiner Nachbarin stieß, ohne dass sie vor dieser Berührung zurückwich. Sie sprachen dabei nicht miteinander, sondern jeder beschäftigte sich sehr eifrig mit seinem anderen Nachbarn.
Duroys Herz pochte. Er schob etwas weiter sein Knie vor. Er fühlte einen leichten Gegendruck, und er begriff, dass ihre Liebe wieder begonnen hatte.
Wie würden sie miteinander sprechen? Das war gleichgültig; aber ihre Lippen zitterten jedes Mal, wenn ihre Blicke sich begegneten. Doch der junge Mann wollte auch gegen die Tochter seines Chefs liebenswürdig sein und redete sie von Zeit zu Zeit an. Sie antwortete ganz wie ihre Mutter und wusste immer sofort, was sie erwidern sollte. Zur Rechten des Herrn Walter saß mit der Haltung einer Prinzessin die Vicomtesse de Percemur; und Duroy, der sich über diesen Anblick amüsierte, fragte ganz leise Madame de Marelle:
»Kennen Sie vielleicht auch die andere, die unter dem Namen ›Roter Domino‹ schreibt?«
»Gewiss. Die Baronin de Livar!«
»Auch so eine Massengestalt?«
»Nein. Aber genau so komisch. Sie ist ein langes Gerippe von sechzig Jahren, mit falschen Löckchen und langen Zähnen wie eine Engländerin und mit Anschauungen aus der Großväterzeit, Toilette desgleichen.«
»Wo hat man nur diese literarischen Berühmtheiten aufgegabelt?«
»Die Emporkömmlinge des Bürgertums schwärmen immer noch für Abfälle aus adligem Geschlecht.«
»Sonst liegt kein Grund vor?«
»Keiner.«
Am Tisch hatte jetzt eine politische Debatte zwischen dem Chef, den beiden Deputierten, Norbert de Varenne und Jaques Rival begonnen; sie dauerte bis zum Dessert.
Als man wieder im Salon war, näherte sich Duroy von Neuem Madame de Marelle. Er sah ihr tief in die Augen und fragte:
»Darf ich Sie heute nach Hause begleiten?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil Herr Laroche-Mathieu, der mein Nachbar ist, mich jedes Mal bis zur Haustür begleitet, wenn ich hier abends bin.«
»Wann darf ich Sie dann sehen?«
»Kommen Sie morgen zum Frühstück.«
Ohne ein weiteres Wort trennten sie sich.
Duroy blieb nicht lange. Er fand die Gesellschaft zu eintönig. Auf der Treppe holte er Norbert de Varenne ein, der sich ebenfalls empfohlen hatte. Der alte Dichter fasste ihn unterm Arm. Da sie auf so verschiedenen Gebieten tätig waren, brauchte er seine Rivalität nicht zu fürchten und brachte dem jungen Manne ein gewisses väterliches Wohlwollen entgegen.
»Wollen Sie mich ein Stückchen nach Hause begleiten?« fragte er.
»Mit größtem Vergnügen, verehrtester Meister!«
Sie gingen langsam weiter und schritten den Boulevard Malherbes hinunter.
Paris lag in dieser kalten Winternacht fast menschenleer da,. Es war eine Nacht, in der die Sterne viel weiter entfernt schienen als sonst und der eisige Windhauch aus der Unendlichkeit des Weltalls weit jenseits der Sterne zu kommen scheint,
Anfangs sprachen die Männer kein Wort; dann äußerte Duroy, um doch etwas zu sagen:
»Herr Laroche-Mathieu scheint recht klug und unterrichtet zu sein.«
»Finden Sie?« murmelte der alte Dichter.
Überrascht und zögernd erwiderte Duroy:
»Allerdings, er gilt ja für einen der fähigsten Köpfe in der Kammer.«
»Möglich. Unter den Blinden ist der Einäugige König. Diese ganze Gesellschaft, sehen Sie, ist sehr mittelmäßig. Ihr Geist steckt zwischen zwei Wänden — Geld und Politik. — Es sind alberne dumme Jungen, mein Lieber, mit denen man unmöglich über etwas reden kann, was uns am Herzen liegt. Ihr Geist hat einen Bodensatz von Schlamm oder besser gesagt von Mist, wie die Seine bei Asnieres. Es ist weiß Gott schwer, einen Menschen mit weitem Geist zu finden, bei dem uns wie am Meer das Empfinden von etwas Großem und Gewaltigem überkommt. Ich kannte ein paar solcher Menschen, jetzt aber sind sie tot.«
Norbert de Varenne sprach mit klarer aber gedämpfter Stimme, die laut durch die Nacht tönen müsste, wenn er nicht so innerlich und zurückhaltend gesprochen hätte. Er schien überreizt und traurig zu sein; er war erfüllt von jener Schwermut, die die Seelen befällt und sie zittern lässt wie der Frost die Erde. Er fuhr fort:
»Was hat das übrigens zu sagen, ob einer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Genie hat, zuletzt kommt ja doch das Ende.«
Er schwieg. Duroy, der sich innerlich froh und heiter fühlte, sagte lächelnd:
»Sie sehen heute zu schwarz, verehrtester Meister.«
»Das tu ich stets, mein Junge,« erwiderte der Dichter, »und in ein paar Jahren werden Sie es auch tun. Das Leben ist ein Berg; solange man hinaufsteigt, sieht man den Gipfel und fühlt sich glücklich. Ist man aber oben, dann erblickt man mit einmal den Abgrund und das Ende, nämlich den Tod. Bergauf geht es langsam, doch bergab schnell. In Ihrem Alter ist man fröhlich. Man erhofft so vieles, was übrigens nie eintritt. In meinen Jahren erwartet man nichts mehr… als den Tod.«
Duroy begann zu lachen:
»Verdammt! Mir wird es gruselig, wenn ich Sie höre.«
»Nein,« fuhr Norbert de Varenne fort, »Sie verstehen mich heute nicht. Aber später mal werden Sie sich dessen erinnern, was ich Ihnen jetzt sage. Es kommt ein Tag — und er kommt viel zu früh —, wo man nicht mehr lachen kann, weil hinter allem, was man sieht, der Tod steht!
Oh! Sie verstehen nicht mal dieses Wort: der Tod! In Ihrem Alter bedeutet das nichts — in meinem ist es schrecklich. Ja, auf einmal da versteht man es, man weiß nicht woher und man weiß nicht warum, und plötzlich bekommt das Leben ein anderes Gesicht. Ich fühle es schon seit fünfzehn Jahren, wie er an mir zehrt, als ob ich ein Nagetier im Busen trüge. Ich merke, wie er mich nach und nach, Monat für Monat, Stunde für Stunde, zerstört, wie ein altes Haus, das dem Einsturz nahe ist. Er hat mich so völlig entstellt, dass ich mich nicht mehr wiedererkenne. In mir ist nichts mehr von mir selbst, von dem frischen, starken, strahlenden Manne, der ich mit dreißig Jahren war, übriggeblieben. Ich sah, wie er meine schwarzen Haare weiß färbte, allmählich, mit einer hinterlistigen und heimtückischen Langsamkeit. Er nahm mir meine straffe Haut, meine Muskeln, meine Zähne, meinen ganzen Körper und ließ mir nur eine verzweifelte Seele, die ihm auch wohl bald zum Opfer fallen wird.
Er hat mich zermalmt, der Schuft, Sekunde für Sekunde, langsam und allmählich hat er sein furchtbares Zerstörungswerk an meinem Wesen vollbracht, und jetzt fühle ich den Tod in allem, was ich tue. Jeder Schritt bringt mich ihm näher, jede Bewegung, jeder Atemzug beschleunigt seine entsetzliche Arbeit. Atmen, Schlafen, Essen, Trinken, Arbeiten, Denken, alles, was wir tun, ist im Grunde Sterben. Das ganze Leben ist Sterben l
Oh! Sie werden es auch erfahren; Sie brauchen nur eine Viertelstunde darüber nachzudenken, es wird Ihnen auch klar sein.
Was erhoffen Sie von der Liebe? Noch ein paar Küsse … und Sie sind impotent.
Und weiter was? Geld? Wozu? Um Weiber zu bezahlen? Ein hübsches Glück! Um viel essen zu können, dick zu werden und Nächte hindurch vor Schmerzen und Qualen der Gicht zu schreien? …
Und was noch? Ruhm? Wozu, wenn man ihn nicht mehr in der Gestalt der Liebe genießen kann? Und dann? Immer der Tod zum Schluss! Ich sehe ihn jetzt oft so nahe vor mir, dass ich die Arme ausstrecken möchte, um ihn von mir zu stoßen. Er bedeckt die Erde und erfüllt den Raum. Ich entdecke ihn überall. Die kleinen Tierchen, die auf den Wegen zertreten werden, die fallenden Blätter, das weiße Haar im Bart eines Freundes, alles zerreißt mir das Herz und ruft mir zu: ›Da ist er’!
Er verdirbt mir alles, was ich tue und was ich sehe, was ich esse und was ich trinke, alles, was ich liebe: den hellen Mondschein, den Sonnenaufgang, das Rauschen des Meeres, das Plätschern des Baches, und die milde Luft der Sommerabende.«
Er ging langsam vor sich hin, etwas außer Atem; er träumte laut und vergaß fast, dass ihm jemand zuhörte.
»Und nie,« fuhr er fort, »nie kehrt ein Menschenwesen wieder. Niemals … Man bewahrt die Form, in der man eine Bronzestatue gießt, jeder Stempel liefert immer wieder den gleichen Abdruck, aber mein Körper, mein Geist, meine Seele, meine Wünsche werden nie wiederkehren. Und doch werden Millionen und Milliarden Menschen geboren, die auf ein paar Quadratzentimeter eine Nase, Augen, eine Stirn, Backen und einen Mund haben wie ich und auch eine Seele wie ich, aber ich selbst kehre niemals wieder, ja nicht einmal irgendein erkennbarer Teil von mir taucht wieder auf unter diesen unzählbaren Wesen, die unbegrenzt verschieden sind, trotzdem sie sich alle fast gleichen.
An wen sich halten? An wen unsere Schmerzensrufe richten? An wen soll man glauben? Alle Religionen sind stumpfsinnig mit ihrer dummen Kindermoral und egoistischen Verheißungen, die so grenzenlos töricht sind. Der Tod allein ist uns gewiss.«
Er blieb stehen, fasste Duroy mit beiden Händen an den Rändern seines Paletotkragens und fuhr mit langsamer Stimme fort:
»Denken Sie darüber nach, junger Mann, denken Sie darüber tage-, monate- und jahrelang nach und Sie werden eine ganz andere Anschauung vom Leben und Dasein gewinnen. Versuchen Sie also alles abzuschütteln, was Sie umgibt; machen Sie die übermenschlichsten Anstrengungen, um bei lebendigem Leibe sich aus Ihrer Haut, Ihren Interessen, Ihren Gedanken, aus der gesamten Menschheit loszulösen und über all das hinauszublicken, und Sie werden begreifen, wie gleichgültig und belanglos der Streit zwischen Naturalisten und Romantikern, sowie die ganzen Etatsdebatten sind.«
Er beschleunigte seinen Schritt:
»Aber dann werden Sie auch die furchtbare Trübsal der Hoffnungslosen empfinden. Verlassen und verloren werden Sie im Ungewissen sich abquälen. Sie werden, nach allen Seiten um Hilfe rufen und niemand wird Ihnen, antworten. Sie werden die Arme emporstrecken, Sie werden flehen, dass man Ihnen hilft, Sie liebt, tröstet, rettet, und es wird niemand kommen.
Und warum müssen wir so leiden? Gewiss, wir sind mehr zum körperlichen als zum geistigen Leben geboren; aber durch unser Denken ist ein Missverhältnis entstanden zwischen unserer wachsenden Erkenntnis und den unveränderlichen Lebensbedingungen.
Sehen Sie sich die beschränkten Menschen an. Wenn sie nicht zufällig schwere Schicksalsschläge treffen, sind sie zufrieden und leiden nicht unter dem allgemeinen Unglück. Auch die Tiere haben kein Empfinden dafür.«
Nochmals blieb er stehen und sann eine kurze Weile nach. Dann sagte er mit minder resignierter Stimme:
»Ich bin ein verlorenes Geschöpf; ich habe weder Vater noch Mutter, noch Bruder, noch Schwester, noch Weib, noch einen Gott.«
Nach einer Pause fügte er hinzu:
»Ich habe nur den Reim.«
Und er hob den Kopf zum Firmament, an dem das bleiche Vollmondantlitz leuchtete und deklamierte:
»Vergeblich such’ ich dieses Rätsels Schlüssel
am bleichen Mond, am weiten Sternenhimmel.«
Sie kamen zur Pont de la Concorde, schweigend schritten sie über die Brücke und gingen am Palais Bourbon entlang. Norbert de Varenne begann von Neuem:
»Heiraten Sie, lieber Freund, denn Sie wissen nicht, was es in meinem Alter heißt, allein zu sein. Heute erfüllt mich die Einsamkeit mit einer entsetzlichen Angst, die Einsamkeit in der Wohnung, wenn ich abends am Feuer sitze. Dann scheint es mir immer, als wäre ich allein auf der Welt, umgeben von dunklen Gefahren und allerlei unbekannten, schrecklichen Dingen; und die Wand, die mich von meinem unbekannten Nachbar trennt, entfernt mich von ihm so weit wie die Sterne, die ich durch das Fenster sehe. Mich überfällt dann eine Art Fieberwahn, der Fieberwahn der Furcht und des Schmerzes, und das Schweigen der Wände entsetzt mich. Es ist so tief und so traurig, das Schweigen in dem Zimmer, in welchem man ganz allein lebt. Es umfängt nicht bloß den Körper, sondern auch die Seele, und wenn ein Stück Möbel kracht, erbebt einem das Herz, denn man erwartet kein Geräusch in dieser trüben Behausung.«
Nach einer Pause setzte er hinzu:
»Wenn man alt ist, muss es doch schön sein, Kinder zu haben!«
Sie waren in der Mitte der Rue Bourgogne angelangt. Vor einem hohen Hause blieb der Dichter stehen, klingelte, schüttelte Duroy die Hand und sagte:
»Vergessen Sie das unnütze Geschwätz des Alten, junger Freund, und leben Sie, wie es Ihrem Alter gebührt! Adieu!«
Und er verschwand in dem finsteren Flur.
Duroy ging mit beklommenem Herzen weiter. Ihm war, als hätte man ihm eine Grube voll menschlicher Knochen und Schädel gezeigt, und in diese Grube musste auch er eines Tages unweigerlich stürzen.
Er murmelte:
»Donnerwetter! Sehr lustig muss es da oben bei ihm nicht sein! Ich würde es lieber vorziehen, beim Vorbeimarsch seiner Gedanken nicht anwesend zu sein. Weiß Gott! Nein!«
Er war stehengeblieben, um eine stark parfümierte Dame vorbei zu lassen, die aus dem Wagen stieg und in ihr Haus ging; mit vollen Zügen atmete er den Duft der Verbenen und Iris ein, der sich in der Luft verflüchtigte. Plötzlich klopfte sein Herz wieder laut vor freudiger Hoffnung, und die Erinnerung an Madame de Marelle, die er morgen wiedersehen sollte, erfüllte ihn von Kopf bis zu Fuß. Alles lächelte ihm zu und das Leben nahm ihn zärtlich in seine Arme. Wie schön war es, seine Hoffnungen verwirklicht zu sehen!
Wie in einem Rausch schlief er ein und erhob sich ziemlich früh, um noch einen Spaziergang in der Avenue du Bois de Boulogne zu machen, ehe er zum Rendezvous ging.
Der Wind hatte sich über Nacht gedreht, es war milder geworden, sodass man sich fast im April glauben konnte. Alle ständigen Besucher des Bois waren unterwegs; sie waren dem Lockrufe des heiteren, warmen Himmels gefolgt.
Duroy ging langsam und atmete behaglich die milde Luft in sich ein. Hinter der Arc de Triomphe de L’étoile bog er in die große Avenue ein, auf der entgegengesetzten Seite des Reitweges. Da trabten und galoppierten an ihm Damen und Herren vorbei, die Reichen dieser Erde, die er aber heute kaum noch beneidete. Er kannte sie fast alle beim Namen, wusste die Höhe ihres Vermögens und kannte die Geheimgeschichten ihres Lebens, denn sein Beruf hatte ihn zu einer Art Almanach aller Pariser Berühmtheiten und Skandale gemacht.
Die Damen ritten vorbei, zierlich und schlank in ihren dunklen Tuchkleidern und hatten etwas Hochmütiges und Unnahbares im Ausdruck, wie es Reiterinnen oft haben.
Duroy erlaubte sich den Spaß und sagte halblaut die Namen, Titel und Eigenschaften der Liebhaber her, die sie gehabt hatten oder die man ihnen nachsagte, so wie man Litaneien in einer Kirche murmelt, bisweilen aber, anstatt zu sagen: »Baron de Tanquelet, Prinz de la Tour Enguerrand,« murmelte er: »Geschmack Lesbos; Louise Michot vom Vaudeville, Rose Marquetin von der Opéra.«
Dieses Spiel machte ihm viel Vergnügen; es tröstete ihn, erheiterte ihn und reizte ihn auf, unter dem Anschein ernster und würdiger Tugend die tief unausrottbare Gemeinheit der Menschheit zu entdecken.
Dann sagte er ganz laut: »Heuchlerbande!« Und seine Blicke suchten diejenigen Reiter heraus, über die die schlimmsten Geschichten im Umlauf waren.
Er sah viele, die man als Falschspieler in Verdacht hatte, für die die Klubs jedenfalls eine große und einzige Geldquelle, und sicherlich auch eine verdächtige Geldquelle waren.
Andere ganz berühmte Persönlichkeiten lebten ausschließlich von dem Vermögen ihrer Frauen, andere, wie man behauptete, von dem Gelde ihrer Geliebten. Viele hatten ihre Schulden bezahlt (eine höchst ehrenhafte Handlung), ohne dass man je eine Ahnung hätte, woher sie das nötige Geld aufgetrieben hatten (ein recht verdächtiges Geheimnis). Er sah Finanzmänner, deren gewaltige Vermögen von einem Diebstahl herrührten, Leute, die überall empfangen wurden, selbst in den vornehmsten Häusern. Er sah Herren, die so geachtet waren, dass die kleinen Leute ehrfurchtsvoll den Hut abzogen, wenn sie vorbei kamen, trotzdem ihre schamlosen Betrügereien in öffentlichen Unternehmungen für keinen, der hinter die Kulissen der großen Welt einen Einblick hatte, ein Geheimnis waren. Hochmütig und stolz ritten sie daher und blickten keck und unverschämt in die Welt hinein. Duroy lachte immer noch und wiederholte: »Das ist ein richtiges Gaunerpack! Schwindler!«
Da kam in schnellem Trabe ein reizender, offener, niedriger Wagen vorbei, vor den zwei Schimmelponys mit flatterndem Schweif und Mähne gespannt waren. Eine zierliche, junge Blondine kutschierte; es war eine bekannte Kurtisane; hinter ihr saßen zwei Grooms. Duroy blieb stehen; er hatte Lust, ihr einen zustimmenden Liebesgruß zuzuwinken, ihr Beifall zu klatschen, dieser Freibeuterin der Liebe, die auf dieser Spazierfahrt und zu dieser Stunde mitten unter all diesen aristokratischen Heuchlern ihren frechen Luxus, den sie auf ihrem Lager verdiente, zur Schau zu stellen wagte. Er fühlte wohl unklar, dass es etwas Gemeinsames zwischen ihnen gäbe, dass ein natürliches Band sie verknüpfe, dass sie von derselben Natur und Denkart wären und dass sein Erfolg ebenso auffallend sich gestalten würde.
Er kehrte langsam zurück; sein Herz war von innerlicher Befriedigung erwärmt, und er kam etwas vor der festgesetzten Zeit an die Tür seiner früheren Geliebten.
Sie empfing ihn mit hingehaltenen Lippen, als ob es niemals ein Zerwürfnis zwischen ihnen gegeben habe, und sie vergaß sogar auf einige Augenblicke die kluge Vorsicht, die sie sonst in ihrer Wohnung allen seinen Zärtlichkeiten entgegenzusetzen pflegte. Dann sagte sie ihm, indem sie die gedrehten Enden seines Schnurrbarts küsste:
»Du weißt noch gar nicht, mein Liebling, welchen Verdruss ich wieder habe. Ich freute mich schon auf einen wundervollen Honigmonat mit dir, und nun kommt plötzlich mein Mann für sechs Wochen zurück. Er hat Urlaub genommen. Ich kann aber nicht sechs Wochen leben, ohne dich zu sehen, besonders nach unserem kleinen Zwist, und ich habe deshalb die Dinge so arrangiert: Ich lade dich Montag zum Essen ein. Ich habe ihm schon von dir erzählt und werde dich ihm vorstellen.«
Duroy war etwas überrascht und zauderte; er hatte noch nie mit einem Mann verkehrt, dessen Frau seine Geliebte war. Er fürchtete, irgendetwas, eine gewisse Verlegenheit, ein Blick könnte ihn verraten. Er stammelte:
»Nein, ich möchte lieber deinen Mann nicht kennenlernen.«
Sie war sehr erstaunt und tat ihre naiven Augen weit auf, doch sie bestand darauf.
»Warum denn nicht? Wie kann man bloß so komisch sein? Das kommt doch alle Tage vor! Ich hatte dich wirklich nicht für so einfältig gehalten.«
Ihre Worte verletzten ihn.
»Nun gut, meinetwegen,« sagte er, »ich komme Montag zum Essen.«
Sie setzte hinzu:
»Damit es natürlicher aussieht, werde ich noch Forestier einladen. Eigentlich macht es mir wenig Spaß, Gäste bei mir zu haben.«
Die Tage bis zum Montag dachte Duroy nicht mehr an die bevorstehende Bekanntschaft; aber als er die Treppe zu Madame de Marelle hinaufging, fühlte er sich seltsam beunruhigt, nicht weil es ihm widerstrebte, die Hand dieses Mannes zu drücken, oder seine Gastfreundschaft anzunehmen, sondern er fürchtete etwas, worüber er nicht klar war.
Er wurde in den Salon geführt und er musste, wie immer, warten. Dann öffnete sich die Tür und er erblickte einen großen Mann mit weißem Vollbart, ernst und sehr korrekt, der auf ihn zukam, und mit peinlicher Höflichkeit sagte:
»Meine Frau hat öfters von Ihnen gesprochen, und ich bin entzückt, Sie kennenzulernen.«
Duroy schritt ihm entgegen, versuchte seinem Gesicht einen Ausdruck von Herzlichkeit zu geben und drückte etwas übertrieben energisch die Hand seines Gastgebers. Dann setzten sie sich, aber er wusste nicht, wie er die Unterhaltung beginnen sollte.
Herr de Marelle legte ein Stück Holz ins Feuer und fragte:
»Sind Sie schon lange im Journalismus tätig?«
»Nein, erst ein paar Monate«, antwortete Duroy.
»Dann sind Sie aber schnell vorwärts gekommen.«
»Ja, ziemlich schnell.« Und er sprach weiter, was ihm gerade durch den Kopf fuhr, mit allen nichtssagenden Redensarten, die man so oft unter wenig bekannten Leuten anwendet. Er beruhigte sich allmählich und begann, die ganze Situation sehr komisch zu finden. Er betrachtete die ernsthafte und ehrwürdige Gestalt von Herrn de Marelle, und auf seinen Lippen zuckte ein Lächeln, wenn er sich sagte: »Du, ich setze dir Hörner auf, mein Alter, ich setze dir Hörner auf!« Ihn erfüllte eine schadenfrohe, innere Genugtuung, die Befriedigung eines erfolgreichen Diebes, auf den man keinen Verdacht hat, eine spitzbübische, köstliche Freude. Plötzlich hatte er das Verlangen, ein Freund dieses Mannes zu werden, sein Vertrauen zu gewinnen und die Geheimnisse seines Lebens kennenzulernen. In diesem Augenblick trat Madame de Marelle ein, betrachtete beide mit lächelndem, undurchdringlichem Blick und ging dann auf Duroy zu, der ihr in Gegenwart des Mannes nicht die Hand zu küssen wagte, wie er es sonst tat.
Sie war ruhig und lustig wie eine Frau, die an alles gewöhnt war und die in ihrer angeborenen Verdorbenheit diese Begegnung ganz natürlich und einfach fand. Dann kam Laurine und hielt kühler als sonst Duroy ihre Stirn hin; die Gegenwart ihres Vaters machte sie schüchtern.
»Nun,« sagte die Mutter, »heute nennst du Herrn Duroy nicht mehr Bel-Ami?«
Das Kind errötete, als hätte man eine große Indiskretion begangen, etwas verraten, was man nicht sagen darf, ein Geheimnis ihres Herzens ausgeplaudert.
Als das Ehepaar Forestier kam, war man über das Aussehen von Charles entsetzt. In der letzten Woche war er furchtbar blass und mager geworden und hustete unaufhörlich. Er erzählte, dass sie auf Anordnung des Arztes nächsten Donnerstag nach Cannes führen.
Sie gingen frühzeitig nach Hause und kopfschüttelnd sagte Duroy:
»Es geht ihm sehr schlecht. Ich glaube kaum, dass er noch lange leben wird.«
»Oh, er ist verloren«, erwiderte Madame de Marelle mit Überzeugung. »Hat er ein Glück gehabt, so eine Frau zu finden!«
»Hilft sie ihm viel?« fragte Duroy.
»Und wie! Sie macht alles. Sie ist über alles im Bilde, sie kennt jeden Menschen, und tut dabei so, als sehe sie niemanden. Sie setzt durch, was sie will, wie sie will und wann sie will. Oh, sie ist klug, geschickt und intrigant wie keine! Für einen Mann, der vorwärts kommen will, ist sie ein Schatz.«
»Sie würde bestimmt bald wieder heiraten«, sagte Georges.
»Ja,« antwortete Madame de Marelle, »ich wäre gar nicht erstaunt, wenn sie jetzt schon jemanden in Sicht hätte … einen Abgeordneten … vorausgesetzt … dass er nicht nein sagt … denn … denn es gibt schwere Hindernisse … moralischer Art. Übrigens, was weiß ich?«
Herr de Marelle brummte etwas ungeduldig:
»Du weißt, ich liebe nicht, wenn du solche Andeutungen machst. Mischen wir uns nie ein in die Angelegenheiten des anderen, es genügt, wenn man selbst ein ruhiges Gewissen bewahrt. Das sollte für jeden ein Gesetz sein.«
Duroy verabschiedete sich etwas verwirrt, und unklare Kombinationen schwirrten durch seinen Kopf.
Als er am nächsten Tag Forestiers besuchte, traf er sie beim Packen. Charles lag auf einem Diwan, atmete schwer und wiederholte immer:
»Ich hätte vor einem Monat reisen sollen.«
Dann gab er Duroy eine Reihe Aufträge für die Zeitung, obwohl alles schon mit Herrn Walter geregelt und besprochen war. Als Georges ging, drückte er ihm lebhaft die Hand und sagte:
»Also, auf baldiges Wiedersehen, alter Freund!«
Madame Forestier begleitete ihn bis zur Tür und er sagte ihr mit plötzlicher Herzlichkeit:
»Vergessen Sie nicht unsere Vereinbarung. Wir sind Freunde und Verbündete, nicht wahr? Also, wenn Sie mich brauchen, zögern Sie nicht, ein Telegramm oder ein Brief — und ich gehorche.«
»Danke, ich werde es nicht vergessen«, flüsterte sie.
Und ihre Augen sagten ihm: »Danke«, mit einem tiefen, innigen Blick.
Als Duroy die Treppe hinunterging, begegnete er dem Grafen Vaudrec, den er schon einmal bei ihr gesehen hatte, und der langsam die Treppe heraufkam. Der Graf schien traurig zu sein, vielleicht wegen der Abreise.
Der Journalist wollte sich als Weltmann zeigen und grüßte ihn außerordentlich zuvorkommend.
Der Graf erwiderte seinen Gruß höflich, aber etwas von oben herab.
Am Donnerstag abend reiste das Ehepaar Forestier ab.