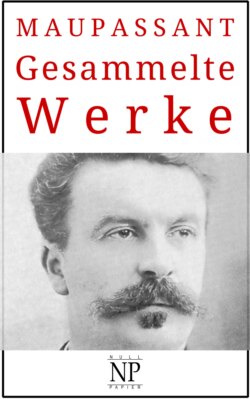Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 38
I
ОглавлениеGeorges Duroy hatte sich wieder ganz in seine alten Gewohnheiten eingelebt.
In seiner kleinen Parterrewohnung in der Rue Constantinople lebte er still und zurückgezogen, wie ein Mann, der sich auf eine neue Lebensführung vorbereitet. Selbst seine Beziehungen zu Madame de Marelle hatten jetzt einen ehelichen Charakter angenommen, als ob er sich für das bevorstehende Ereignis einüben wollte. Seine Geliebte war auch oft sehr erstaunt über die friedliche Regelmäßigkeit ihres Zusammenseins und sagte ihm lachend:
»Du bist noch braver und häuslicher als mein Mann. Es hat sich wirklich nicht gelohnt, zu wechseln.«
Frau Forestier weilte noch immer in Cannes. Er erhielt einen Brief von ihr, worin sie schrieb, dass sie erst Mitte April zurückkäme; von den letzten Stunden ihres Beisammenseins schrieb sie nichts. Er wartete; er war jetzt fest entschlossen, sie zu heiraten und alle Mittel anzuwenden, falls sie noch zaudern sollte. Er vertraute auf sein Glück und auf die unwiderstehliche Anziehungskraft, die er auf alle Frauen ausübte, und deren er sich wohl bewusst war.
Ein paar kurze Zeilen benachrichtigten ihn, dass die Entscheidungsstunde bald schlagen würde.
»Ich bin in Paris, kommen Sie, mich besuchen.
Madeleine Forestier.«
Nichts weiter. Er erhielt den Brief mit der Neunuhrpost und kam am selben Tage um drei zu ihr. Sie reichte ihm beide Hände und lächelte mit ihrem reizenden, liebenswürdigen Lächeln, und einige Sekunden lang sahen sie einander tief in die Augen.
»Wie lieb war es von Ihnen, dass Sie mich in meiner schrecklichen Lage nicht allein ließen«, sagte sie dann leise.
»Ich hätte alles getan, was Sie mir befohlen hätten«, erwiderte er.
Daraufhin setzten sie sich. Sie erkundigte sich nach Neuigkeiten, nach Walters und nach allen Kollegen auf der Redaktion. Sie hatte oft an die Zeitung gedacht.
»Alles das fehlt mir sehr«, sagte sie. »Ich war so ganz und gar Journalistin geworden. Ich liebe nun einmal diese Tätigkeit.«
Dann schwieg sie. Er glaubte, sie zu verstehen; er glaubte in ihrem Lächeln, in dem Ton ihrer Stimme, ja selbst in ihren Worten eine Art Aufforderung zu finden. Er hatte sich zwar vorgenommen, die Sache nicht zu überstürzen, aber dann konnte er nicht mehr an sich halten und stammelte:
»Nun ja … warum … warum wollen Sie denn nicht diese Tätigkeit unter … dem Namen Duroy wieder aufnehmen?«
Sie wurde plötzlich ernst, legte die Hand auf seinen Arm und sagte:
»Reden wir nicht darüber.«
Doch er verstand, dass sie »ja« sagte; er sank auf die Knie, küsste leidenschaftlich ihre Hände und stotterte immerfort:
»Oh, danke, danke, wie ich Sie liebe.«
Sie stand auf. Er tat das gleiche und bemerkte, dass sie sehr bleich war. Da wurde ihm klar, dass er ihr gefallen hatte, und vielleicht schon seit längerer Zeit. Sie standen dicht beieinander; er zog sie an sich und drückte ihr einen langen, zärtlichen Kuss auf die Stirn. Sie machte sich los, lehnte sich an seine Brust und fuhr in ernsthaftem Tone fort:
»Hören Sie mich an, mein lieber Freund, noch bin ich zu gar nichts entschlossen, aber es wäre nicht unmöglich, dass ich ja sagte. Sie müssten mir aber absolute Verschwiegenheit versprechen, bis ich Sie davon entbinde.«
Er schwor es und ging; sein Herz jauchzte vor Freude.
Von da ab besuchte er sie stets mit großer Vorsicht und bat sie auch nicht um eine bestimmte Zusage, denn ihre Art, wie sie über die Zukunft sprach, wie sie »später« sagte und allerlei Pläne entwarf, in denen sie beide eine Rolle spielten, sprach deutlicher und doch zarter als ein formelles Jawort.
Duroy arbeitete fleißig, gab wenig aus, versuchte etwas Geld zurückzulegen, um bei seiner Heirat wenigstens etwas Geld zu besitzen. Er wurde nun ebenso geizig, wie er früher verschwenderisch gewesen war.
Der Sommer ging vorbei und dann der Herbst, ohne dass jemand auf den geringsten Verdacht kam, denn sie sahen sich selten und so unauffällig wie möglich. Eines Abends fragte ihn Madeleine und sah ihm dabei tief in die Augen:
»Sie haben doch Madame de Marelle von unseren Plänen noch nichts mitgeteilt?«
»Nein, Teuerste, ich versprach Ihnen, zu schweigen und habe keiner lebenden Menschenseele ein Wort davon gesagt.«
»Nun gut, es wird jetzt Zeit sein, sie darauf vorzubereiten. Ich werde meinerseits Walters übernehmen. Also es geschieht diese Woche, nicht wahr?«
Er war rot geworden: »Ja, gut, morgen«, sagte er.
Sie senkte ihre Augen, als wolle sie seine Verwirrung nicht bemerken, und sagte:
»Wenn es Ihnen recht ist, können wir Anfang Mai heiraten. Es würde sehr gut passen.«
»Ich füge mich Ihnen mit Freuden in allem.«
»Der zehnte Mai ist ein Sonnabend. Er wäre mir besonders lieb, denn es ist mein Geburtstag.«
»Schön, den zehnten Mai.«
»Ihre Eltern wohnen in der Nähe von Rouen, nicht wahr? So sagten Sie mir wenigstens.«
»Ja, dicht bei Rouen, in Canteleu.«
»Was tun sie dort?«
»Sie sind … sie sind kleine Rentner.«
»Ach, ich freue mich sehr darauf, sie kennenzulernen.«
Erschrocken verstummte er.
»Ja … aber … es sind …«
Dann nahm er sich zusammen und sagte:
»Meine teuerste Freundin, es sind Bauern, die ein Wirtshaus besitzen, die sich Hände und Füße blutig gearbeitet haben, damit ich studieren konnte. Ich schäme mich ihrer nicht, aber ihre bäuerliche Einfachheit … könnte Ihnen vielleicht doch peinlich sein.«
Sie lächelte zärtlich. Ihr Gesicht strahlte von sanfter Güte.
»Nein, ich werde sie sehr gern haben. Wir werden sie besuchen. Ich will es. Wir sprechen nachher darüber. Auch meine Eltern waren kleine Leute. Doch sie sind schon beide tot. Ich habe keinen Menschen mehr auf Erden …« Sie reichte ihm die Hand und fügte hinzu: » … außer Ihnen!«
Er fühlte sich gerührt und ergriffen. Noch nie hatte eine Frau ihn so bezaubert.
»Mir ist noch etwas eingefallen,« fuhr sie fort, »aber es ist recht schwer zu erklären.«
»Was denn?«
»Nun ja, mein Lieber, ich bin nämlich wie alle Frauen. Ich habe meine kleinen Schwächen. Ich liebe alles, was schön glänzt und gut klingt. Ich würde so gern einen adligen Namen tragen. Könnten Sie sich gelegentlich unserer Heirat nicht etwas … etwas adeln?«
Diesmal errötete sie, als hätte sie ihm einen unpassenden Vorschlag gemacht.
Er antwortete einfach:
»Ich habe schon oft darüber nachgedacht, aber es scheint wohl nicht so einfach zu sein.«
»Weshalb denn?«
Er lachte.
»Weil ich nicht lächerlich erscheinen will.«
Sie zuckte die Achseln.
»Aber gar nicht, nicht im Geringsten. Alle Welt tut das und niemand lacht darüber. Zerlegen Sie Ihren Namen einfach in zwei Teile und nennen Sie sich Du Roy! Das geht doch sehr gut.«
Er antwortete schnell, wie jemand, der sich in solchen Dingen gut auskennt:
»Nein, das geht nicht. Das Verfahren ist zu einfach, zu gewöhnlich und zu bekannt. Wohl habe ich schon daran gedacht, den Namen meiner Heimat anzunehmen; zunächst als literarischen Decknamen, ihn dann allmählich dem meinigen hinzuzufügen. Später könnte ich, wie Sie vorschlagen, meinen Namen teilen.«
»Canteleu ist Ihre Heimat?«
»Ja.«
Sie überlegte.
»Nein, die Endung gefällt mir nicht. Könnten wir vielleicht das Wort etwas ändern … Canteleu?«
Sie nahm eine Feder vom Tisch und schrieb verschiedene Namen hin und prüfte ihr Aussehen. Plötzlich rief sie:
»Halt! Halt! Ich habe es!«
Sie reichte ihm ein Stück Papier, auf dem er las:
»Madame Duroy de Cantel.«
Einige Sekunden überlegte er, dann erklärte er ernst:
»Ja, so ist es ausgezeichnet.«
Sie war entzückt und wiederholte mehrmals:
»Duroy de Cantel, Duroy de Cantel, Madame Duroy de Cantel. Vortrefflich! Fabelhaft! Sie werden sehen, wie leicht sich alle Welt daran gewöhnt. Man muss die Gelegenheit ausnutzen, denn nachher würde es zu spät sein.
Von morgen ab zeichnen Sie Ihre Artikel D. de Cantel. Und die Lokalnachrichten lediglich mit Duroy. Das kommt in der Presse jeden Tag vor, und niemand wird sich wundern, dass Sie einen Schriftstellernamen annehmen. Sobald wir verheiratet sind, können wir das noch ein bisschen ändern und unseren Freunden sagen, Sie hätten aus Bescheidenheit das ›du‹ nicht hervorgehoben in Anbetracht Ihrer Stellung, oder wir brauchen auch gar nichts zu sagen. Wie heißt Ihr Vater mit Vornamen?«
»Alexander.«
Sie murmelte zwei-, dreimal hintereinander:
»Alexander, Alexander«, und lauschte auf den Wohlklang der Silben; dann schrieb sie auf ein leeres Blatt Papier:
»Herr und Frau Alexander Du Roy de Cantel beehren sich, die Hochzeit ihres Sohnes, Herrn Georges Du Roy de Cantel mit Frau Madeleine Forestier anzuzeigen.«
Sie hielt die Schrift etwas von sich ab und erklärte, entzückt über die Wirkung:
»Mit etwas Konsequenz erreicht man alles, was man will.«
Als er sich auf der Straße befand, war er fest entschlossen, sich in Zukunft nur noch Du Roy oder selbst Du Roy de Cantel zu nennen. Und er fühlte sich, als wäre ihm eine ganz neue Würde übertragen worden. Er ging forscher, trug den Kopf höher und den Schnurrbart stolz gewirbelt, wie es einem Edelmann geziemt. Er hatte die größte Lust, allen Vorübergehenden zuzurufen: »Ich heiße jetzt Du Roy de Cantel.«
Aber kaum war er in seiner Wohnung angelangt, da begann ihn der Gedanke an Madame de Marelle zu beunruhigen. Er schrieb ihr sofort und bat sie für morgen um eine Zusammenkunft. »Es wird eine schwere Stunde werden,« dachte er, »ich werde einen schrecklichen Sturm heraufbeschwören.«
In seiner gewohnten Sorglosigkeit, die ihn alle unangenehmen Dinge des Lebens einfach beiseite schieben ließ, wusste er sich sehr leicht zu trösten und begann einen fantastischen Artikel über die neuen Steuern zu schreiben, durch die das Budget gedeckt werden sollte.
Er forderte für die Adelsprädikate »de« (von) hundert Francs Jahressteuer, und für die Titel vom Baron bis zum Fürsten fünfhundert bis fünftausend Francs. Und er zeichnete mit: D. de Cantel.
Am folgenden Tage erhielt er von seiner Geliebten ein blaues Briefchen, das ihren Besuch um ein Uhr ankündigte.
Er erwartete sie in etwas fieberhaftem Zustande. Übrigens war er fest entschlossen, die Sache schnell und energisch zu erledigen, gleich alles herauszusagen und ihr dann nach der ersten Erregung mit allen möglichen Gründen zu beweisen, dass er nicht ewig Junggeselle bleiben könnte; und da Herr de Marelle durchaus nicht sterben wollte, so bliebe ihm eben nichts anderes übrig, als sich nach einer anderen rechtmäßigen Lebensgefährtin umzusehen. Trotzdem fühlte er sich innerlich erregt, und als die Klingel ertönte, begann sein Herz laut zu klopfen.
Sie warf sich ihm in die Arme:
»Guten Tag, Bel-Ami!« rief sie.
Doch sie merkte sofort, wie kühl er ihre Begrüßung erwiderte, blickte ihn an und fragte:
»Was hast du denn?«
»Setze dich,« sagte er, »wir müssen ernst miteinander reden.«
Sie setzte sich, ohne den Hut abzunehmen, lüftete nur ihren Schleier und sah ihn erwartungsvoll an.
Er hatte den Blick gesenkt und begann nun mit langsamer Stimme:
»Meine Liebste, du siehst, wie schmerzlich und peinlich mich das erregt, was ich dir jetzt sagen muss. Ich liebe dich sehr, ich liebe dich wirklich aus tiefstem Herzen, und der Gedanke, dir Schmerzen bereiten zu müssen, betrübt mich mehr als die Nachricht selbst, die ich dir mitteile.«
Sie wurde sehr bleich und stammelte zitternd:
»Was ist es? Sag’ es schnell.«
Er versetzte in traurigem, aber entschlossenem Tone mit jener geheuchelten Niedergeschlagenheit, mit der man angenehme Unglücksnachrichten zu erzählen pflegt:
»Ich will heiraten.«
Sie stieß einen Seufzer aus wie eine Frau, die ohnmächtig wird, einen schmerzerfüllten Seufzer, der aus der Tiefe ihrer Brust kam. Dann begann sie so stark zu schluchzen, dass sie kein Wort hervorbringen konnte.
Als er sah, dass sie nichts erwiderte, begann er von. neuem:
»Du kannst dir nicht vorstellen, was ich gelitten habe, ehe ich zu diesem Entschluss kam. Aber ich habe weder eine gesicherte Stellung noch Geld. Allein bin ich in Paris verloren. Ich muss jemanden neben mir haben, der mir raten, mich trösten und mich stützen kann. Ich suchte eine Gefährtin, eine Verbündete, und ich habe sie gefunden!«
Daraufhin schwieg er, in der Hoffnung, dass sie etwas antworten würde; er erwartete einen Wutanfall, heftige Beleidigungen und Schimpfworte.
Sie presste die eine Hand auf ihr Herz, als müsste sie es halten; sie atmete mühsam und schluchzte ununterbrochen, sodass ihre Brust wogte und der Kopf zitterte.
Er ergriff ihre andere Hand, die auf der Lehne des Sessels lag, doch sie zog sie heftig zurück. Und wie gelähmt murmelte sie:
»Oh … Mein Gott! …«
Er kniete vor ihr nieder, wagte aber nicht, sie zu berühren. Ihr Schweigen erregte ihn mehr als ein Zornausbruch es vermocht hätte, und er stammelte:
»Clo, meine liebe, kleine Clo, du musst nur bedenken, in welcher Lage ich bin. Oh, wenn ich dich hätte heiraten können, welches Glück! Doch du bist ja verheiratet. Was konnte ich tun? Überlege es dir nur! Ich muss mir eine Stellung in der Gesellschaft schaffen, und das kann ich nicht, solange ich kein Heim habe… Es gab Tage, wo ich deinen Mann hätte töten können …«
Seine Stimme klang sanft verschleiert und verführerisch, als ob ihr Musik ins Ohr drang.
Er sah zwei große Tränen langsam in den starren Augen seiner Geliebten wachsen und dann über ihre Wangen rinnen, während sich schon wieder zwei neue zwischen den Augenlidern bildeten.
Er murmelte:
»Oh, weine nicht, Clo, weine nicht, ich bitte dich darum. Du zerreißt mir das Herz.«
Mit einer starken Anstrengung zwang sie sich zu einer stolzen und würdigen Haltung. Und mit einer zitternden Stimme, die die Frauen beim Schluchzen haben, fragte sie:
»Wer ist es?«
Er zauderte einen Augenblick; dann sah er ein, dass er es sagen müsste:
»Madeleine Forestier.«
Madame de Marelle erbebte am ganzen Leibe, dann blickte sie stumm vor sich hin; sie versank in ein tiefes Nachdenken, sodass sie anscheinend vergessen hatte, dass er ihr zu Füßen kniete.
Und in ihren Augen bildeten sich wieder große, durchsichtige Tränen, die langsam hinabrollten.
Sie stand auf. Duroy fühlte, dass sie gehen wollte, ohne ein Wort des Vorwurfs oder der Verzeihung, und das verletzte und demütigte ihn bis ins Tiefste seiner Seele. Er wollte sie zurückhalten und umschlang mit beiden Armen ihr Kleid. Er fühlte, wie ihre runden Schenkel sich unter dem Rock spannten, um ihm Widerstand zu leisten. Er flehte sie an:
»Ich beschwöre dich, geh nicht so fort!«
Da blickte sie ihn von oben bis unten an, mit dem feuchten, verzweifelten Blick, der so bezaubernd und so traurig war und der den ganzen Schmerz einer Frau verrät:
»Ich habe … ich habe nichts zu sagen,« stammelte sie, »… ich kann nichts tun … du … hast recht gehandelt … du … du hast gut gewählt … was du brauchst …«
Sie machte sich mit einer schnellen Bewegung nach rückwärts von ihm los und ging fort, ohne dass er noch versucht hätte, sie zurückzuhalten.
Als er allein war, stand er auf, betäubt, als hätte er einen Schlag auf den Kopf erhalten. Dann nahm er sich zusammen und murmelte:
»Na, so oder so, es ist erledigt … wenigstens ohne Szene. Das ist mir ganz recht.«
Und plötzlich fühlte er sich wie von einer schweren Last befreit; das neue Leben konnte beginnen. Auf einmal begann er mit der Faust gegen die Wand zu schlagen, mit heftigen Schlägen, berauscht von Kraft und Erfolg, als kämpfe er mit dem Schicksal.
Als Madame Forestier ihn fragte:
»Haben Sie Madame de Marelle benachrichtigt?« — antwortete er ruhig:
»Ja, gewiss.«
Sie beobachtete ihn mit ihrem klaren, klugen Blick und fragte:
»War sie sehr erregt darüber?«
»Aber nein, nicht die Spur; sie fand es im Gegenteil sehr gut.«
Die Kunde verbreitete sich rasch. Die einen waren erstaunt, die anderen behaupteten, sie hätten es vorausgesehen, andere lächelten und ließen durchblicken, es hätte sie keineswegs überrascht.
Der junge Mann zeichnete jetzt die Feuilletons mit D. de Cantel, die Lokalberichte mit Duroy und die politischen Artikel, die er von Zeit zu Zeit für das Blatt schrieb, mit du Roy. Er verbrachte den halben Tag bei seiner Verlobten, die ihn mit brüderlicher Vertrautheit behandelte, in die sich jedoch eine wirkliche, wenn auch zurückhaltende Vertraulichkeit mischte, eine Art Verlangen, das verborgen blieb, aus Furcht, für eine Schwäche gehalten zu werden.
Sie hatten beschlossen, dass die Hochzeit in aller Stille stattfinden sollte, nur in Gegenwart der Trauzeugen, und dass sie noch am selben Abend nach Rouen abreisen wollten. Am nächsten Tage wollten sie die alten Eltern des Journalisten besuchen und ein paar Tage bei ihnen bleiben.
Duroy versuchte, sie von diesem Vorhaben abzubringen, aber es gelang ihm nicht, und so fügte er sich schließlich.
Der 10. Mai war gekommen. Das junge Paar begab sich zum Standesamt, und da sie die kirchliche Trauung für überflüssig hielten und keinen Menschen eingeladen hatten, kehrten sie nach Hause zurück, um ihre Koffer zu schließen. Mit dem Zuge um sechs Uhr abends fuhren sie vom Bahnhof Saint-Lazare nach der Normandie.
Bis zu dem Augenblick, wo sie allein im Eisenbahnzuge waren, hatten sie keine zwanzig Worte miteinander gewechselt. Sobald sie merkten, dass der Zug sich in Bewegung setzte, sahen sie sich an und begannen zu lächeln, um eine gewisse Verlegenheit zu verbergen, von der sie nichts merken lassen wollten.
Der Zug fuhr langsam durch den langen Bahnhof von Batignolles, dann durcheilte er die hässliche, flache Strecke zwischen den Forts und der Seine.
Duroy und seine Frau sprachen zuweilen ein paar unnütze Worte und wandten sich dann wieder dem Fenster zu; als sie über die Brücke bei Asnières kamen, stimmte sie der Anblick des Flusses, der von Booten, Anglern und Ruderern wimmelte, heiter und fröhlich. Die kräftige Maisonne warf ihre schrägen Abendstrahlen auf die Boote und den ruhigen Fluss, der unter der Glut der sinkenden Sonne unbeweglich wie eine Glasfläche erschien. Eine Segeljacht mitten auf dem Wasserspiegel hatte ihre zwei großen, weißen Leinewanddreiecke ausgespannt, um auch den leisesten Windhauch aufzufangen, und glich so einem riesigen Vogel, der gerade im Begriff war, aufzuflattern.
»Ich schwärme für die Umgebung von Paris«, murmelte Duroy. »So herrlich geröstete Fische wie hier habe ich in meinem Leben nie gegessen.«
»Und das Bootfahren«, erwiderte sie. »Wie schön ist es, bei Sonnenuntergang über das Wasser zu gleiten.«
Dann schwiegen sie, als ob sie nicht gewagt hätten, noch mehr von ihrem vergangenen Leben auszuplaudern; sie blieben stumm und kosteten vielleicht schon die Poesie des Zurücksehnens.
Duroy saß seiner Frau gegenüber. Er ergriff ihre Hand und küsste sie langsam und bedächtig.
»Wenn wir zurück sind, wollen wir öfters bei Chatou essen.«
»Wir werden so viel zu tun haben,« meinte sie in einem Ton, als wollte sie sagen: »Man muss das Angenehme dem Nützlichen opfern.«
Er hielt noch immer ihre Hand und überlegte unruhig, auf welchem Wege er zu Zärtlichkeiten übergehen konnte. Vor der Unwissenheit eines jungen Mädchens wäre er dabei weniger in Verlegenheit gewesen, aber die raffinierte Erfahrung und der schnelle Verstand, den er bei Madeleine voraussetzte, machte seine Haltung schüchtern und unsicher. Er fürchtete, in ihren Augen linkisch und albern zu erscheinen, zu ängstlich oder zu brutal, zu langsam oder zu hastig vorzugehen. Er drückte leise ihre Hand, ohne dass sie den Druck erwiderte.
»Es kommt mir sehr komisch vor,« sagte er, »dass Sie meine Frau sind.«
»Warum?« fragte sie überrascht.
»Ich weiß nicht. Ich habe ein seltsames Gefühl; ich möchte Sie küssen und wundere mich, dass ich ein Recht dazu habe.«
Sie hielt ihm ruhig die Wange hin, und er küsste sie, wie er eine Schwester geküsst hätte.
Er führ fort:
»Das erste Mal, wo ich Sie sah, erinnern Sie sich, es war bei dem Diner, zu welchem mich Forestier eingeladen hatte, da dachte ich mir: ›Herrgott, wenn ich nur so eine Frau finden könnte!‹ Nun ist es geschehen, ich habe sie.«
»Es ist reizend«, murmelte sie und sah ihn dabei mit ihren stets lächelnden Augen an.
Er dachte: »Ich bin zu kalt. Ich bin blöd, ich muss energischer aufs Ziel gehen.« Und er fragte:
»Wie haben Sie Forestier eigentlich kennengelernt?«
Sie antwortete herausfordernd und boshaft:
»Reisen wir denn nach Rouen, um uns von ihm zu unterhalten?«
Er wurde rot.
»Ich bin zu dumm. Aber Sie machen mich verlegen und schüchtern.«
Sie war entzückt:
»Ich? Nicht möglich! Aber weshalb denn?«
Er setzte sich ganz dicht neben sie. Da rief sie:
»Ach, ein Hirsch!«
Der Zug fuhr durch den Wald von St. Germain, und ein erschreckter Rehbock sprang über eine Lichtung. Duroy hatte sich über sie gebeugt; während sie durch das offene Fenster hinausblickte, drückte er ihr einen langen Liebeskuss auf den Nacken.
Einige Augenblicke saß sie unbeweglich, dann bog sie den Kopf zurück und sagte:
»Sie kitzeln mich, jetzt genug.«
Aber er ließ nicht los, sondern strich leise mit erregender und anhaltender Liebkosung seinen gekräuselten Schnurrbart über ihre weiße Haut.
Sie zuckte zusammen.
»Hören Sie doch nun endlich auf!«
Er schob seine rechte Hand um ihren Kopf, packte und drehte ihn zu sich. Dann warf er sich auf ihren Mund, wie ein Raubvogel auf seine Beute. Sie wehrte sich, stieß ihn zurück; endlich gelang es ihr, sich von ihm loszumachen.
»Lassen Sie es doch!« rief sie immer wieder.
Aber er hörte nicht zu, er presste sie in seine Arme, küsste sie mit bebenden, begierigen Lippen und versuchte, sie auf die Polsterbank zurückzuwerfen.
Sie riss sich mit aller Gewalt von ihm los und sprang heftig auf:
»Aber wirklich, Georges, lassen Sie das doch! Wir sind doch keine Kinder, dass wir nicht bis Rouen warten können.«
Mit rotem Kopf blieb er sitzen; diese vernünftigen Worte hatten ihn sehr ernüchtert; er nahm sich zusammen und sagte in heiterem Tone:
»Gut, ich werde warten, aber bis Rouen spreche ich keine zwanzig Worte mehr, und bedenken Sie, wir fahren eben erst an Poissy vorbei.«
»Dann werde ich reden«, sagte sie.
Und sie setzte sich ruhig wieder neben ihn hin.
Dann begann sie klar und deutlich darüber zu sprechen, was sie nach ihrer Rückkehr tun würden. Sie würden die Wohnung behalten, die sie mit ihrem ersten Gatten geteilt hatte; außerdem sollte Duroy die Stellung und das Gehalt Forestiers bei der Vie Française erben. Übrigens hatte sie alle finanziellen Einzelheiten des Haushalts mit der Sicherheit eines erfahrenen Geschäftsmannes noch vor der Eheschließung geregelt. Es sollte Gütertrennung herrschen, und es war für alle möglichen Fälle Vorsorge getroffen, für den Tod oder eine Scheidung, ebenso wie für die Geburt eines oder mehrerer Kinder. Der junge Mann brachte nach seiner Aussage viertausend Francs in die Ehe; von dieser Summe hatte er sich fünfzehnhundert ausgeliehen, den Rest hatte er sich während des letzten Jahres erspart. Die junge Frau brachte vierzigtausend Francs in die Ehe mit, die ihr, wie sie behauptete, Forestier hinterlassen hatte. Sie kam wieder auf ihn zu sprechen und stellte ihn als Vorbild hin: er war ein sehr sparsamer, sehr ordentlicher und fleißiger Mensch. Er hätte in kurzer Zeit ein Vermögen erworben.
Duroy hörte gar nicht hin, denn er war zu sehr mit anderen Gedanken beschäftigt.
Sie hielt bisweilen inne, um irgendwelchen geheimen Gedanken nachzusinnen und fuhr dann fort:
»In drei bis vier Jahren werden Sie wohl imstande sein, jährlich dreißigtausend bis vierzigtausend Francs zu verdienen. So viel hätte auch Charles verdienen können, wenn er am Leben geblieben, wäre.«
Georges begann die Lektion langweilig zu finden:
»Ich denke,« erwiderte er, »wir sind nicht nach Rouen gefahren, um davon zu reden.«
Sie gab ihm einen leichten Klaps auf die Backe und sagte lachend:
»Es ist wahr, ich war im Unrecht.«
Er hielt zum Scherz seine Hände auf den Knien, wie ein kleiner, artiger Junge.
»So sehen Sie recht kindisch aus!« sagte sie.
»Das ist meine Rolle,« antwortete er, »in die Sie mich eben zurechtgewiesen haben. Ich werde nicht mehr aus ihr herausfallen.«
»Wieso?« fragte sie.
»Weil Sie die Oberleitung über den ganzen Haushalt und auch über meine Person übernommen haben; Sie sind Witwe und es wird sich auch so gehören.«
»Was meinen Sie eigentlich damit?« fragte sie erstaunt.
»Dass Sie Erfahrung genug besitzen, um meine Unwissenheit wettzumachen, und eine Praxis in der Ehe, um mir meine Junggesellenunschuld abzugewöhnen. Das soll es heißen, ja!«
Sie lachte vor Vergnügen laut auf und rief:
»Das geht schon zu weit!«
»So liegt die Sache. Ich kenne die Frauen nicht … Und Sie kennen sicher die Männer, da Sie Witwe waren … Sie werden meine Erzieherin sein … heute Abend schon. Sie können, wenn Sie wollen, gleich schon damit anfangen!«
Heiter und lustig rief sie aus:
»Oh! Wenn Sie darauf rechnen …«
»Gewiss,« erwiderte er in dem Ton eines Schülers, der seine Schulaufgabe wiederholt, »darauf rechne ich. Ich rechne sogar darauf, dass Sie mir einen gründlichen Unterricht erteilen … in zwanzig Stunden … zehn für die Anfangsgrundlagen … Vorlesen und Grammatik … zehn für die Vervollkommnung und die Rhetorik, Ich weiß doch nichts.«
Sehr belustigt rief sie:
»Du bist zu dumm.«
»Da du mich endlich zu duzen anfängst, will ich deinem Beispiel folgen und dir sagen, mein Liebling, dass ich dich von Sekunde zu Sekunde mehr liebe und dass ich den Weg bis Rouen viel zu weit finde.«
Er sprach jetzt im Tone eines Schauspielers, mit komischem Mienenspiel und Gebärden; das machte der jungen Frau viel Spaß, denn sie war an die tollen Scherze der Schriftstellerboheme gewöhnt.
Sie sah ihn von der Seite an und fand ihn wirklich reizend. Sie hatte das Verlangen, ihm einen Kuss zu geben, als ob sie eine Frucht vom Baume essen wollte, während der Verstand ihr riet, die Mahlzeit abzuwarten. Dann sagte sie, errötend von den Gefühlen, die sie bestürmten:
»Mein kleiner Schüler, glauben Sie mir, glauben Sie meiner großen Erfahrung: Küsse im Eisenbahnwagen taugen nichts. Sie gehen auf den Magen.«
Dann wurde ihre Gesichtsfarbe noch röter und sie murmelte:
»Man muss die Früchte nie zu früh pflücken.«
Er grinste, erregt durch die Zweideutigkeiten, die diesem hübschen Mund entquollen; dann machte er das Zeichen des Kreuzes, indem er die Lippen bewegte, als ob er ein Gebet murmelte:
»Ich habe mich unter den Schutz des heiligen Antonius gestellt,« erklärte er, »dem Schutzheiligen gegen die Versuchung; ich bin jetzt wie eine Bildsäule aus Bronze.«
Die Nacht kam heran und hüllte die weiten Felder, die sich rechts der Bahn ausdehnten, in ein durchsichtiges Dunkel, ähnlich einem leichten Florschleier. Der Zug fuhr an der Seine entlang, und das junge Paar blickte in den Fluss, dessen Oberfläche sich wie geschliffenes Metall, wie ein langes, glänzendes Band neben den Schienen hinzog. Rote Reflexe spiegelten sich fleckenweise vom Himmel ab, den die untergehende Sonne mit Purpur und Feuer bedeckte. Auch diese leuchtenden Stellen erloschen und wurden allmählich dunkel und düster. Die Felder wurden schwarz, und darüber schwebte jener unheimliche Todesschauer, den jede Dämmerung auf die Erde bringt.
Die melancholische Abendstimmung drang auch durch das offene Fenster in die Seelen des noch eben so heiteren, jungen Paares und ließ sie verstummen. Sie waren näher aneinander gerückt, um den Todeskampf dieses schönen, hellen Maitages anzusehen.
In Mantes wurde eine kleine Öllampe angezündet, die auf den grauen Stoffbezug der Sitzpolster ihr gelbes, zitterndes Licht warf.
Duroy legte einen Arm um die Taille seiner Frau und presste sie an sich. Sein heftiges Verlangen wurde immer verzehrender; es wurde zu einer tröstenden, zärtlichen Liebkosung, zu einer Liebkosung, mit der man Kinder einwiegt.
Ganz leise flüsterte er:
»Ich werde dich sehr liebhaben, meine kleine Made.«
Der zarte Klang der Stimme erregte plötzlich die junge Frau und ein leises Zittern lief über ihre Haut. Sie bot ihm ihre Lippen, indem sie sich über ihn neigte, denn er hatte die Wange auf ihren warmen Busen gelegt.
Es war ein langer, tiefer und stummer Kuss. Dann sprang er auf und riss sie rasch und wild an sich. Es folgte ein keuchendes Ringen und eine heftige und ungeschickte Umarmung. Dann blieben sie Arm in Arm liegen, beide ein wenig enttäuscht, müde und immer noch zärtlich, bis das Pfeifen des Zuges die Nähe des Bahnhofs ankündigte.
Sie glättete mit den Fingerspitzen die zerzausten Haare an den Schläfen und erklärte:
»Es war recht töricht; wir sind wie die kleinen Kinder.«
Aber er küsste ihr hastig und fieberhaft die beiden Hände, eine nach der anderen und erklärte:
»Ich liebe dich über alles, meine kleine Made.«
Bis Rouen saßen sie Wange an Wange gelehnt, fast unbeweglich, und blickten durch das Fenster in die Nacht hinaus, und sahen hin und wieder die Lichter einzelner Häuser vorüberfliegen.
Sie waren zufrieden, so nahe beieinander zu sein und träumten von der inneren Annäherung und Vereinigung, die sie erwarteten.
Sie stiegen in einem Hotel ab, dessen Fenster nach dem Ufer hinausgingen. Nachdem sie abends ein wenig gegessen hatten, gingen sie zur Ruhe.
Das Zimmermädchen weckte sie am nächsten Morgen um acht Uhr und stellte zwei Tassen Tee auf den Nachttisch.
Duroy sah seine Frau an und schloss sie in seine Arme mit stürmischer Freude eines Mannes, der einen kostbaren Schatz gefunden hat, und leise flüsterte er ihr ins Ohr:
»Meine kleine Made, ich fühle, dass ich dich sehr, sehr, sehr liebe!«
Sie lächelte ihm zufrieden und vertrauensvoll zu, erwiderte seine Küsse und murmelte:
»Ich dich auch … vielleicht …«
Der bevorstehende Besuch bei seinen Eltern beunruhigte Duroy. Er hatte seine Frau schon oft gewarnt und auf alles vorbereitet. Jetzt fing er noch einmal an:
»Weißt du, es sind Bauern, richtige Bauern vom Lande, nicht von der komischen Oper.«
Sie lachte: »Ich weiß es doch, du hast mir oft genug das gesagt. Also steh auf, und lass mich auch aufstehen.«
Er sprang aus dem Bett, zog seine Strümpfe an und sagte:
»Wir werden es sehr unbequem haben. In meinem Zimmer steht nur ein Bett mit einem Strohsack. In Canteleu kennt man keine Rosshaarmatratzen.«
Sie schien entzückt zu sein.
»Umso besser. Es wird so herrlich sein, mal schlecht neben … neben dir zu schlafen… und mit dem Hahnenschrei aufzuwachen.«
Sie hatte einen Morgenrock aus weißem Flanell angezogen, den Duroy sofort erkannte. Dieser Anblick war ihm unangenehm. Warum? Er wusste, dass seine Frau ein volles Dutzend solcher Morgenkleider hatte. Sie konnte freilich nicht ihre Aussteuer vernichten, um sich eine neue zu kaufen. Wie es auch sei, es wäre ihm lieber gewesen, dass ihre Wäsche, ihre Nacht- und Leibwäsche nicht die gleiche wäre wie bei dem anderen. Ihm schien, als ob der weiche, warme Stoff etwas von Forestiers Berührung bewahrt haben müsste.
Er ging ans Fenster und steckte sich eine Zigarette an. Der Anblick des Hafens und des breiten Stromes mit seinen Schiffen und ihren schlanken Masten, mit seinen plumpen Dampfern, deren Ladung von Dampfkränen mit lautem Lärm auf die Kais ausgeladen wurde, — das alles packte ihn, obwohl er es schon lange kannte. Und er rief:
»O Gott, ist das schön!«
Madeleine kam herbei, legte ihre beiden Hände auf seine Schultern, beugte sich in hingebender Haltung zu ihm herab. Sie war gleichfalls hingerissen und entzückt:
»Oh! Das ist herrlich! Oh, wie herrlich! Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Schiffe gibt.«
Eine Stunde später fuhren sie ab; sie wollten bei den Alten zum Frühstück sein, denn sie hatten sie mehrere Tage vorher benachrichtigt.
Eine offene, alte Droschke fuhr sie langsam mit furchtbarem Gerassel zuerst eine ziemlich langweilige Allee entlang, dann fuhren sie über eine Wiese, die ein Fluss durchströmte und stiegen endlich langsam ein hügliges Gelände hinauf.
Madeleine war müde und erhitzt von der frischen Landluft und der wundervollen Frühlingssonne, und schlief in einer Ecke des alten Wagens ein.
Ihr Gatte weckte sie:
»Sieh dir das an!« sagte er.
Sie hatten etwa zwei Drittel der Steigung überwunden und machten an einem berühmten Aussichtspunkt halt, wohin alle Fremden geführt wurden. Man übersah von hier das weite Tal, das der breite Fluss in vielen Windungen durchströmte. Man sah ihn in der Ferne mit seinen vielen Inseln, bis er kurz vor Rouen einen weiten Bogen machte. Weiterhin ragte die Stadt am rechten Ufer etwas verschwommen im Morgennebel, in der Ferne blitzten die Sonnenflecke auf den Dächern und den tausend feinen gotischen Kirchentürmchen, überragt von der hässlichen, seltsamen und unproportionierten Bronzespitze der Kathedrale.
Auf der anderen Flussseite ragten rund und oben ausgebaucht die noch zahlreicheren, dünnen Fabrikschornsteine der großen Vorstadt Saint-Sevère und spien aus den Ziegelsäulen ihren schwarzen Kohlenqualm in den blauen Himmel hinauf.
Der Kutscher wartete geduldig, bis seine Fahrgäste sich hinreichend entzückt hatten. Aus seiner langjährigen Erfahrung wusste er ziemlich genau die Dauer der Bewunderung bei Reisenden jedes Schlages.
Als der Wagen sich wieder in Bewegung setzte, bemerkte plötzlich Duroy ein paar hundert Schritt von ihm entfernt zwei alte Leute, die ihnen entgegenkamen; er sprang aus dem Wagen und rief:
»Da sind sie; ich erkenne sie.«
Es waren zwei Bauern, ein Mann und eine Frau, die mit unregelmäßigen Schritten daherkamen und sich dann und wann mit den Schultern anstießen. Der Mann war klein, rot und untersetzt, mit etwas dickem Bauch, aber kräftig trotz seines hohen Alters. Die Frau war groß, mager, dürr, etwas gekrümmt und sah mürrisch und vergrämt aus, wie eine richtige Feldarbeiterin, die von Kindheit auf nur Mühe und schwere Arbeit gekannt und nie gelacht hatte, während der Mann mit seinen Genossen trank und schwatzte.
Madeleine war gleichfalls ausgestiegen und betrachtete die beiden armen Leutchen mit bedrücktem Herzen und einer Schwermut, auf die sie nicht vorbereitet war.
Zuerst erkannten sie ihren Sohn, diesen schönen, eleganten Herrn nicht, und nie hätten sie geahnt, dass diese schöne Dame im hellen Kleid ihre Schwiegertochter sei.
Schweigend und hastig gingen sie ihrem erwarteten Kind entgegen, ohne auf die Stadtmenschen, hinter denen ein Wagen fuhr, achtzugeben. Sie gingen vorüber. Da rief Georges Duroy lachend:
»Guten Tag, Papa Duroy!«
Sie blieben beide stehen, zuerst verblüfft, dann ganz blöde vor Überraschung. Die Alte fasste sich zuerst und stammelte, ohne sich zu rühren:
»Das bist du, unser Sohn?«
Der junge Mann antwortete:
»Aber natürlich bin ich das, Mutter Duroy.«
Und er ging auf sie zu und gab ihr auf beide Backen einen herzlichen Sohneskuss. Dann drückte er seine Schläfen gegen die des Vaters, der seine Mütze abgenommen hatte, eine seidene, sehr hohe Kappe, wie die Viehhändler in Rouen sie zu tragen pflegen.
Dann stellte Duroy vor:
»Das ist meine Frau.«
Und die beiden Bauersleute starrten Madeleine wie ein Wunder mit einer verborgenen Furcht an. Der Vater schien ziemlich befriedigt, während in den Augen der Mutter eine feindselige Eifersucht funkelte.
Der Mann war von Natur lustig und fröhlich und durch den Genuss des süßen Apfelweines und Alkohols wurde sein Frohsinn noch gesteigert. Er wurde kecker und fragte mit listigem Augenzwinkern:
»Darf ich ihr wohl auch einen Kuss geben?«
»Aber natürlich!« antwortete der Sohn; und Madeleine, der es unbehaglich wurde, reichte beide Wangen den schallenden Küssen des Bauern, der daraufhin sich seine Lippen mit der Rückseite seiner Hand abwischte. Auch die Alte küsste ihre Schwiegertochter, doch mit feindseliger Zurückhaltung. Nein! das war nicht die Schwiegertochter, von der sie träumte, die dicke, frische Pächterstochter, rot wie ein Apfel und rund wie eine Zuchtstute. Die Dame da sah nicht recht geheuer aus mit ihrem Putz und ihrem Moschusgeruch. Für die Alte gab es nur ein Parfüm, und das war Moschus.
Man ging nun weiter und folgte der Droschke, auf der das Gepäck des jungen Paares stand.
Der Alte nahm den Sohn beim Arm, zog ihn etwas zurück und fragte neugierig:
»Nun, und wie gehen die Geschäfte?«
»Gut, sehr gut!«
»Nu’, das genügt. Umso besser. Sag’ mal, und deine Frau, hat sie Geld?«
»Vierzigtausend Francs!«
Der Vater stieß vor Überraschung und Bewunderung einen leisen Pfiff aus und brachte nichts weiter hervor als: »Donnerwetter!«, so starr war er über die Summe. Dann setzte er mit ernster und ehrlicher Überzeugung hinzu:
»Wahrhaftig, es ist eine schöne Frau!«
Er fand sie nach seinem Geschmack, und seinerzeit hatte er für einen Kenner gegolten.
Madeleine und die Mutter gingen nebeneinander, ohne ein Wort zu sprechen. Die beiden Männer holten sie ein.
Das kleine Dorf, wohin sie nun gelangten, zog sich längs der Straße hin, etwa zehn Häuser auf jeder Seite, teils aus Ziegeln, teils aus Lehm gebaut, die einen mit Stroh, die anderen mit Schiefer gedeckt. Links, am Dorfeingang befand sich das Wirtshaus des alten Duroy »Zur schönen Aussicht«, eine kleine Hütte, die aus einem Erdgeschoss und einigen Bodenkammern bestand. Über der Tür war ein Kiefernzweig angebracht, er zeigte nach altem Brauch, dass durstige Leute eintreten können.
Der Tisch war in der Wirtsstube gedeckt oder vielmehr waren zwei Tische nebeneinander geschoben und mit einer Serviette bedeckt. Eine Nachbarin, die zur Aushilfe gekommen war, grüßte mit tiefer Verbeugung, als sie eine so schöne Dame eintreten sah, dann erkannte sie Georges und rief:
»Herr Jesus! Bist du es, Kleiner?«
Er antwortete fröhlich:
»Aber gewiss bin ich es, Mutter Brulin!«
Und er umarmte sie, wie er vorher seine Eltern umarmt hatte.
Dann wandte er sich zu seiner Frau:
»Komm in unser Zimmer, da kannst du deinen Hut ablegen.«
Er führte sie rechts durch eine Tür in ein kaltes, viereckiges Zimmer mit kalkgeweißten Wänden, in dem ein Bett mit baumwollenen Vorhängen stand; über einem Weihwasserbecken hing ein Kruzifix; zwei kolorierte Bilder, die Paul und Virginie unter einem blauen Palmenbaum und Napoleon I. auf einem gelben Pferd darstellten, bildeten den einzigen Schmuck dieses sauberen, öden Zimmers. Sobald sie allein waren, küsste er Madeleine:
»Guten Tag, Made; ich freue mich wirklich, die Alten wiederzusehen. In Paris denkt man nicht an sie, und wenn man wieder beisammen ist, macht das einem doch Freude.«
Aber der Vater rief, indem er mit der Faust an die Tür schlug:
»Kommt! Vorwärts! Die Suppe ist fertig!«
Sie mussten zu Tisch gehen.
Es war eine lange, schlecht zusammengestellte Bauernmahlzeit: eine Wurst nach der Hammelkeule und ein Eierkuchen nach der Wurst. Vater Duroy war durch den Apfelwein und ein paar Gläser Schnaps angeheitert, und packte seine alten Geschichten und Lieblingsscherze aus, die er für besonders festliche Gelegenheiten aufbewahrte, allerlei schlüpfrige, unsaubere Abenteuer, die angeblich seinen Freunden begegnet waren. Georges, der sie alle kannte, grinste trotzdem, denn die Luft der Heimat und die angeborene Liebe zum Lande und zu den vertrauten Winkeln seiner Kindheit, berauschten ihn ebenso wie all die Erinnerungen, die wieder in ihm lebendig wurden, all diese Kleinigkeiten, die er wieder sah: ein Messerschnitt in der Tür, ein lahmer Stuhl, der ihn an eine jugendliche Untat erinnerte, der Erdgeruch und der kräftige Harzduft, der aus dem nahen Walde kam und selbst der Geruch des Hauses, des Baches und des Düngerhaufens.
Die Mutter Duroy sprach gar nicht; sie blieb immer traurig und ernst. Hasserfüllt beobachtete sie ihre Schwiegertochter. Es war der Hass der alten Arbeiterin und Bäuerin mit verbrauchten Fingern und durch schwere Mühen entstellten Gliedern gegen die Städterin, die ihr Widerwillen einflößte, wie eine Verdammte, Verworfene, ein unreines Wesen, das nur für Sünde und Müßiggang geschaffen sei. Alle Augenblicke stand sie auf, um das Essen hereinzutragen und die Gläser zu füllen mit dem gelben herben Trank aus der Karaffe oder mit dem roten, schäumenden Apfelwein, bei dem der Pfropfen knallend aus der Flasche sprang wie bei einer moussierenden Limonade.
Madeleine aß wenig und sprach auch kaum, sie blieb traurig sitzen mit ihrem gewöhnlichen Lächeln, zu dem sie ihre Lippen zwang. Sie war enttäuscht und tief traurig. Warum? Gerade sie hatte ja kommen wollen; und sie wusste schon im Voraus ganz genau, dass es richtige kleine, arme Bauern waren. Wie hatte sie sich wohl diese Schwiegereltern geträumt, sie, die sonst nie träumte.
Wusste sie denn das? Kam es daher, weil Frauen immer etwas anderes erwarten, als was nachher kommt? Hatte sie sich diese Bauern aus der Entfernung poetischer vorgestellt? Nein, aber vielleicht edler, literarischer, zärtlicher, dekorativer. Sie hatte sie sich doch gar nicht edelmütig gewünscht wie in den Romanen? Woher kam es also, dass sie sich durch die unzähligen, kaum sichtbaren Kleinigkeiten, durch die vielen ungreifbaren Grobheiten und Plumpheiten abgestoßen fühlte? Oder lag es an ihrem bäurischen Wesen, an ihren Worten, ihren Gebärden, und an ihrem Lachen?
Sie dachte an ihre eigene Mutter, von der sie nie zu jemand sprach. Es war eine verführte Erzieherin aus Saint-Denis, die in Kummer und Elend gestorben war, als Madeleine zwölf Jahre zählte. Ein Unbekannter hatte das Mädchen erziehen lassen, zweifellos ihr Vater. Wer war er? Sie wusste es nicht genau, obgleich sie bestimmte Vermutungen hegte.
Das Frühstück nahm kein Ende. Jetzt kamen Gäste, die dem alten Duroy die Hand schüttelten und in staunende Ausrufe ausbrachen, als sie den Sohn erblickten; sie betrachteten die junge Frau von der Seite, zwinkerten listig mit den Augen, womit sie sagen wollten:
»Donnerwetter! Das ist ein frisches Weibchen, die Frau von Georges Duroy.«
Die anderen, die weniger Befreundeten, setzten sich an die Holztische und riefen: »Einen Liter! — Einen Schoppen! — Zwei Schnäpse! — Einen Bittern!« Dann begannen sie Domino zu spielen, indem sie laut klappernd mit den schwarzweißen Knochensteinen auf den Tisch schlugen.
Mutter Duroy ging immerfort hin und her, bediente die Kunden, nahm das Geld von ihnen und wischte mit ihrem Jammerblick, den Tisch mit dem Zipfel ihrer blauen Schürze ab.
Der Rauch der Tonpfeifen und der billigen Zigarren erfüllte den Raum. Madeleine begann zu husten und fragte:
»Wollen wir nicht gehen? Ich kann es nicht mehr aushalten.«
Die Mahlzeit war noch nicht beendet, und der alte Duroy war unzufrieden. Da stand sie auf und setzte sich auf einen Stuhl vor der Tür auf der Straße und wartete, bis ihr Schwiegervater und Gatte ihre Schnäpse und Kaffee zu Ende getrunken hatten.
Georges kam gleich zu ihr heraus:
»Wollen wir etwas nach der Seine hinunter?« fragte er.
Sie nahm den Vorschlag mit Freuden an.
»Ach ja, gehen wir.«
Sie gingen den Berg hinunter, mieteten sich ein Boot in Croisset und verbrachten den Rest des Nachmittags an den Ufern einer Insel unter den Weiden. Sie wurden schläfrig von der milden Frühlingswärme und, gewiegt von den leichten Wellen des Flusses, schlummerten sie allmählich ein.
Als es dunkel wurde, stiegen sie wieder hinauf.
Das Abendessen beim Schein einer Kerze war für Madeleine noch peinlicher als das Mittagessen. Der Vater Duroy war halb betrunken und sprach nicht mehr, und die Mutter hatte ihren mürrischen Gesichtsausdruck nicht abgelegt.
Das spärliche Licht warf auf die grauen Mauern die Schatten der Köpfe mit riesigen Nasen und maßlosen Gebärden. Von Zeit zu Zeit, sobald jemand sich umdrehte und sein Gesicht der gelben, zitternden Flamme näherte und sein Profil darbot, sah man eine Riesenhand eine Gabel, die wie eine Heugabel aussah, zum Munde führen, der dem Maul eines Ungeheuers glich.
Sobald die Mahlzeit zu Ende war, zog Madeleine ihren Mann ins Freie hinaus, um nicht in der düsteren Stube bleiben zu müssen, wo es nach altem Tabaksqualm und verschüttetem Wein roch.
Als sie draußen waren, sagte er:
»Du langweilst dich schon.«
Sie wollte widersprechen, aber er unterbrach sie:
»Nein, ich habe es wohl bemerkt. Wenn du willst, fahren wir schon morgen wieder ab?«
»Ja, ich möchte gern«, flüsterte sie.
Sie schritten langsam vorwärts. Es war eine milde Nacht und in ihrem tiefen, liebkosenden Schatten glaubte man allerlei leichtes Geräusch zu hören, entweder eine Art Knistern oder ein leises Atmen. Sie waren jetzt in eine schmale Allee sehr hoher Bäume gelangt, rechts und links umgeben von undurchdringlichem Dickicht.
»Wo sind wir?« fragte sie.
»Im Wald« antwortete er.
»Ist er groß?«
»Sehr groß, einer der größten in Frankreich.«
Es roch nach Erde, nach Bäumen und Moos. Der frische und zugleich welke Duft des dichten Waldes, der von dem Saft der Knospen und den faulenden Blättern des Dickichts stammte, schien in dieser Allee so ruhig und unbeweglich zu schweben. Madeleine blickte empor und sah die Sterne zwischen den Wipfeln der Bäume; und obwohl kein leisester Luftzug die Baumzweige bewegte, fühlte sie doch um sich das unbestimmte Rauschen des Blättermeeres. Ein seltsamer Schauer flog über ihre Seele und lief dann über ihre Haut. Eine Angst beklemmte ihr Herz. Warum? Sie wusste es nicht, aber sie hatte das Gefühl, als wäre sie umringt von Gefahren und verloren. Sie fühlte sich verlassen, ganz allein auf dieser Welt unter der grünen Wölbung, die oben rauschte.
»Ich fürchte mich etwas«, murmelte sie. »Ich möchte zurück.«
»Gut, kehren wir um.«
»Und … morgen reisen wir wieder nach Paris?«
»Ja, morgen.«
»Morgen früh?«
»Auch schon morgen früh, wenn du willst.«
Sie kehrten zurück. Die beiden Alten hatten sich schon zu Bett begeben. Madeleine schlief schlecht. Sie erwachte fortwährend von den ungewohnten Geräuschen der Nacht, dem Schrei der Eule, dem Grunzen des Schweines, das in einem Stall hinter der Wand eingesperrt war, und dem Krähen des Hahnes, das schon um Mitternacht begann. Beim ersten Morgendämmern war sie schon auf und reisefertig.
Als Georges seinen Eltern mitteilte, dass er schon heute abreisen müsste, waren sie beide betroffen, dann aber begriffen sie, woher diese Absicht kam.
Der Vater fragte einfach:
»Werden wir dich bald wiedersehen?«
»Aber natürlich. Im Laufe des Sommers.«
»Na, dann umso besser.«
Die Alte brummte:
»Ich wünsche dir, dass du nicht zu bereuen brauchst, was du getan hast.«
Er schenkte ihnen zweihundert Francs, um ihren Ärger zu besänftigen, und als die Droschke, die ein Dorfjunge geholt hatte, um zehn Uhr erschien, umarmte das junge Paar die alten Leute und fuhr davon.
Als sie den Berg hinunterfuhren, sagte Duroy lachend:
»Siehst du, ich habe dich gewarnt. Ich hätte dich nicht mit Herrn und Frau Du Roy de Cantel, Vater und Mutter zusammenbringen müssen.«
Sie begann auch zu lachen und entgegnete:
»Ich freue mich jetzt sehr darüber; es sind brave Leute und ich beginne, sie gern zu haben. Ich will ihnen aus Paris kleine Geschenke schicken.«
Dann sprach sie leise vor sich hin: »Du Roy de Cantel … Du wirst sehen, kein Mensch wird sich über unsere Hochzeitsanzeige wundern. Wir wollen überall erzählen, wir hätten eine Woche auf dem Gut deiner Eltern verbracht.«
Sie neigte sich zu ihm hin und streifte mit einem Kuss das Ende seines Schnurrbartes:
»Guten Tag, Geo.«
»Guten Tag, Made«, erwiderte er und schlang seinen Arm um ihre Hüfte.
In der Ferne sahen sie tief unten im Tal den großen Fluss wie ein silbernes Band in der Morgensonne leuchten, und die Fabrikschornsteine, die ihre schwarzen Rauchwolken zum Himmel hinaufbliesen, und alle spitzen Türme, die über der Stadt emporragten.