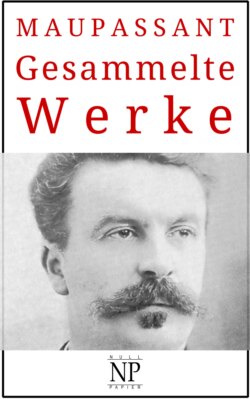Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 44
VII.
ОглавлениеSeit zwei Monaten war die Eroberung Marokkos vollzogen. Frankreichs Herrschaft dehnte sich von Tanger, das es besetzt hatte, über die ganze afrikanische Mittelmeerküste bis nach Tripolis, und es hatte die Schulden der annektierten Gebiete anerkannt und garantiert.
Man erzählte, dass zwei Minister dabei gegen zwanzig Millionen verdient hätten und man nannte ganz laut den Namen Laroche-Mathieus.
Was Vater Walter anging, so wusste ganz Paris, dass er ein doppelt vorteilhaftes Geschäft gemacht hatte. Er hatte sich dreißig bis vierzig Millionen an der Anleihe in die Tasche gesteckt und etwa 8 bis 10 Millionen an den Kupfer- und Erzbergwerken verdient, indem er unermessliche Ländereien noch vor der Eroberung für ein Spottgeld gekauft und gleich nach der französischen Okkupation an Kolonialgesellschaften wieder verkauft hatte.
Er war binnen weniger Tage zu einem der Herrscher der Welt geworden, einer jener allmächtigen Finanzmänner, die mächtiger sind als die Könige, vor denen sich die Köpfe verbeugen, vor denen die Zungen stammelnd reden, und vor denen alles zutage tritt, was an Gemeinheit, Feigheit und Niedertracht im tiefen Menschenherzen überhaupt verborgen ist.
Er war nicht mehr der Jude Walter, Direktor einer zweifelhaften kleinen Bank, der Herausgeber einer verdächtigen Zeitung, ein Abgeordneter, der sich mit schmutzigen Börsenmanövern abgab. Jetzt war er Herr Walter, der reiche Israelit. Das wollte er vor aller Welt zeigen.
Er erfuhr, dass der Prinz von Carlsbourg, der Besitzer des schönsten Schlosses im Faubourg-Saint-Honoré, mit einem Garten nach den Champs-Elysées, sich in Geldverlegenheit befand. Er schlug ihm vor, in vierundzwanzig Stunden dieses Grundstück nebst Gebäude abzukaufen, wobei er auch die gesamten Möbel übernehmen würde, ohne dass auch nur ein Sessel von seinem Platz gerührt werden dürfte. Er bot drei Millionen an. Der Prinz ließ sich durch die hohe Summe verleiten und nahm das Angebot an.
Am nächsten Tage zog Herr Walter in sein neues Palais ein.
Er hatte dann noch einen anderen Einfall; der Einfall eines Eroberers, der Paris einnehmen will nach der Art eines Bonapartes.
Die ganze Stadt ging damals zum Kunstgelehrten Jacques Lenoble, um ein Gemälde des ungarischen Malers Karl Markowitsch, »Jesus auf dem Meere schreitend«, zu besichtigen.
Die Kunstkritiker waren begeistert und erklärten dieses Bild für das großartigste und herrlichste Meisterwerk des Jahrhunderts.
Walter kaufte es für 500000 Francs und ließ es abholen; so schnitt er von heute auf morgen den Strom der Neugierde des Publikums und der Kunstliebhaber ab und zwang ganz Paris, von ihm zu sprechen, ihn zu beneiden, zu tadeln oder zu loben.
Dann ließ er durch die Zeitungen verkünden, er würde bekannte Mitglieder der Pariser Gesellschaft einladen, um das Meisterwerk des ausländischen Künstlers zu bewundern, damit man nicht sagen könne, er habe das Kunstwerk hinter Schloss und Riegel gesetzt.
Sein Haus sollte offen stehen, und jeder, der wollte, konnte kommen. Es genügte, an der Tür die Einladungskarte vorzuzeigen. Sie lautete so:
»Herr und Frau Walter beehren sich, Sie zum 30. Dezember, zwischen neun Uhr und Mitternacht, zur Besichtigung des Gemäldes von Karl Markowitsch, Jesus auf dem Wasser schreitend, bei elektrischer Beleuchtung, ergebenst einzuladen.«
Als Postskriptum stand dahinter in ganz kleinen Buchstaben: »Nach Mitternacht wird getanzt.«
Diejenigen, die bleiben wollten, konnten also bleiben, und aus diesen Gästen wollten sich Walters ihren Bekanntenkreis für die Zukunft auswählen.
Die anderen würden das Kunstwerk, das Haus und seine Eigentümer mit hochfeiner, gleichgültiger oder neidischer und unverschämter Neugierde betrachten und dann wieder gehen, wie sie gekommen waren. Und Papa Walter wusste ganz genau, dass sie später doch wiederkommen würden, genau so, wie sie mit seinen israelitischen Stammesgenossen verkehrten, die auch so wie er es zu Reichtum gebracht hatten.
Zunächst mussten alle gescheiterten Würdenträger und bekannte vornehme Namen, die in den Zeitungen genannt wurden, sein Haus besuchen; sie würden kommen, um das Gesicht des Mannes zu sehen, der binnen sechs Wochen fünfzig Millionen verdient hatte, sie würden ferner kommen, um diejenigen, die dort auch verkehrten, zu sehen und aufzuzählen, sie würden schließlich kommen, weil er so viel guten Geschmack und Gewandtheit gezeigt hatte, sie zur Bewunderung eines religiös-christlichen Gemäldes einzuladen — er, der doch ein Sohn Israels war. Er schien ihnen allen sagen zu wollen: »Sehen Sie, ich habe 500000 Francs für das Meisterwerk religiöser Kunst von Markowitsch, Jesus auf dem Meere schreitend, gezahlt. Und dieses Meisterwerk bleibt jetzt bei mir, vor meinen Augen, im Hause des Juden Walter.« In den vornehmen Gesellschaftskreisen, in den Kreisen der Herzoginnen und des Jockeiklubs, hatte man über diese Einladungen, die doch zu gar nichts verpflichteten, hin und her geredet. Man würde hingehen, wie man bei Herrn Petit die Aquarelle besichtigte. Walters besaßen ein Meisterwerk, und nun öffneten sie für einen Abend die Türen ihres Hauses, damit alle Welt es bewundern könnte. Besser und einfacher könnte es doch gar nicht sein.
Die Vie Française brachte seit vierzehn Tagen jeden Morgen eine Notiz über diese Soiree vom 30. Dezember und gab sich alle Mühe, die Neugierde des Publikums möglichst zu steigern.
Du Roy raste innerlich gegen den Triumph seines Herrn Direktors. Er hatte sich mit seinen 500000 Francs für unermesslich reich gehalten, die er seiner Frau abgepresst hatte, und nun kam er sich so arm, so bettelarm im Vergleich zu dem Millionenregen vor, der ringsumher niedergefallen war, ohne dass er davon etwas hatte auffangen können. Seine grimmige Wut und sein Neid nahmen täglich zu: er hasste alle Welt, die Walters, zu denen er jetzt überhaupt nicht mehr hinging, seine Frau, die sich von Laroche beschwatzen ließ und ihm abgeraten hatte, die marokkanische Anleihe zu kaufen, und vor allen Dingen grollte er gegen den Minister, der ihn hereingelegt und ausgenutzt hatte und noch zweimal die Woche bei ihm zu Tisch speiste. Georges diente ihm als Sekretär, als Agent, als eine lebende Feder, und wenn er nach seinem Diktat schrieb, empfand er oft eine wahnsinnige Lust, diesen triumphierenden, wichtigtuenden Gecken zu erdrosseln. Als Minister hatte Laroche einen sehr bescheidenen Erfolg, und um seine Stellung zu behalten, versuchte er, nicht durchblicken zu lassen, dass er nun ein steinreicher Mann geworden war. Doch Du Roy spürte dieses Gold an dem hochmütigen Tone des emporgekommenen Rechtsanwalts, an seinem frechen Auftreten, an seinen selbstsicheren Behauptungen und seinem unbeschreiblichen Selbstvertrauen. Laroche regierte jetzt im Hause Du Roys, wo er die Stelle des Grafen de Vaudrec eingenommen hatte sowie seine Besuchstage; und er sprach mit den Dienstboten, als ob er der zweite Hausherr wäre.
Georges duldete ihn zähneknirschend, wie ein Hund, der beißen will, es aber nicht wagt. Er war jetzt öfters hart und rücksichtslos gegen Madeleine, die mit den Achseln zuckte und ihn als ein unartiges Kind behandelte.
Übrigens wunderte sie sich über seine andauernde schlechte Laune und sagte oft: »Ich verstehe dich nicht. Du musst dich stets über etwas beklagen, dabei hast du eine geradezu großartige Stellung.« Er drehte ihr den Rücken zu und erwiderte gar nichts.
Er hatte zunächst erklärt, er ginge nicht zum Fest beim Chef; er denke nicht daran, mit diesem schmutzigen Juden zu verkehren.
Seit zwei Monaten schrieb ihm Frau Walter täglich Briefe und bat ihn, zu ihr zu kommen oder ihr ein Rendezvous zu bestimmen, wo es ihm passte, um ihm, wie sie sagte, die 70000 Francs auszuhändigen, die sie für ihn gewonnen hatte.
Er antwortete überhaupt nicht und warf alle diese verzweifelten Briefe ins Feuer. Nicht etwa weil er auf seinen Gewinnanteil verzichtet hätte, sondern er wollte sie verrückt machen, sie auf die Knie zwingen, und sie spüren lassen, wie verächtlich er sie behandele. Sie war zu reich! Er wollte sich stolz zeigen!
Noch am Tage der Ausstellung des Bildes wollte Madeleine ihm vorstellen, wie unrecht er täte, nicht hinzugehen, aber er sagte bloß:
»Ach lass mich in Ruhe! Ich will zu Hause bleiben.«
Dann, nach dem Abendessen, erklärte er plötzlich:
»Es wird wohl trotzdem besser sein, wenn wir uns dieser langweiligen Pflicht unterziehen. Ziehe dich schnell an.«
Sie war darauf gefasst.
»Ich bin in einer Viertelstunde fertig«, sagte sie.
Er kleidete sich brummend an, und noch in der Droschke fuhr er fort, seiner Galle freien Lauf zu lassen.
Die Hofeinfahrt zum Palais Carlsbourg war durch vier Bogenlampen, die wie vier kleine bläuliche Monde aussahen, von allen vier Ecken hell beleuchtet. Ein prachtvoller Teppich lag auf den Stufen der hohen Freitreppe und auf jeder Stufe stand, unbeweglich wie eine Bildsäule, ein Diener in Livree.
Du Roy brummte: »Diese Protzerei!« Er zuckte die Achseln, verzehrt von Neid und Eifersucht.
»Schweig doch und mach’ es ihnen nach«, sagte seine Frau leise.
Sie traten ein und ließen sich ihre schweren Abendmäntel von den Dienern abnehmen, die auf sie zutraten. Es waren dort auch mehrere Damen, die mit ihren Männern gekommen waren; sie legten ebenfalls ihre Pelze ab. Man hörte ringsumher flüstern: »Wie herrlich, wie wunderschön.«
Die gewaltige Vorhalle war mit Gobelins behängt, welche den Liebesmythus des Mars und der Venus darstellten. Rechts und links stiegen die beiden Teile der prunkhaften, monumentalen Treppe empor, die im ersten Stock zusammenliefen. Das eiserne Geländer war ein Meisterwerk der Schmiedekunst; seine alte verblasste Vergoldung warf einen zarten und sanften Schimmer auf die roten marmornen Treppenstufen.
Am Eingange zu den Salons standen zwei kleine Mädchen, die eine in Rosa, die andere in Blau gekleidet und überreichten den Damen Blumensträuße. Alle fanden das entzückend.
In den Sälen befanden sich schon eine ganze Menge Besucher.
Die meisten Frauen waren in Straßentoilette erschienen, um damit zu betonen, dass sie hierher nur so gekommen waren wie zu jeder anderen privaten Kunstausstellung. Diejenigen, die zum Ball bleiben wollten, trugen Gesellschaftstoiletten.
Frau Walter hielt sich, umgeben von Freundinnen, im zweiten Säle auf und begrüßte die Gäste. Viele, die sie überhaupt nicht kannten, gingen herum wie in einem Museum, ohne sich um die Gastgeber zu kümmern.
Als sie Du Roy erblickte, wurde sie leichenblass und machte eine unwillkürliche Bewegung, als wollte sie ihm entgegengehen. Dann blieb sie unbeweglich stehen und wartete. Er begrüßte sie höflich, während Madeleine sie mit zärtlichen Schmeicheleien überschüttete. Georges ließ seine Frau neben der Frau Direktor stehen und mischte sich unter die Menge, um sich boshafte Bemerkungen anzuhören, die hier sicherlich nicht fehlen dürften.
Fünf Salons folgten einer auf den anderen, sie waren mit kostbaren Stoffen tapeziert, mit alten italienischen Stickereien oder orientalischen Teppichen in allen Farben und Stilarten geschmückt; darüber hingen an den Wänden Gemälde alter berühmter Meister. Vor allem bewunderte man einen kleinen Salon im Stil Louis XVI., eine Art von Boudoir, das ganz mit hellblauer Seide mit ausgestickten Rosensträußen tapeziert war. Die Möbel aus vergoldetem Holz waren mit dem gleichen Stoff bezogen; die ganze Einrichtung war von einer wunderbaren Feinheit.
Georges erkannte in der Menge die Pariser Berühmtheiten, die Herzogin de Terracine, den Grafen und die Gräfin Ravenel, den General Prinz d’Andremont, die bildschöne Marquise des Dunes, und dann alle die Herren und Damen, die man gewöhnlich bei Premieren sieht.
Plötzlich fasste ihn jemand am Arm und eine junge und frohe Stimme flüsterte ihm ins Ohr:
»Ah, da sind Sie endlich, böser Bel-Ami. Warum lassen Sie sich denn gar nicht mehr sehen?«
Es war Suzanne Walter, die ihn mit ihren feinen Emailleaugen unter den krausen, blonden Locken ihres Haares ansah.
Er war entzückt, sie wieder zu sehen und drückte ihr offenherzig die Hand. Dann entschuldigte er sich.
»Ich konnte nicht. Ich habe so viel zu tun; seit zwei Monaten bin ich gar nicht ausgegangen.«
»Das ist gar nicht nett,« sagte sie ernsthaft, »sogar sehr, sehr hässlich, Sie haben uns viel Kummer bereitet, Mama und mir, denn wir lieben Sie beide sehr. Ich kann Sie überhaupt nicht mehr entbehren. Ich langweile mich zu Tode, wenn Sie nicht da sind. Sie sehen, ich sage Ihnen das ganz offen, damit Sie nicht mehr das recht haben, so von der Oberfläche zu verschwinden. Geben Sie mir Ihren Arm, ich will Ihnen selbst ›Jesus auf dem Meere schreitend‹ zeigen. Das Bild hängt drüben hinter dem Wintergarten. Papa hat extra diesen Platz gewählt, damit man durch alle Räume gehen muss. Es ist direkt erstaunlich, wie Papa mit diesem Hause renommiert.«
Sie gingen langsam durch die Menge. Man drehte sich um und blickte diesem schönen jungen Mann und dieser entzückenden Puppe nach.
Ein bekannter Maler meinte:
»Dieses Paar ist tatsächlich sehr hübsch und reizend.«
Georges dachte:
»Wenn ich wirklich stark wäre, müsste ich die heiraten. Es wäre doch möglich. Warum habe ich nie daran gedacht? Wie konnte ich nur die andere nehmen? Wie töricht! Man handelt immer zu schnell und denkt nie genügend nach.«
Und der Neid, der bittere Neid, fiel tropfenweise in sein Herz wie Galle, die ihm alle seine Freude verdarb und sein ganzes Leben verhasst machte.
Suzanne sagte:
»Oh, kommen Sie recht oft, Bel-Ami, wir können jetzt, wo Papa nun so reich ist, Streiche und Dummheiten unternehmen und uns wie toll amüsieren.«
Er folgte noch immer seinem Gedankengang und antwortete :
»Oh, Sie werden jetzt bald heiraten; Sie werden einen schönen, vielleicht etwas ruinierten Prinzen heiraten, und wir werden uns nicht mehr sehen.«
Sie rief offenherzig aus :
»O nein, noch nicht. Ich will jemanden, der mir gefällt, den ich sehr gern hätte, den ich sogar lieb hätte. Geld habe ich für beide genug.«
Er lächelte ironisch und hochmütig und begann die Namen der Vorübergebenden zu nennen, alles sehr vornehme Leute, die ihre verrosteten Adelsschilder an Töchter reicher Finanzleute so gern verkauft hatten, die nun mit ihren Frauen oder auch ohne sie lebten, jedenfalls frei, unverschämt und doch bekannt und geachtet.
Er fuhr fort:
»Es vergehen keine sechs Monate und Sie haben auf diesen Köder angebissen. Sie werden Marquise, Herzogin oder Fürstin, und Sie werden dann auf mich von oben herabblicken, mein liebes Fräulein.«
Entrüstet schlug sie ihm mit dem Fächer auf den Arm und schwor, sie würde nur aus Liebe heiraten.
Er grinste:
»Wir werden es sehen. Ich glaube, Sie sind zu reich.«
Sie sagte:
»Sie doch auch. Sie haben doch eine Erbschaft angetreten.«
Er stieß mitleidig ein »Oh« aus.
»Sprechen wir nicht davon, kaum 20000 im Jahr. Das ist nicht viel heutzutage.«
»Aber Ihre Frau hat auch geerbt?«
»Ja, es war eine Million für uns beide. 40000 Francs Einkommen. Wir können uns damit nicht mal eine Equipage leisten.«
Sie gelangten in den letzten Saal, vor ihnen tat sich ein großer Wintergarten auf, mit hochragenden, tropischen Bäumen und einer Menge seltener Blumen. Über dieses dunkle Grün glitt das Licht in silbernen Wogen und man atmete die laue Frische der feuchten Erde und die verschiedensten Wohlgerüche ein. Man hatte dabei ein seltsames, gesundes, aber angenehmes und bezauberndes Empfinden der künstlichen, reizvollen und entnervten Natur. Man schritt auf Teppichen, die weich wie das Moos waren, zwischen dichten Beeten mit Gebüschen und Blattpflanzen. Plötzlich erblickte Du Roy zur Linken unter einer weiten Wölbung von Palmen ein riesiges Marmorbassin, so groß, dass man darin baden konnte. Am Rande standen vier weiße Delfter Porzellanschwäne, aus deren halbgeöffneten Schnäbeln das Wasser in das Becken floss. Der Boden des Bassins war mit Goldsand bestreut, und man sah im Wasser ein paar große rote Fische schwimmen, seltsame chinesische Ungetüme mit hervorstehenden Augen, mit blau geränderten Schuppen, eine Art Mandarine der Fluten; sie schwammen über den goldenen Grund und sahen wie seltsame lebende Stickereien aus.
Der Journalist blieb stehen; sein Herz klopfte. Er dachte:
»Das ist ein Luxus! In solchen Häusern lohnt es zu leben. Anderen ist das gelungen, warum sollte ich es nicht so weit bringen können.«
Er sann über die Möglichkeit und über die Mittel nach, fand aber keine und ärgerte sich über seine Ohnmacht.
Seine Begleiterin sprach nicht mehr und blickte nachdenklich vor sich hin. Er betrachtete sie von der Seite und dachte noch einmal: »Es genügt doch, einfach diese lebende Puppe zu heiraten.« Doch Suzanne schien plötzlich aufzuwachen.
»Passen Sie auf«, sagte sie.
Sie stieß Georges durch eine Gruppe von Menschen, die ihnen im Wege standen und führte ihn plötzlich nach rechts.
Mitten in einem Gebüsch von seltsamen Pflanzen, deren zitternde Blätter gespreizten Händen mit langen, dünnen Fingern glichen, sah man einen Mann, der unbeweglich auf dem Meere stand.
Der Eindruck war überwältigend. Die Ränder des Bildes waren durch das bewegliche Grün verdeckt und so erschien es wie eine dunkle Öffnung, durch die man in der fantastischen märchenhaften Ferne eine ergreifende Gestalt sah.
Man musste das Gemälde sehr genau betrachten, um es zu verstehen. Der Rahmen durchschnitt gerade die Mitte des Kahnes, in dem die Apostel saßen. Sie waren nur schwach durch die schrägen Strahlen einer Laterne beleuchtet. Einer von ihnen, der am Rande des Kahnes saß, ließ das helle Licht auf Jesus fallen. Christus näherte sich und trat auf eine Woge; man sah, wie sie sich überschlug und ergeben und zärtlich glättete vor dem göttlichen Fuß, der sie niedertrat. Rings um den Gottessohn war alles dunkel. Nur die Sterne glänzten am Himmel.
Die Gesichter der Apostel waren unbestimmt beleuchtet durch ein Licht, das der eine in der Hand trug und auf den Heiland zeigte. Sie schienen vor Staunen erstarrt zu sein.
Das war wirklich das mächtige, unverhoffte Kunstwerk eines Meisters, eine jener Schöpfungen, die uns im Innersten ergreifen und uns jahrelang davon träumen lassen.
Die Menschen, die dieses Werk betrachteten, blieben zunächst stumm und unbeweglich stehen, dann gingen sie nachdenklich weiter und sprachen nachher nur vom Bild und der wundervollen Malerei.
Du Roy besah es sich eine Weile und erklärte:
»Es muss doch hübsch sein, sich solche Kostbarkeiten leisten zu können.«
Aber die Menge drängte sich um ihn und stieß ihn, um sehen zu können. — Er ging weiter, ohne die Hand Suzannes, die auf seinem Arm ruhte und die er leicht an sich presste, loszulassen.
Sie sagte:
»Nehmen Sie ein Glas Champagner, kommen Sie ans Büfett, wir werden dort sicher Papa treffen.«
Und sie schritten langsam durch alle Räume. Die Menge schwoll mehr und mehr an. Diese elegante, unbekümmerte, lärmende Menge, wie sie bei allen öffentlichen Festlichkeiten zu sehen ist.
Plötzlich glaubte Du Roy zu hören, wie eine Stimme sagte:
»Das ist Laroche und Madame Du Roy.«
Diese Worte streiften leise sein Ohr wie ein weit entferntes Geräusch. Woher kamen sie?
Er sah sich nach allen Seiten um und erblickte in der Tat seine Frau, die am Arm des Ministers vorbeiging. Sie plauderten ganz leise mit vertraulichem Lächeln und sahen sich in die Augen.
Er glaubte zu bemerken, dass man bei ihrem Anblick sich etwas zuflüsterte, er empfand das brutale und törichte Verlangen, auf die beiden loszustürzen und sie mit Fäusten niederzuschlagen.
Sie machte ihn lächerlich; er dachte an Forestier. Vielleicht sagt man schon: »Dieser betrogene Ehemann Du Roy.« Wer war sie denn eigentlich? Eine kleine Frau dunkler Herkunft, ziemlich geschickt emporgekommen, aber mit kleinen Mitteln und ohne besondere Begabung. Man besuchte ihn, weil man ihn und seinen Einfluss fürchtete, weil er stark war, aber man sprach sicher ungeniert über diese Journalistenehe. Mit dieser Frau könnte er es nie weit bringen, die sein Haus stets verdächtig erscheinen ließ, sie kompromittierte sich selbst und ihn, und man sah an ihrem Auftreten und Benehmen, dass sie eine Intrigantin war. Sie war jetzt ein Gewicht, das er am Fuße schleppte. Ach, wenn er geahnt hätte, wenn er es im Voraus gewusst: hätte! Dann würde er ein etwas kühneres und größeres Spiel gespielt haben! Oh, was er für eine schöne Partie gewinnen könnte, wenn er auf Suzanne gesetzt hätte! Wie konnte er so blind sein und dieses alles nicht gesehen haben?
Sie kamen jetzt in den Speisesaal. Es war eine riesige Halle mit Marmorwänden. An den Wänden hingen alte Gobelins.
Walter erblickte seinen Redakteur und stürzte auf ihn zu, um ihm die Hände zu drücken. Er war berauscht vor Freude:
»Haben Sie gesehen? … Sag’ mal, Suzanne, hast du ihm gezeigt? Welch eine Menge von Menschen, nicht wahr, Bel-Ami? Haben Sie den Prinz de Guerche gesehen? Er hat hier eben ein Glas Punsch getrunken.«
Dann wandte er sich zum Senator Rissolin, der seine stumpfsinnig aussehende Frau mit sich schleppte; sie war aufgeputzt wie eine Jahrmarktspuppe.
Ein Herr grüßte Suzanne, ein hochgewachsener, schlanker, junger Mann mit blondem Backenbart, etwas kahlköpfig und mit weltmännischen Manieren, wie man sie sofort erkennen kann. Georges hörte seinen Namen nennen: Marquis de Cazolles; und er fühlte plötzlich, wie er auf diesen Mann eifersüchtig wurde. Seit wann kannte sie ihn? Wahrscheinlich, seitdem sie so reich war? Er vermutete einen Nebenbuhler.
Da fasste ihn jemand am Arm. Es war Norbert de Varenne. Der alte Dichter wanderte mit seinem fettigen Haar in seinem alten Frack durch die großen Räume umher, mit einem gleichgültigen und müden Gesichtsausdruck.
»Das heißt sich amüsieren«, sagte er. »Nachher wird getanzt, dann geht man zu Bett, und die kleinen Mädchen werden zufrieden sein. Trinken Sie etwas Champagner, er ist ausgezeichnet.«
Er ließ sich ein Glas einschenken und trank Du Roy zu, der auch eins genommen hatte:
»Ich trinke auf den Endsieg des Geistes über die Millionen.«
Dann setzte er mit sanfter Stimme hinzu:
»Nicht etwa, dass ich sie den anderen nicht gönne; ich möchte sie selbst nicht einmal besitzen. Ich protestiere aus Prinzip.«
Georges hörte ihm nicht mehr zu. Er suchte Suzanne, die eben mit dem Marquis de Cazolles verschwunden war; er ließ Norbert de Varenne plötzlich allein stehen und machte sich an die Verfolgung des jungen Mädchens. Eine dichte Menge, die das Büfett umlagerte, hielt ihn auf. Als er sich durchgedrängt hatte, stieß er auf das Ehepaar de Marelle.
Er traf sich regelmäßig mit der Frau, aber den Mann hatte er seit längerer Zeit nicht gesehen. Er streckte ihm beide Hände entgegen und sagte:
»Ich muss Ihnen vielmals danken, mein Lieber, für den Ratschlag, den Sie mir durch Clotilde geben ließen. Ich habe durch die Marokkoanleihe gegen 100000 Francs verdient. Das verdanke ich Ihnen. Sie sind wirklich ein bezaubernder Freund.«
Die Männer, die herumstanden, drehten sich um und blickten der hübschen, eleganten Brünette nach.
»Als Gegenleistung«, erwiderte Du Roy, »müssen Sie mir Ihre Frau abtreten, oder vielmehr, ich biete ihr den Arm an. Eheleute muss man immer trennen.«
Herr de Marelle verbeugte sich:
»Sehr gut. Sollte ich Sie aus den Augen verlieren, so treffen wir uns hier nach einer Stunde.«
»Abgemacht.«
Die beiden jungen Leute mischten sich unter die Menge, und der Ehemann folgte ihnen.
»Die Walters haben doch Glück,« wiederholte Clotilde, »aber es gehört auch Tüchtigkeit und Geschäftssinn dazu.«
Georges antwortete: »Ach was, energische und starke Menschen erreichen immer ihr Ziel, so oder so.«
»Jede der beiden Töchter«, fuhr sie fort, »bekommt ihre 20 oder 30 Millionen Mitgift. Und Suzanne ist außerdem auch hübsch …«
Er sagte nichts. Es ärgerte ihn, seine eigenen Gedanken von einem anderen aussprechen zu hören.
Sie hatte das Gemälde noch nicht gesehen. Er schlug ihr vor, sie dort hinzuführen. Sie fanden Vergnügen daran, Bosheiten über die Leute zu sagen und sich über unbekannte Gesichter lustig zu machen. Saint-Potin kam an ihnen vorüber; sein Frack war dicht mit Orden besteckt, was sie sehr belustigte. Ihm folgte ein früherer Botschafter mit einer kleineren Ordensschnalle.
Du Roy erklärte:
»Was für eine buntgemischte Gesellschaft.«
Boisrenard, der ihm die Hand schüttelte, hatte auch sein Knopfloch mit dem grüngelben Bändchen geschmückt, das er auch an dem Duelltage getragen hatte. Die Vicomtesse de Percemur, ungeheuer auffallend gekleidet, unterhielt sich mit einem Herzog in dem kleinen Louis-XVI-Boudoir.
»Ein galantes tête-à-tête«, sagte Georges leise; als er durch den Wintergarten ging, sah er seine Frau mit Laroche-Mathieu hinter einem Palmenbusch halb versteckt sitzen. Sie schienen zu sagen: »Wir haben uns hier ein Rendezvous gegeben, ein öffentliches Rendezvous. Und pfeifen auf die Meinung der Gesellschaft.«
Madame de Marelle fand den »Jesus« von Markowitsch überraschend schön, und sie ging wieder zurück. Den Ehemann hatten sie verloren.
»Und Laurine,« fragte er, »ist sie mir immer noch böse?«
»Ja, immer noch. Sie will dich nicht mehr sehen und geht fort, wenn man von dir redet.«
Er antwortete nicht. Aber diese plötzliche Feindseligkeit des kleinen Mädchens bedrückte ihn und stimmte ihn traurig.
An einer Tür begegneten sie Suzanne; sie rief Georges zu:
»Ah, da sind Sie ja, Bel-Ami! Sie müssen jetzt allein bleiben, ich entführe Ihnen die schöne Clotilde, um ihr mein Zimmer zu zeigen.«
Und die zwei Damen gingen raschen Schrittes weiter. Sie glitten durch das dichte Menschengewühl und verschwanden in der Menge. Gleich darauf rief eine Stimme leise:
»Georges.«
Es war Frau Walter. Sie fuhr mit leiser Stimme fort:
»Oh! Wie grausam sind Sie! Warum quälen Sie mich so ohne Grund? Ich habe Suzette gebeten, Ihre Begleiterin zu entführen, damit ich Ihnen ein Wort sagen kann. Hören Sie mich an, ich muss … ich muss Sie heute Abend sprechen … oder … oder … Sie wissen gar nicht, was ich tun werde. Gehen Sie in den Wintergarten, links finden Sie eine Tür, und durch diese gelangen Sie in den Garten. Gehen Sie geradeaus, die Allee entlang, am Ende befindet sich eine Laube. Erwarten Sie mich da in zehn Minuten. Wenn Sie das nicht wollen, so schwöre ich Ihnen: ich mache hier sofort einen Skandal!«
Er antwortete hochmütig:
»Meinetwegen. Ich werde in zehn Minuten an dem verabredeten Ort sein.«
Dann trennten sie sich, doch Jacques Rival hielt ihn auf, sodass er beinahe zu spät gekommen wäre. Er nahm ihn beim Arm und erzählte ihm sehr aufgeregt eine Menge Geschichten. Er kam offenbar vom Büfett. Endlich ließ ihn Du Roy mit Herrn de Marelle, den er wieder getroffen hatte, stehen, und verschwand. Er musste noch aufpassen, dass er nicht von seiner Frau und Laroche gesehen würde. Dieses gelang ihm, denn die beiden schienen sehr animiert zu sein, und endlich war er im Garten.
Die kalte Luft durchschauerte ihn wie ein eiskaltes Bad.
»O Gott,« dachte er, »ich werde mich hier noch erkälten.«
Er legte sich sein Taschentuch wie eine Krawatte um den Hals und ging langsamen Schrittes die Allee entlang. Er sah schlecht nach der hellen Beleuchtung der Säle und konnte in der Dunkelheit kaum den Weg finden.
Rechts und links unterschied er allmählich das kahle Gebüsch, dessen Zweige von der Kälte zu zittern schienen. Ein grauer Lichtschimmer fiel aus den Fenstern des Schlosses auf den entlaubten Garten. Er sah vor sich, mitten auf dem Wege, etwas Weißes; Frau Walter stand da mit nacktem Halse und nackten Armen und stammelte mit bebender Stimme:
»Ach, da bist du endlich! Was willst du eigentlich? Willst du mich umbringen?«
Er erwiderte ruhig:
»Ich bitte dich, ohne Szenen, oder ich gehe sofort weg.«
Sie fiel ihm um den Hals und ihre Lippen berührten beinahe die seinen.
»Was habe ich dir denn getan, dass du dich mir gegenüber wie ein Ehrloser benimmst? Sag’, was habe ich dir getan?«
Er versuchte sie zurückzustoßen:
»Das letzte Mal, als wir zusammen waren, hast du deine Haare an meinen Knöpfen befestigt, es hat deshalb beinahe einen Bruch zwischen meiner Frau und mir gegeben.«
Sie war überrascht, dann schüttelte sie verneinend mit dem Kopf.
»Oh! Deine Frau macht sich nichts daraus, es war eine deiner Geliebten, die dir eine Szene gemacht hat.«
»Ich habe keine Geliebten.«
»Schweig! — Warum kommst du mich nicht mehr besuchen? Warum willst du nicht wenigstens einmal mit mir in der Woche essen? Es ist so entsetzlich, was ich darunter leide. Ich liebe dich; kann an nichts anderes denken, als an dich. Ich kann überhaupt nicht mehr sehen, ohne dich vor meinen Augen zu haben, ich wage kein Wort mehr auszusprechen, aus Furcht, ich könnte deinen Namen laut sagen. Du kannst das gar nicht begreifen! Ich habe das Gefühl, als hieltest du mich in deinen Krallen gefangen, als hätte man mich in einen Sack hineingenäht. Ich kann es dir gar nicht erklären. Der bohrende Gedanke an dich, der mich nie verlässt, würgt mich an der Kehle. Er zerreißt mir innen etwas, unter meiner Brust, er zerschlägt und lahmt mir die Beine, dass ich kaum gehen kann. Ich bleibe stumpfsinnig wie ein Tier den ganzen Tag auf dem Sessel liegen und denke an dich.«
Er sah sie erstaunt an. Es war nicht das dicke, halbverrückte Schulmädchen von vorhin, es war eine Frau, die kopflos und verzweifelt zu allem fähig war. Ein unbestimmter Plan entwickelte sich inzwischen in seinem Hirn. Er antwortete:
»Meine Verehrteste, die Liebe währt nicht ewig. Man umarmt sich und geht dann auseinander. Wenn es aber so lange dauert wie zwischen uns, dann wird sie zu einer schrecklichen Last. Und das will ich nicht. Das ist die Wahrheit. Doch, wenn du imstande bist, vernünftig zu sein und mich als Freund zu behandeln und zu empfangen, dann will ich gern wiederkommen. Fühlst du dich stark genug dazu?«
Sie legte ihre beiden nackten Arme auf Georges Frack und flüsterte:
»Ich bin zu allem fähig, wenn ich dich nur sehen darf.«
»Dann also abgemacht,« sagte er, »wir sind gute Freunde und weiter nichts.«
Sie stammelte:
»Gut, abgemacht.«
Dann hielt sie ihm ihre Lippen hin.
»Noch einen Kuss … den letzten.«
Er wies sie sanft zurück.
»Nein, wir müssen bei unserem Abkommen bleiben.«
Sie wandte sich ab und trocknete ihre Tränen. Dann zog sie aus dem Ausschnitt ihres Kleides ein Päckchen Papier, das mit einem rosa Seidenbändchen verschnürt war und reichte es Du Roy.
»Hier. Das ist dein Anteil am Verdienst an dem Marokkogeschäft. Ich war so glücklich, dass ich es für dich gewonnen hatte. Nimm es doch.
Er wollte es ablehnen.
»Nein, ich kann dieses Geld nicht annehmen.«
Sie protestierte:
»Ah, jetzt willst du das auch nicht mehr tun! Es ist dein Geld, es gehört nur dir. Wenn du es nicht nimmst, werfe ich es in irgendeinen Abfluss. Du wirst mir das nicht: antun, nicht wahr, Georges?«
Er nahm das kleine Paket und ließ es in seine Tasche verschwinden.
»Wir müssen zurück,« sagte er, »du holst dir sonst noch eine Lungenentzündung,«
»Umso besser!« murmelte sie. »Wenn ich nur sterben könnte!«
Sie ergriff seine Hand und küsste sie leidenschaftlich, rasend und verzweifelt. Dann stürzte sie ins Haus zurück.
Er folgte ihr langsam und nachdenklich. Dann trat er stolz und lächelnd in den Wintergarten ein.
Seine Frau und Laroche waren nicht mehr da. Sehr viel Gäste waren schon fort. Offenbar wollten die meisten nicht zum Ball bleiben. Er sah Suzanne, die Arm in Arm mit ihrer Schwester ging. Sie traten an ihn heran und baten ihn alle beide, die erste Quadrille mit dem Grafen de Latour-Yvelin zu tanzen. Er war überrascht.
»Wer ist denn das nun wieder?«
»Es ist ein neuer Freund meiner Schwester«, sagte Suzanne hinterlistig.
Rose wurde rot und murmelte:
»Du bist boshaft, Suzette, dieser Herr ist genau so mein Freund wie der deine.«
Die andere lächelte:
»Das wissen wir schon.«
Rose wurde wütend, wandte ihnen den Rücken und ging fort. Du Roy nahm vertraulich das junge Mädchen, das neben ihm stand, am Arm und sagte mit zärtlicher Stimme:
»Hören Sie, meine liebe Kleine, halten Sie mich wirklich für Ihren Freund?«
»Aber gewiss, Bel-Ami.«
»Haben Sie Vertrauen zu mir.«
»Unbedingt.«
»Entsinnen Sie sich dessen, was ich Ihnen vorhin gesagt habe?«
»Aber, was denn?«
»Über Ihre Heirat oder vielmehr über den Mann, den Sie heiraten werden.«
»Ja.«
»Nun, wollen Sie mir etwas versprechen?«
»Ja, was denn?«
»Mich jedes Mal um Rat zu fragen, wenn jemand um Ihre Hand anhält, und niemandem Ihr Wort zu geben, ehe Sie mich gesprochen haben.«
»Ja, das will ich tun.«
»Und das bleibt unter uns. Kein Wort davon weder zu Ihrem Vater noch zu Ihrer Mutter.«
»Kein Wort.«
»Sie schwören es?«
»Ich schwöre.«
Rival erschien aufgeregt und sprach mit wichtiger Miene:
»Gnädiges Fräulein, Ihr Papa sucht Sie für den Ball.«
Sie sagte:
»Kommen Sie mit, Bel-Ami.«
Aber er weigerte sich, fest entschlossen, sofort nach Hause zu gehen. Er wollte allein sein, um denken zu können. Zu viel neue Dinge gingen ihm durch den Kopf und er suchte nach seiner Frau. Nach kurzer Zeit erblickte er sie, sie stand am Büfett und trank Schokolade mit zwei unbekannten Herren. Sie stellte ihren Mann vor, ohne die Namen der beiden zu nennen.
Nach ein paar Augenblicken fragte er:
»Gehen wir?«
»Wie du willst.«
Sie nahm ihn beim Arm und sie schritten durch die Säle, die schon ziemlich leer waren.
Sie fragte:
»Wo ist Frau Walter? Ich möchte mich von ihr verabschieden.«
»Lieber nicht. Sie wird darauf bestehen, dass wir zum Ball bleiben und ich habe genug.«
»Das ist wahr, du hast recht.«
Während sie nach Hause fuhren, saßen sie schweigend nebeneinander, doch sobald sie in ihrem Zimmer waren, sagte Madeleine lächelnd, noch bevor sie ihren Schleier abgelegt hatte:
»Du weißt es noch nicht; ich habe eine Überraschung für dich.«
Er brummte launisch:
»Was denn?«
»Rate mal.«
»Nein, das ist mir zu anstrengend.«
»Also, übermorgen ist der 1. Januar.«
»Ja.«
»Der Tag der Neujahrsgeschenke.«
»Ja.«
»Hier hast du deins, das Laroche mir vorhin übergeben hat.«
Sie reichte ihm eine kleine schwarze Schachtel, die wie ein Schmucketui aussah.
Er öffnete sie gleichgültig und erblickte darin das Kreuz der Ehrenlegion.
Er wurde blass, dann lächelte er und erklärte:
»Ich hätte zehn Millionen vorgezogen. Das hier wird ihn nicht viel gekostet haben.«
Sie hatte gedacht, er würde sich freuen. Seine Kälte ärgerte sie.
»Du bist wirklich unglaublich! Du bist jetzt mit nichts mehr zufrieden.«
Er antwortete ruhig:
»Dieser Mann bezahlt nur seine Schulden. Tatsächlich schuldet er mir viel mehr.«
Sie war erstaunt über den Ton seiner Worte und sagte:
»In deinem Alter ist das doch sehr hübsch.«
»Das eine hängt vom anderen ab«, erwiderte er. »Ich könnte jetzt viel mehr besitzen.«
Er nahm das Kästchen, stellte es offen auf den Kamin hin und betrachtete einige Augenblicke das Kreuz, das darin blitzte, schloss es wieder, und ging dann achselzuckend zu Bett.
Der Officiel vom 1. Januar verkündete tatsächlich die Ernennung des Schriftstellers Herrn Prosper-Georges Du Roy zum Ritter der Ehrenlegion »wegen außergewöhnlicher Verdienste«. Der Name war in zwei Worten geschrieben und das machte Georges mehr Freude als der Orden selbst.
Eine Stunde später, nachdem er diese Nachricht gelesen hatte, erhielt er einen Brief von der Frau Direktor, worin sie ihn bat, denselben Abend noch zum Essen zu kommen, um die Auszeichnung zu feiern. Er zögerte eine Weile, dann warf er den in zweideutigen Ausdrücken geschriebenen Brief ins Feuer und sagte zu Madeleine:
»Wir wollen heute bei Walters essen.«
Sie war überrascht.
»Wieso? Ich dachte, du wolltest ihr Haus nicht mehr betreten.«
Er sagte leise:
»Ich habe es mir anders überlegt.«
Als sie erschienen, saß Frau Walter allein in dem kleinen Louis-XVI-Boudoir, das für den intimeren Verkehr bestimmt war. Sie war in Schwarz gekleidet und hatte ihr Haar gepudert, was ihr sehr gut stand. Von weitem sah sie alt, von nahe jung aus, und wenn man sie genau betrachtete, so wirkte sie wie ein schönes Bild.
»Sind Sie in Trauer?« fragte Madeleine.
Sie antwortete schwermütig:
»Ja und nein. Ich habe niemanden von meinen Angehörigen verloren. Aber ich bin bereits in dem Alter, wo man um sein Leben trauert. Ich habe das Kleid heute angezogen, um es einzuweihen. Fortan werde ich die Trauer in meinem Herzen tragen.«
Du Roy dachte:
»Wie lange wird sie wohl bei dem Entschluss bleiben?«
Das Diner verlief etwas langweilig. Nur Suzanne schwatzte unaufhörlich. Rose schien verstimmt zu sein. Man beglückwünschte den Journalisten.
Abends spazierte man durch die Säle und den Wintergarten und unterhielt sich. Du Roy ging mit der Frau Direktor als letzter; sie hielt ihn am Arm zurück.
»Hören Sie,« sagte sie mit dumpfer Stimme, »ich will nie mehr mit Ihnen darüber reden, niemals. Aber kommen Sie mich besuchen. Sehen Sie, ich duze Sie gar nicht mehr. Es ist mir ganz unmöglich, ohne Sie zu leben, ich kann es nicht! Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Qual das ist. Ich fühle Sie, ich habe Sie vor meinen Augen, in meinem Herzen, in meinem Fleisch und in meiner Seele, den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch. Mir ist es, als hätten Sie mich ein Gift trinken lassen, das mich nun innerlich verzehrt. Ich halte es nicht mehr aus. Nein, ich kann nicht mehr. Ich will für Sie nur eine alte Frau sein. Ich trage weiße Haare, um es Ihnen zu zeigen, aber kommen Sie zu mir. Kommen Sie von Zeit zu Zeit als Freund des Hauses.«
Sie ergriff seine Hand, presste sie krampfhaft und drückte ihre Nägel in sein Fleisch.
Er antwortete ruhig:
»Schön. Es ist unnütz, darüber wieder Worte zu verlieren. Sie sehen doch, ich bin heute gleich auf Ihren Brief gekommen.«
Walter ging mit den beiden jungen Mädchen und Madeleine voran und wartete auf Du Roy vor dem Bilde »Jesus über die Fluten schreitend«.
»Stellen Sie sich vor,« sagte er lachend, »ich habe gestern meine Frau hier auf den Knien vor diesem Gemälde vorgefunden, wie in einer Kapelle. Sie betete. Wie ich gelacht habe!«
Madame Walter erwiderte mit fester Stimme, die jedoch einer gewissen zitternden Erregung nicht entbehrte:
»Dieser Christus wird meine Seele retten. Er gibt mir Mut und Kraft jedes Mal, wenn ich ihn ansehe.«
Sie blieb vor dem auf dem Meere schreitenden Gott stehen und sagte leise:
»Wie schön ist es, wie diese Männer sich vor ihm fürchten und wie sie ihn lieben. Sehen Sie seine Augen, seinen Kopf, sehen Sie, wie schlicht und doch überirdisch er ist!«
Suzanne rief:
»Aber er hat doch Ähnlichkeit mit Ihnen, Bel-Ami, ich bin sicher, er ist Ihnen ähnlich! Wenn Sie so einen Doppelbart hätten oder wenn er rasiert wäre, dann würdet ihr beide ganz gleich aussehen. Oh, ist das auffällig.«
Sie wollte, dass er sich neben das Bild stellte, und alle erkannten tatsächlich, dass beide Gesichter miteinander Ähnlichkeit hatten.
Alles war überrascht. Walter fand die Sache sehr seltsam. Madeleine meinte lächelnd, dass Jesus männlicher aussehe.
Frau Walter rührte sich nicht, unbeweglich und mit starrem Blick betrachtete sie das Gesicht ihres Geliebten neben dem des Heilands. Sie war fast so weiß geworden wie ihr weißes Haar.