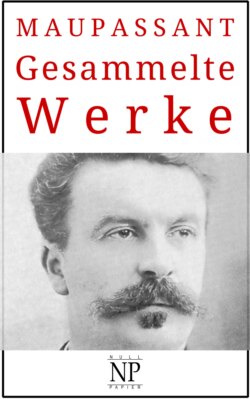Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 59
II.
ОглавлениеNun begann für sie ein Leben der fortgesetzten Qual. Sie arbeitete maschinenmässig, ohne sich etwas bei ihrer Arbeit zu denken. Die einzige Idee, die sie beständig beherrschte, war: »Wenn man es erfahren würde.«
Diese fortwährende Besorgnis machte sie so unfähig, ruhig nachzudenken, dass sie nicht einmal auf ein Mittel sann, um den Skandal zu vermeiden, den sie von Tag zu Tag unwiderruflich und sicher, wie den Tod, herankommen sah.
Jeden Tag, wenn die Andren noch schliefen, stand sie auf und suchte mit ängstlicher Beharrlichkeit den Umfang ihrer Taille in einem kleinen Glasscherben zu studieren, welcher ihr als Spiegel diente; immer fürchtend, dass es der heutige Tag sei, an dem man ihre Schande bemerken würde.
Und tagsüber unterbrach sie alle Augenblicke ihre Arbeit und schaute nach unten, ob ihre zunehmende Stärke nicht schon an der Lage der Schürze kenntlich würde.
Monate vergingen. Sie sprach fast nicht mehr, und wenn man sie nach etwas fragte, so begriff sie kaum, schreckte zusammen, riss die Augen auf und zitterte an den Händen, sodass ihr eines Tages der Herr sagte:
»Armes Mädchen! Wie einfältig bist Du doch seit einiger Zeit!«
In der Kirche verbarg sie sich hinter einem Pfeiler und wagte nicht mehr zur Beichte zu gehen, aus Furcht vor dem Pfarrer, dem sie die übermenschliche Gabe zutraute, im Herzen seiner Pfarrkinder lesen zu können.
Bei Tisch verging sie fast vor Angst, wenn ihre Gefährtinnen sie anschauten, und glaubte sich fortwährend von dem Kuhjungen entdeckt, einem vorlauten, listigen Burschen, dessen lauerndes Auge stets auf ihr ruhte.
Eines Morgens brachte ihr der Postbote einen Brief. Noch niemals hatte sie einen bekommen, und sie war so erschrocken, dass sie sich hinsetzen musste. War er vielleicht von ihm? Aber weil sie nicht lesen konnte, so hielt sie angstvoll zitternd das tintenbefleckte Papier in der Hand. Sie steckte es in die Tasche; da sie Niemandem ihr Geheimnis anzuvertrauen wagte, hielt sie öfters in der Arbeit inne, um längere Zeit diese gleichmässigen Linien zu betrachten, unter welchen sich ein amtlicher Stempel befand; sie hatte eine stille Hoffnung, dass es ihr plötzlich gelingen würde, den Sinn zu erraten. Endlich, da sie vor Unruhe und Ungeduld beinahe verging, suchte sie den Schulmeister auf und dieser las ihr, nachdem er ihr einen Stuhl angeboten hatte, Folgendes vor:
»Liebe Tochter!
Mit Gegenwärtigem wollte ich Dir mitteilen, dass es mir sehr schlecht geht. Unser Nachbar, Meister Dentu, hat es übernommen Dir zu schreiben, dass Du kommen möchtest, wenn Du kannst.
Für Deine treue Mutter
Caesar Dentu, Adjunkt.«
Schweigend ging sie von dannen; aber sobald sie allein war, brach sie am Rande des Weges zusammen, denn ihre Füsse wollten sie nicht mehr tragen. Dort blieb sie bis zum Einbruch der Nacht.
Beim Nachhausekommen klagte sie dem Herrn ihr Leid, und dieser erlaubte ihr, so lange als sie wollte zu verreisen, wenn eine Tagelöhnerin ihre Arbeit verrichten wolle; er versprach ihr auch, sie bei der Rückkehr wieder in Dienst zu nehmen.
Ihre Mutter war bereits bewusstlos und starb am Tage ihrer Ankunft; am nächsten Tage gebar Rose ein Kind von sieben Monaten. Es war ein abschreckendes kleines Wurm von schauderhafter Magerkeit, das fortwährend Schmerzen zu haben schien; so krampfhaft ballte es seine armen Händchen zusammen, die fleischlos wie Krabbenfüsse waren.
Es blieb indessen am Leben.
Sie erzählte, dass sie verheiratet sei, dass sie sich aber jetzt mit dem kleinen Wesen nicht belasten könne; und so ließ sie es bei Nachbarsleuten, die es gut zu pflegen versprachen.
Nach kurzer Zeit kehrte sie in ihren Dienst zurück. Aber nun erhob sich in ihrem so lange gequälten Herzen gleich der Morgenröte eine bis dahin ungeahnte Liebe für das zarte kleine Wesen, das sie da unten zurückgelassen hatte; und diese Liebe war selbst wieder eine Quelle neuer Leiden für sie, denn stündlich, ja fast in jeder Minute fühlte sie den herben Trennungsschmerz.
Was sie besonders quälte war ein geradezu wahnsinniges Verlangen, es zu umarmen, es an ihre Brust zu legen, die Wärme seines kleinen Körpers an sich selbst zu verspüren. Bei Nacht schlief sie nicht und bei Tage dachte sie unausgesetzt daran; abends nach beendeter Arbeit setzte sie sich ans Feuer und blickte stier in die Flammen, wie jemand, dessen Gedanken in der Ferne weilen.
Die Leute fingen schon an, sich darüber aufzuhalten und sie damit zu necken, dass sie gewiss einen Liebhaber irgendwo hätte; man fragte sie, ob er hübsch und groß, ob er reich sei, wann die Hochzeit und wann Taufe sein würde. Oft flüchtete sie sich hinaus, um für sich allein zu weinen; denn diese Fragen schnitten ihr wie ein Dolch ins Herz.
Um sich auf andere Gedanken zu bringen, arbeitete sie wie toll drauf los und war nur bedacht, wie sie möglichst viel Geld für ihr armes kleines Wurm ersparen könnte.
Sie wollte so fleissig arbeiten, dass man ihr den Lohn erhöhen müsste.
Allmählich riss sie alle Besorgungen auf dem Hofe an sich, eine Magd wurde entlassen, da sie für zweie arbeitete; sie sparte am Brote, am Öl, am Licht, am Korn, das man den Hühnern zu reichlich streute, und am Futter für das Vieh, das man bis dahin vielfach verschleudert hatte. Sie geizte mit dem Gelde des Herrn, als sei es ihr eigenes; und damit möglichst billig eingekauft und die Erzeugnisse des Hofes so teuer wie möglich verkauft würden, besorgte sie alle diese Geschäfte selbst. Sie führte die Aufsicht über die Arbeitsleute und über alles, was auf dem Hofe vorging. Sie war so sorgsam, dass der Hof unter ihrer Aufsicht einen sichtbaren Aufschwung nahm. Auf zwei Meilen in der Runde sprach man nur von der »Magd des Meister Vallin« und ihr Herr pflegte oft zu sagen: »Dieses Mädchen ist mehr wie Gold wert.«
Indess, die Zeit verging, und ihr Lohn blieb derselbe. Man nahm ihre übertriebene Arbeit als etwas an, was jede treue Magd tut, als den Beweis eines wirklich guten Willens; und allmählich berechnete sie mit einer gewissen Bitterkeit, dass, während der Herr monatlich fünfzig bis hundert Taler mehr einnehme, sie stets nur ihre zweihundertundvierzig Francs, nicht mehr und nicht weniger, jährlich verdiene.
Sie entschloss sich, um eine Zulage zu bitten. Dreimal suchte sie den Herrn auf, aber jedes Mal, wenn sie vor ihm stand, sprach sie von andren Dingen. Sie schämte sich gewissermassen Geld zu verlangen, als wenn das etwas Unanständiges wäre. Eines Tages endlich, als der Pächter allein in der Küche frühstückte, sagte sie ihm mit verlegener Miene, sie müsse ihm etwas Besonderes mitteilen. Er schaute erstaunt auf, beide Hände auf den Tisch gestützt; in der einen hielt er das Messer mit der Spitze nach oben, in der andren ein Stück Brot. So blickte er unverwandt auf seine Magd. Sie wurde bei diesem Blick ganz fassungslos und bat ihn, auf acht Tage nach Hause gehen zu dürfen, weil ihr nicht ganz wohl sei.
Er erlaubte ihr das sofort und sagte dann selbst etwas verlegen:
»Ich habe übrigens auch mit Dir zu reden, wenn Du wiederkommst.«
*