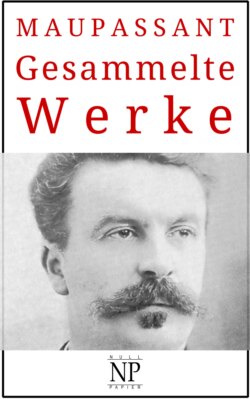Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 63
Im Familienkreise
ОглавлениеDie Tramway von Neuilly hatte soeben die »Porte Maillot« passiert und fuhr nun die große Avenue entlang, welche auf die Seine zu führt. Die kleine Dampfmaschine, welche den Wagen zog, keuchte mächtig bei der starken Steigung der Strasse, und stiess ruckweise ihre Rauchwolken aus; es klang wie das Schnauben eines Laufenden, dem der Atem ausgeht, und die Eisenglieder ihrer Kolben brachten ein lebhaftes Geräusch hervor. Die erschlaffende Schwüle eines zur Neige gehenden Sommertages lag auf der Strasse, auf welcher sich trotz der Windstille eine dichte, weiße, erstickende und glühende Staubwolke erhob, die die feuchte Haut bedeckte und in Nase und Ohren drang.
Einzelne Leute traten unter die Türen, um etwas frische Luft zu schöpfen.
Die Scheiben des Wagens waren heruntergelassen, und bei der schnellen Fahrt flatterten die Vorhänge im Luftzuge. Nur wenige Personen befanden sich im Innern; denn bei diesen heissen Tagen zog man das Verdeck der Omnibusse vor. Es waren dies korpulente Damen mit auffallenden Toiletten, jene Sorte von Bewohnerinnen der Vorstädte, die das, was ihnen an Vornehmheit fehlt, durch eine gewisse unangemessene Steifheit zu ersetzen suchen; ferner abgearbeitete Büromenschen mit aufgeschwemmten Gesichtern und kurzer Taille, deren eine Schulter in Folge der ewigen vorgebeugten Haltung bei ihren Arbeiten etwas in die Höhe gezogen war. Ihre unruhigen und bekümmerten Mienen sprachen ausserdem noch von häuslichen Nöten, drohenden Geldsorgen und von der gänzlichen Vernichtung einstmals vielleicht glänzender Hoffnungen. Sie schienen alle zu jener Klasse armer Teufel zu gehören, die in einem jener kleiner weißgestrichenen Häuschen mit einem Stückchen Garten, wie man sie auf dem Lande in der Umgegend von Paris zu Tausenden findet, nur mit grösster Sparsamkeit ihr Dasein fristen.
Ganz nahe an der Türe sass ein kleiner untersetzter Herr mit aufgedunsenem Gesicht, dessen Bauch sozusagen zwischen seinen geöffneten Schenkeln ruhte. Er war ganz schwarz gekleidet und trug ein Ordensband im Knopfloch. Sein Gegenüber, mit dem er sich eifrig unterhielt, war ein großer, magerer Mann von nachlässigem Äusseren. Sein weißer Drillich-Anzug war sehr schmutzig, und auf dem Kopfe trug er einen alten ebenfalls stark mitgenommenen Panama-Hut. Der erste Herr sprach langsam, sodass er zuweilen den Eindruck eines Stotterers machte; es war Herr Caravan, Bürobeamter im Marineministerium. Der andere war früher Krankenwärter an Bord eines Handelsschiffes gewesen und hatte sich schliesslich in Courbevoie niedergelassen, wo er bei der ärmeren Bevölkerungsklasse den Rest von medizinischen Kenntnissen verwertete, den er sich aus seinem dunklen abenteuerlichen Leben bewahrt hatte. Er hiess Chenet und hörte sich gerne »Doktor« nennen; über seinen Charakter gingen allerlei Gerüchte herum.
Herr Caravan hatte von jeher das gleichmässige Leben eines Büromenschen geführt. Seit dreissig Jahren ging er unveränderlich jeden Morgen auf demselben Wege in sein Büro, begegnete zu derselben Stunde und an denselben Stellen denselben Leuten, die ihren Geschäften nachgingen; und ebenso kehrte er abends auf demselben Wege zurück, wo er noch dieselben Gesichter sah, die er schon vor dreissig Jahren gesehen hatte.
Jeden Tag, nachdem er sich an einer Ecke des Faubourg Saint-Honoré sein Sou-Blättchen gekauft, holte er sich seine zwei Brödchen und ging dann ins Ministerium, wie ein Verurteilter, der seine Haft antreten will; schnell trat er in sein Büro ein, denn er wurde die stete innere Unruhe nicht los, ob er nicht bei seiner Ankunft irgend einen Tadel wegen eines Versehens zu erwarten hätte.
Nichts hatte bisher die einförmige Ordnung seines Daseins geändert, denn ausser seinen Bürogeschäften, Avancements und Gratifikationen berührten ihn die sonstigen Ereignisse nicht. Mochte er nun im Ministerium oder in seiner Familie sein (er hatte nämlich die Tochter eines Kollegen, ohne jede Mitgift, geheiratet), niemals sprach er von etwas anderem als vom Dienst. Sein durch die geisttötende tägliche Arbeit verknöcherter Sinn hatte keine anderen Gedanken, keine anderen Träume und Hoffnungen mehr, als die, welche sich auf sein Ministerium bezogen. Aber eins verbitterte ihm stets die Selbstzufriedenheit seines Beamtendaseins: die Zulassung der Marine-Kommissare, der Klempner, wie man sie ihrer silbernen Litzen wegen nannte, zu den Stellen der Sous-Chefs und sogar der Chefs; und jeden Abend beim Essen demonstrierte er seiner Frau, die übrigens ganz seinen Groll teilte, unter lebhaften Gebärden vor, wie ungerecht es auf alle Fälle sei, die Stellen in Paris mit Leuten zu besetzen, die naturgemäss für das Seeleben bestimmt wären.
Er war jetzt alt geworden, ohne zu bemerken, wie das Leben verflog; denn das Gymnasium hatte ohne eigentliche Unterbrechung seine Fortsetzung im Büro gefunden und die Lehrer, vor denen er früher gezittert hatte, waren jetzt durch die Chefs ersetzt, vor denen er beinahe noch eine grössere Angst hatte. An der Schwelle dieser Büro-Despoten überlief ihn stets ein heiliger Schauer, und von dieser fortgesetzten Ängstlichkeit hatte er sich allmählich eine linkische Art des Auftretens, diese demütige Haltung, dieses gewisse nervöse Stottern angewöhnt.
Er kannte von Paris eigentlich nicht viel mehr, als ein Blinder, der von seinem Hunde täglich an denselben Standplatz geführt wird, und wenn er in seinem Sou-Blättchen die täglichen Neuigkeiten und Skandal-Geschichten las, so durchflog er sie wie hübsche Märchen, die eigens erfunden waren, um den kleinen Beamten etwas Unterhaltungsstoff zu bieten. Ein Mann der Ordnung, ein Reaktionär ohne bestimmte Parteirichtung, aber ein abgesagter Feind aller Neuerungen, überschlug er die politischen Nachrichten, welche sein Blatt übrigens, je nachdem es bezahlt wurde, entsprechend entstellte. Und wenn er abends die Avenue des Champs-Elysées wieder heraufging, so betrachtete er die hin- und herwogende Menge der Spaziergänger und das Getriebe der Wagen, wie ein heimatloser Wanderer, der fremde Gegenden durchquert.
Da er zu eben dieser Zeit seine dreissig Dienstjahre hinter sich hatte, so hatte man ihm zum 1. Januar das Kreuz der Ehrenlegion überreicht, womit man bei den Militär-Verwaltungen die lange und elende Sklaverei -- man nennt sie: »Redliche Dienste« -- belohnt, in der diese armen Sträflinge am grünen Tische schmachten. Diese unerwartete Auszeichnung, welche ihm von seinen Befähigungen einen ganz neuen und hohen Begriff beibrachte, hatte in seinem Wesen eine vollständige Umwälzung hervorgerufen. Von nun an verbannte er seine farbigen Hosen und Fantasie-Westen; er trug nur noch schwarze Beinkleider und lange Überröcke, auf denen sein sehr breites Band sich besser ausnahm. Jeden Morgen war er glatt rasiert, seine Nägel pflegte er mit Sorgfalt, und alle zwei Tage wechselte er die Wäsche in einem ganz richtigen Gefühl der Hochachtung und Ehrfurcht vor dem nationalen Orden, den er trug. So war er über Nacht ein anderer, ein selbstbewusster, zugeknöpfter und herablassender Caravan geworden.
Zu Hause sprach er bei jeder Gelegenheit von »seinem Kreuze.« Er war darin so eifersüchtig, dass er nicht einmal im Knopfloch eines anderen irgend ein buntes Band sehen konnte. Vor allem ereiferte er sich beim Anblick fremder Orden, »die man in Frankreich gar nicht zu tragen erlauben sollte.« Er betonte dies besonders mit Bezug auf den »Doktor« Chenet, den er jeden Abend auf der Tramway mit irgend einer weiß-blauen, orangefarbenen oder grünen Dekoration im Knopfloch antraf.
Die Unterhaltung dieser beiden vom Arc de Triomphe bis Neuilly war übrigens täglich die gleiche; und auch heute beschäftigten sie sich, wie immer, mit lokalen Übelständen, über die sie sich beide ärgerten, während der Maire von Neuilly sie viel zu leicht nehme. Dann brachte Caravan, wie das in Gegenwart eines Arztes ja stets geschieht, das Gespräch auf das Kapitel der Krankheiten, indem er hoffte, auf diese Weise einige ärztliche Ratschläge gratis zu erhalten. Seine Mutter machte ihm übrigens seit einigen Tagen wirklich Sorgen. Sie hatte öfters längere Ohnmachtsanfälle und wollte sich dabei trotz ihrer neunzig Jahre noch keine Schonung auferlegen.
Ihr hohes Alter machte Caravan immer ganz weichmütig, und unaufhörlich fragte er den »Doktor« Chenet: »Haben Sie das schon oft erreichen sehen?« Und dabei rieb er sich immer ganz glücklich die Hände, nicht so sehr weil er glaubte, dass das Leben seiner Mutter auf Erden ewig dauern würde, sondern weil die lange Dauer des mütterlichen Lebens ihm selbst ein hohes Alter zu versprechen schien.
»Ja!« fuhr er fort, »in meiner Familie lebt man sehr lange; ich bin sicher, dass ich gleichfalls sehr alt werde, wenn nichts Besonderes eintritt.«
Der ehemalige Krankenpfleger warf einen mitleidigen Blick auf ihn. Er betrachtete einen Augenblick das rötliche Gesicht seines Nachbarn, seinen fleischigen Hals, seinen aufgetriebenen Leib, der sich zwischen zwei schwammigen fetten Schenkeln verlor, die ganze apoplektische Erscheinung des verweichlichten alten Beamten; und indem er mit einem Händedruck sich den grauen Strohhut zurechtrückte, antwortete er halb ernst, halb lachend:
»Nicht so sicher als Sie denken; Ihre Mutter ist die personifizierte Magerkeit und Sie sind die reine Poularde.«
Caravan wurde verlegen und schwieg.
Inzwischen hatte die Tramway ihren Haltepunkt erreicht und die beiden Herren stiegen aus. Herr Chenet schlug vor, einen Wermut im Café du Globe zu trinken, wo sie beide ihren Stammtisch hatten. Der Chef, ein alter Freund von ihnen, reichte ihnen zwei Finger, die sie über Flaschen und Gläsern hinweg schüttelten; dann begaben sie sich an einen Tisch, wo drei Liebhaber des Dominos schon seit Mittag beim Spielchen sassen. Freundschaftliche Redensarten, darunter das unvermeidliche »Was gibt’s Neues« wurden ausgetauscht. Hierauf setzten sich die Spieler wieder zu ihrer Partie und sie wünschten denselben einen guten Abend. Jene reichten ihnen die Hände, ohne von ihren Steinen aufzusehen, und die beiden Herren gingen zum Essen nach Hause.
Caravan bewohnte nahe beim Rondel von Courbevoie ein kleines zweistöckiges Haus, dessen Erdgeschoss ein Friseur innehatte.
Zwei Zimmer, ein Speisezimmer und eine Küche, in denen Rollsessel je nach Bedarf hin- und hergeschoben wurden, bildeten die beiden einzigen Räume, in denen Madame Caravan ihre Arbeitszeit zubrachte, während ihre zwölfjährige Tochter Maria-Louise und der neunjährige Sohn Philipp-August sich mit der ganzen Strassenjugend des Viertels in der Gosse herumbalgten.
Über sich hatte Caravan seine Mutter einlogiert, deren Geiz in der ganzen Umgegend berühmt war und von deren Magerkeit man sich sagte, dass der Herrgott bei ihr seine eigenen Sparsamkeits-Grundsätze angewandt habe. Stets schlechter Laune ließ sie keinen Tag ohne ihre besonderen Klagen und Heftigkeits-Ausbrüche vergehen. Sie zankte sich vom Fenster aus mit den Nachbarinnen vor der Türe, mit den Krämerfrauen, den Gassenkehrern und den Strassenjungen, die sie aus Rache beim Ausgehen von Weitem mit dem Rufe »Seht die Bettnässerin« verfolgten.
Ein kleines unglaublich dummes Dienstmädchen aus der Normandie besorgte den Haushalt und schlief des Nachts im zweiten Stock bei der Alten, für den Fall, dass dieser etwas zustossen sollte.
Als Caravan nach Hause kam, fand er seine Frau damit beschäftigt, mittels eines Flanelllappens die vereinzelt im Zimmer stehenden Mahagonistühle wieder aufzupolieren; sie litt nämlich an chronischer Putzsucht. Ihre Hände waren stets von Zwirnhandschuhen bedeckt, ihr Haupt war mit einer Mütze geschmückt, von welcher bunte Bänder herabflatterten und die stets schief auf einem Ohre sass. Jedes Mal wenn sie bohnend, bürstend, firnissend oder seifend angetroffen wurde, pflegte sie zu sagen: »Ich bin nicht reich, bei mir ist alles einfach; aber die Reinlichkeit ist mein Luxus und darin bin ich mancher andren über.«
Mit praktischem Verstande begabt, beherrschte sie ihren Mann in allem. Jeden Abend bei Tisch und später noch im Bett sprachen sie lange noch von Büro-Angelegenheiten, und obschon sie zwanzig Jahr jünger war wie er, so vertraute er sich ihr wie einem Beichtvater an und folgte in allem ihren Ratschlägen.
Sie war niemals hübsch gewesen; jetzt war sie sogar hässlich, von kleiner schmächtiger Figur. Ihre unscheinbare Kleidung ließ bei ihr jene äusseren weiblichen Formen völlig verschwinden, welche ein gut sitzender Anzug künstlich hervorheben kann. Ihre Kleiderröcke waren stets an irgend einer Stelle in die Höhe geschlagen und sie pflegte sich häufig, ganz gleichgültig wo, zu kratzen, ohne jede Rücksicht auf etwaige Anwesende und mit einer Intensivität, die geradezu etwas krankhaftes hatte. Der einzige Schmuck, den sie sich leistete, war jener Aufputz von seidenen Bändern verschiedenartigster Farben auf den stolzen Häubchen, die sie zu Hause zu tragen pflegte.
Sobald sie ihren Mann bemerkte, erhob sie sich, küsste ihn auf beide Wangen und fragte ihn dann: »Hast Du an Potin gedacht, lieber Freund?« (Es handelte sich um eine Bestellung, die er auszurichten versprochen hatte.) Er ließ sich erschreckt auf einen Stuhl fallen, denn er hatte es jetzt gerade zum vierten Male vergessen. -- »Es ist ein Elend« sagte er, »ein wahres Elend! Ich kann den ganzen Tag mich dran erinnern, und abends vergesse ich es doch jedes Mal.« Aber als sie sah, dass es ihn alterierte, suchte sie ihn schnell zu trösten: »Lass doch nur! Morgen besorgst Du’s mir schon. Nichts Neues im Ministerium?«
»Allerdings, eine große Neuigkeit sogar; noch ein Klempner ist Sous-Chef geworden.«
Sie wurde sehr erregt.
»In welcher Abteilung?«
»In der Abteilung für auswärtige Erwerbungen.«
»An Stelle Ramon’s also«, sagte sie ärgerlich, »gerade die ich mir für Dich ausgedacht hatte. Und Ramon? Pensioniert?«
»Pensioniert«, stammelte er.
»Damit ist’s nun aus, mit dieser schönen Gelegenheit;« sagte sie heftig, während ihr Häubchen auf die Schulter rutschte. »Es lässt sich im Augenblick nichts machen. Und wie heisst er denn, Dein Kommissair?«
»Bonassot«.
Sie nahm die Marine-Rangliste, die sie stets zur Hand hatte, und schlug nach:
»Bonassot. -- Toulon. -- Geb. 1851. -- Kommissariats-Eleve 1871, Unter-Kommissar 1875. -- Hat er zur See gedient, der da?«
Bei dieser Frage heiterte sich Caravan’s Antlitz wieder auf. Er lachte, dass ihm der Bauch wackelte.
»Wie Balin, genau wie sein Chef Balin.«
Und mit noch stärkerem Lachen fügte er einen alten Witz hinzu, der im ganzen Ministerium kursierte:
»Man dürfte sie ja nicht einmal ausschicken, um die Marinestation Point-Du-Jour zu inspizieren; sie würden unterwegs an der Seekrankheit sterben.«
Aber sie blieb ernst, als hätte sie nichts gehört; dann murmelte sie, sich langsam am Kinn kratzend:
»Wenn man nur einen Deputierten an der Hand hätte! Wüsste die Kammer alles, was da drinnen vorgeht, so müsste das Ministerium auf der Stelle springen …«
Lautes Schreien auf der Treppe schnitt ihr die weiteren Worte ab. Marie-Louise und Philipp-August, welche von der Gasse heraufkamen, bearbeiteten sich gegenseitig auf jeder Treppenstufe mit Püffen und Fusstritten. Ihre Mutter rannte zornig heraus, nahm Jedes am Arme und stiess sie beide ins Zimmer, wobei sie sie kräftig schüttelte.
Sobald sie ihren Vater sahen, stürzten sie auf ihn los und er küsste sie lange zärtlich; dann nahm er beide auf seine Knie und plauderte mit ihnen.
Philipp-August war ein garstiger blasser Bursche, schmutzig von oben bis unten und hatte ein Gesicht wie ein Kretin. Marie-Louise glich jetzt schon sehr ihrer Mutter; sie sprach wie diese, indem sie deren Worte wiederholte und sogar ihre Gebärden nachahmte: »Was gibt’s Neues im Ministerium?«
»Dein Freund Ramon«, sagte er scherzend, »der jeden Monat bei uns isst, wird uns verlassen, Töchterchen! Ein anderer Souschef tritt an seine Stelle.«
Sie hob die Augen zu ihrem Vater empor und sagte mit einem für ihr Alter frühreifen Mitleid:
»Noch einer also, der Dir über den Kopf geklettert ist!«
Er hörte auf zu lachen und antwortete nicht; dann brachte er das Gespräch auf ein andres Thema, indem er sich zu seiner Frau wandte, die jetzt Fensterscheiben putzte:
»Der Mutter geht’s gut oben?« fragte er.
Madame Caravan hörte auf zu reiben, wandte sich um und brachte mit einem Ruck das Häubchen, welches ihr jetzt vollständig auf dem Rücken hing, wieder in Ordnung.
»Ach ja,« sagte sie mit zuckenden Lippen, »lass uns von Deiner Mutter sprechen. Sie hat mir einen netten Ärger bereitet. Denke Dir, als heute Madame Lebaudin, die Frau des Friseurs, während ich ausgegangen war, heraufkommt, um von mir ein Packet Stärke zu leihen, hat Deine Mutter sie fortgejagt und sie eine ›Bettlerin‹ geschimpft. Aber ich habe ihr meine Meinung gesagt, der Alten. Sie tat natürlich wieder, als höre sie nichts, wie immer, wenn man ihr mal die Wahrheit sagt, aber sie ist nicht tauber, weißt Du, wie ich; es ist Verstellung und weiter nichts. Der Beweis dafür ist der, dass sie sofort nach oben in ihr Zimmer gegangen ist, ohne weiter ein Wort zu reden.«
Caravan, dem diese Wendung des Gespräches peinlich war, schwieg klüglich still, zumal jetzt das Dienstmädchen meldete, es sei angerichtet. Dann nahm er, um seine Mutter hiervon zu benachrichtigen, einen Kehrbesen aus der Ecke, wo er immer ruhte, und klopfte damit dreimal an die Zimmerdecke. Hierauf ging man ins Speisezimmer und Madame Caravan jr. teilte die Suppe aus, während man auf die Mutter wartete. Diese kam jedoch nicht und die Suppe fing schon an kalt zu werden. Man begann langsam zu essen; aber als die Teller leer waren, wartete man immer noch vergebens.
»Das tut sie absichtlich«, sagte Madame Caravan ärgerlich zu ihrem Gatten, »und Du hältst ihr immer noch die Stange.«
Er fühlte sich sehr unbehaglich so zwischen zwei Lagern, und schickte Marie-Louise, um die Großmutter zu holen; dann blieb er still mit gesenkten Augen sitzen, während seine Frau mit der Messerspitze nervös an den Fuss ihres Glases klopfte.
Plötzlich öffnete sich die Türe, das Kind kam allein, schreckensbleich zurück und sagte schnell:
»Großmama liegt auf dem Fussboden!«
Mit einem Sprung stand Caravan auf, warf seine Serviette auf den Tisch und stürzte die Treppe herauf, auf der sein hastiger Schritt dröhnend widerhallte, während seine Frau, die irgend eine Bosheit ihrer Schwiegermutter vermutete, langsam und achselzuckend folgte.
Die alte Frau lag mitten im Zimmer der Länge nach auf der Erde, und als ihr Sohn sie aufrichtete, erschien sie steif und unbeweglich, ihr runzliches gelbes Gesicht war fahl, die Augen waren geschlossen, die Zähne aufeinander gepresst und alles an ihr blieb leblos.
»Meine arme Mutter, meine arme Mutter!« seufzte Caravan, der bei ihr niedergekniet war. Aber seine Frau, welche sie einen Augenblick betrachtet hatte, sagte:
»Bah! sie hat nur einen Ohnmachtsanfall; das ist alles. Sie möchte uns nur am Essen hindern, glaube mir.«
Man trug den Körper aufs Bett, entkleidete ihn und alle, Caravan, seine Frau und das Dienstmädchen begannen ihn zu reiben. Trotz aller Anstrengungen kehrte das Bewusstsein nicht zurück. Da sandte man Rosalie zum Doktor Chenet. Er wohnte am Quai nach Suresnes zu. Es war weit und man musste lange warten, bis er kam. Nachdem er sie angeschaut, beklopft und behorcht hatte, sagte er:
»Das ist der Tod.«
Von heftigem Schluchzen erschüttert warf sich Caravan auf den leblosen Körper und bedeckte krampfhaft das starre Antlitz seiner Mutter mit Küssen; dabei weinte er so heftig, dass seine Tränen wie große Wassertropfen über das Gesicht der Toten rollten.
Madame Caravan jr. fand es schicklich, auch ihrerseits Trauer zu bezeigen, und hinter ihrem Manne stehend, stiess sie verschiedene Seufzer aus, während sie sich in auffallender Weise die Augen wischte.
Caravan, dessen Antlitz noch röter war wie sonst, und dessen dünne Haare in Unordnung um seine Stirn herumhingen, war in der Tat von aufrichtigem Schmerz aufs Tiefste ergriffen.
»Aber sind Sie auch sicher, Doktor … sind Sie ganz sicher? …« wandte er sich plötzlich um. Der ehemalige Krankenpfleger trat schnell wieder heran, und indem er den Körper mit geschäftsmässiger Sicherheit betastete, wie ein Kaufmann, der eine Ware prüfen will, sagte er:
»Hier, bester Freund, betrachten Sie das Auge.«
Er schob die Augenlider zurück und unter seinen Fingern schien der Blick der alten Frau fast unverändert, vielleicht mit etwas grösserer Pupille. Caravan gab es einen Stich ins Herz und ein Zittern überfiel seinen ganzen Körper. Herr Chenet ergriff den runzeligen Arm, öffnete mit Gewalt die Finger und fuhr mit eifriger Miene, als sei er auf Widerspruch gestossen, fort:
»Aber sehen Sie sich doch nur ’mal diese Hand an; seien Sie ruhig, ich täusche mich niemals.«
Caravan stürzte sich von Neuem ganz aufgelöst auf das Bett. Er brüllte fast vor Schmerz, während seine Frau, immer leise schluchzend, die notwendigen Vorkehrungen traf. Sie schob das Nachttischchen heran, auf dem sie eine Serviette ausbreitete, stellte vier Lichter darauf, die sie anzündete, nahm einen geweihten Buchsbaumzweig hinter dem Spiegel über dem Kamin hervor und steckte ihn zwischen zwei Kerzen in ein Glas, das sie mit Weihwasser anfüllte.
Als sie so die äusseren Zurichtungen getroffen hatte, um der Toten alle Ehre zu erweisen, blieb sie gedankenvoll stehen. Der Doktor, welcher ihr bei ihren Anstalten geholfen hatte, flüsterte ihr zu:
»Es wäre besser, Caravan herauszuführen.«
Sie machte ein Zeichen des Einverständnisses, und indem sie sich ihrem Manne näherte, der auf den Knien liegend immer noch schluchzte, griff sie ihm unter einen Arm, während Herr Chenet ihn unter den anderen nahm.
Man setzte ihn zuerst auf einen Stuhl, und seine Frau suchte ihm zuzureden, während sie ihn wiederholt küsste. Der Doktor unterstützte ihre Bemühungen. Er sprach von Ergebung, Willenskraft, Mannesmut und allem, was man bei solchen Gelegenheiten an Zuspruch verwendet. Dann griffen ihn beide von Neuem unter den Arm und führten ihn heraus.
Er weinte wie ein großes Kind, mit krampfhaftem Schluchzen, völlig hilflos, die Arme schlaff herunterhängend, während seine Knie schlotterten. Ohne zu wissen, was er tat, und maschinenmässig einen Fuss vor den anderen setzend, stieg er die Treppe herunter.
Man setzte ihn in den Sessel, der noch immer am Tische stand, vor seinen halbleeren Teller, in dem sich noch der Rest der Suppe befand. Da sass er nun, regungslos, das Auge auf sein Glas geheftet, so aufgelöst, dass er nicht ’mal mehr einen klaren Gedanken zu fassen vermochte.
Madame Caravan sprach in einer Ecke mit dem Doktor, erkundigte sich nach den notwendigen Formalitäten, und ließ sich allerlei praktische Ratschläge geben. Schliesslich nahm Herr Chenet, der auf irgendetwas gewartet zu haben schien, seinen Hut und wollte sich verabschieden, indem er erklärte, er habe noch nicht zu Abend gegessen.
»Wie?« rief sie, »Sie haben noch nicht zu Abend gegessen? Aber bleiben Sie doch bei uns, Herr Doktor, bleiben Sie doch! Sie müssen mit dem vorlieb nehmen, was wir haben; Sie wissen ja, ein großes Diner gibt es nicht bei uns.«
Er lehnte ab und bat, ihn zu entschuldigen. Aber sie bestand darauf:
»Warum wollen Sie nicht bleiben? Man ist in solchen Augenblicken glücklich, einen Freund bei sich zu haben. Und vielleicht können Sie meinem Manne zureden, sich etwas zu stärken. Er hat seine Kräfte jetzt doppelt notwendig.«
»Wenn es denn sein muss, Madame, so nehme ich dankend an«, sagte der Doktor, indem er unter einer Verbeugung seinen Hut wieder ablegte.
Sie gab Rosalie, die ganz aus dem Häuschen war, allerhand Befehle und setzte sich dann selbst mit an den Tisch, »um wenigstens so zu tun, als ob sie ässe, und um dem ›Herrn Doktor‹ Gesellschaft zu leisten.«
Man nahm zunächst die aufgewärmte Suppe, von der Herr Chenet sich noch einen zweiten Teller erbat. Dann erschien eine Platte Lyoner Salami welche einen starken Knoblauch-Geruch verbreitete, und von der auch Madame Caravan kostete.
»Ausgezeichnet!« sagte der Doktor.
»Nicht wahr«, lächelte sie. »Nimm doch auch etwas, mein armer Alfred«, wandte sie sich an ihren Mann, »nur um etwas im Magen zu haben. Denke, dass Du noch die Nacht vor Dir hast.«
Er reichte mechanisch seinen Teller hin, wie er sich zu Bett gelegt haben würde, wenn man es ihn geheissen hätte; denn er folgte in allem ganz gedankenlos, zu keinem Widerstande fähig. So ass er auch.
Der Doktor, der sich selbst half, griff dreimal zu der Schüssel, während Madame Caravan von Zeit zu Zeit mit der Gabel ein großes Stück herausfischte und es sich gedankenlos in den Mund schob.
Als hierauf eine Salatschüssel voll Maccaroni erschien, murmelte der Doktor:
»Tausend, da kommt ’was Leckeres.«
Und Madame Caravan legte dieses Mal aller Welt vor; sie füllte sogar die Näpfe der Kinder damit, welche bei der mangelnden Aufsicht den Wein unvermischt tranken und sich bereits unter dem Tische wieder mit Fusstritten bearbeiteten.
Herr Chenet erinnerte sich an Rossini’s Vorliebe für diese italienischen Gerichte.
»Halt!« sagte er plötzlich, »habe ich da einen schönen Reim! man könnte ein ganzes Gedicht daraus machen:
Der Maëstro Rossini
Liebte die Maccaroni.«
Man hörte nicht mehr auf ihn. Madame Caravan war plötzlich nachdenklich geworden und überlegte alle wahrscheinlichen Folgen dieses Ereignisses, während ihr Gatte Brotkügelchen drehte, die er dann auf den Teller legte und starr, mit der Miene eines Idioten, anschaute. Da ein brennender Durst seine Kehle verzehrte, so brachte er alle Augenblicke das frischgefüllte Glas zum Munde. Sein Verstand, der bereits durch Erschütterung und Trauer hart mitgenommen war, wurde jetzt angeregt und schien ihm während seiner Verdauung über Schmerz und Kummer hinwegzutanzen.
Der Doktor trank übrigens wie ein Loch und wurde sichtlich angeheitert; auch Madame Caravan unterlag der Reaktion, die jeder nervösen Anspannung folgt. Sie war, obschon sie nur Wasser trank, gleichfalls aufgeregt und fühlte sich etwas verwirrt im Kopfe.
Herr Chenet begann verschiedene Toten-Geschichten zu erzählen, die ihm sehr scherzhaft erschienen. Denn in diesen Pariser Vorstädten, deren Bewohner in der Hauptsache ehemalige Provinzler sind, findet man noch diese Gleichgültigkeit des Landmannes gegen den Toten, mag es nun der Vater oder die Mutter sein, diese mangelnde Achtung, diese unbewusste Rohheit, die auf dem Lande so vielfach herrscht und in Paris selbst so selten ist.
»Denken Sie«, sagte er, »letzte Woche ruft man mich Rue de Puteaux; ich eile dahin, finde die Kranke verschieden und in der Nähe des Totenbettes die Familie damit beschäftigt, ruhig eine Flasche Anisette zu leeren, die man tags zuvor gekauft hatte, um eine letzte Laune der Sterbenden zu befriedigen.«
Aber Madame Caravan hörte nicht zu, da sie immerfort an die Erbschaft denken musste; und Caravan mit seinem umnebelten Gehirn verstand erst recht nichts davon.
Man brachte den Kaffee, der extra stark gemacht war, um die gute Stimmung zu erhalten. Jede Tasse, mit Cognak gewürzt, ließ auf den Wangen eine plötzliche Röte entstehen und vermehrte nur noch die Verwirrung, die der Alkohol und die seelische Erschütterung schon in diesen Gehirnen angerichtet hatten.
Dann bemächtigte sich der »Doktor« plötzlich der Flasche und schenkte jedem noch einen Abschiedstrunk ein. Und ohne ein Wort zu sprechen, in der angenehmen Wärme der Verdauung, ergriffen von jener tierischen Behaglichkeit, welche der Alkohol nach dem Essen verleiht, spülten sie sich langsam die Kehlen mit dem gezuckerten Cognak aus, der auf dem Boden der Kaffeetassen einen gelblichen Sirup bildete.
Die Kinder fingen an einzuschlafen und Rosalie brachte sie zu Bette.
Caravan, der wie jeder Unglückliche, das Bedürfnis fühlte, sich zu betäuben, nahm noch mehrere Gläschen Cognak zu sich, sodass seine bisher blöden Augen zu glänzen anfingen.
Endlich erhob sich der Doktor zum Fortgehen, und seinen Freund unterm Arm nehmend, sagte er:
»Komm, geh mit mir, die frische Luft wird Dir gut tun; wenn man sich durch etwas bedrückt fühlt, muss man sich Bewegung schaffen.«
Der andere gehorchte ohne Widerstand, nahm Hut und Stock und ging mit. Alle beide wandelten Arm in Arm bei dem hellen Sternenhimmel nach der Seine zu.
Ein balsamischer Hauch zog durch die laue Nacht, denn alle Gärten ringsumher standen zu dieser Jahreszeit in voller Blütenpracht, deren Duft, tagsüber weniger bemerkbar, sich beim Einbruch der Nacht zu verdoppeln schien und von dem leichten Abendlüftchen weit hinaus getragen wurde.
Die breite Strasse mit ihren beiden Reihen Gaslaternen lag bis zum Arc de Triomphe stumm und einsam vor ihnen. Aber da unten brodelte Paris wie ein siedender Topf. Ein unaufhörliches dumpfes Rollen schallte zu den einsamen Spaziergängern herüber, dem von Weiten her auf der Ebene zuweilen der grelle Pfiff eines mit voller Dampfkraft herankommenden oder abfahrenden Zuges antwortete.
Die frische Luft, welche den beiden Männern entgegenwehte, machte sie anfangs etwas betäubt, und erschütterte das Gleichgewicht des Doktors, während sie bei Caravan den Schwindel vermehrte, den er nach dem Diner verspürte. Er ging wie träumend einher; sein Geist war eingeschlafen und unfähig, einen ruhigen Gedanken zu fassen, ohne dass andrerseits sein Schmerz ein sehr heftiger gewesen wäre. Auch hier hinderte ihn die allgemeine geistige Erschlaffung, wirklich zu leiden; er fühlte vielmehr eine Art Erleichterung, wenn er den frischen balsamischen Duft der Frühlingsnacht einsog.
Bei der Brücke wandten sie sich rechts und empfanden mit Behagen den frischen Lufthauch, den ihnen der Fluss zusandte. Dieser floss hinter einem Vorhang von hohen Pappeln ruhig, fast melancholisch dahin; die Sterne schienen auf dem Wasser zu schwimmen und langsam von demselben fortgetragen zu werden. Ein feiner weißlicher Nebel, der auf dem jenseitigen Ufer lag, ließ eine Empfindung von Feuchtigkeit in die Lungen dringen und Caravan, bei dem dieser Dunst des Wassers alte Erinnerungen wach rief, blieb plötzlich stehen.
Er sah seine Mutter wieder vor sich wie damals in seiner Kindheit, dort unten in der Picardie, auf den Knien an dem kleinen Wasser, das durch den Garten floss und die Wäsche, die in einem Haufen neben ihr lag, eifrig waschend. Er hörte ihren Schlägel in dem ruhigen Schweigen der ländlichen Umgebung, er hörte ihre Stimme, wie sie rief: »Alfred, bringe mir Seife.« Und er spürte diesen selben Hauch von fliessendem Wasser, diesen selben Nebel, der aus der feuchten Erde aufsteigt, diese Waschhausluft, von der der Seifengeruch ihm unvergesslich geblieben war und den er gerade an diesem Abend, wo seine Mutter gestorben war, deutlich wieder zu riechen glaubte.
So stand er da, von einem neuen Anfall seiner trostlosen Verzweiflung erfasst. Es war, als habe plötzlich ein Lichtstrahl ihm die ganze Ausdehnung seines Unglücks beleuchtet; und bei dem Wiederempfinden dieses flüchtigen Hauches fühlte er sich in den tiefsten Abgrund des bittersten Schmerzes geschleudert. Der Gedanke an die Trennung für immer zerriss ihm das Herz. Er sah sein Leben in zwei Abschnitte geteilt, von denen der eine jetzt mit allen Erinnerungen seiner Jugendzeit durch diesen Todesfall für immer vor seinen Augen verschwand. Das ganze »Einstmals« war für ihn zu Ende. Niemand würde mehr mit ihm von vergangenen Zeiten reden können, von Leuten, die er früher gekannt hatte, von seiner Heimat, von ihm selbst, von allen Einzelheiten seines verflossenen Lebens. Ein Teil seines eigenen »Ich« hatte aufgehört zu existieren; jetzt brach die Zeit des Sterbens für den anderen heran.
Und nun zogen langsam die Erinnerungen an ihm vorüber. Er sah »die Mama« wieder vor sich, als sie noch viel jünger war, mit Kleidern, die sie so lange trug, bis sie gänzlich aufgebraucht waren, sodass sie mit der Vorstellung von ihrer Person unzertrennlich verbunden waren. Er fand sie unter tausenderlei längst vergessenen Verhältnissen wieder; ihre längstverschwundenen Gesichtszüge, ihre Gebärden, ihre Gewohnheiten, ihre besonderen Neigungen, die Falten auf ihrer Stirn, die Haltung ihrer mageren Finger, alle diese vertrauten Einzelheiten traten ihm jetzt wieder vor die Seele.
Und indem er sich fest an den Doktor klammerte, stiess er einen Seufzer nach dem andren aus. Seine schlotternden Knie wankten, seine ganze umfangreiche Figur wurde von heftigem Schluchzen erschüttert.
»Meine Mutter, meine arme liebe Mutter« stammelte er ein über das andere Mal.
Sein Begleiter, der immer noch angeheitert war und sich mit der Absicht trug, den Abend an irgend einem jener Orte zu verbringen, die er im geheimen zu besuchen pflegte, wurde über diesen heftigen Traueranfall sehr ungeduldig. Er redete ihm zu, sich etwas am Ufer ins Gras zu setzen und verliess ihn nach einer Weile unter dem Vorwande eines dringenden Krankenbesuches.
Caravan sass hier lange und weinte sich aus. Endlich, nachdem seine Tränen versiecht waren und all sein Leid an seinem geistigen Auge sozusagen vorübergezogen war, fand er wieder etwas Trost, eine Art Ruhe, wie einen plötzlichen Stillstand seiner Gefühle.
Der Mond war aufgegangen und sein mildes Licht erleuchtete den Horizont. Silberne Reflexe brachen sich an den säuselnden Blättern der Pappeln, und das ferne Geräusch auf der Ebene klang nur noch wie das Fallen des Schnees; der Fluss trug keine Sterne mehr, dafür glänzte er aber wie eine Perlmutterschale, auf der einzelne goldglänzende Furchen gezogen schienen. Die Luft war milde und noch immer spürte man den würzigen Blütenduft. Es lag etwas Weichliches in diesem Schlummer der Erde, aber es passte zu Caravan’s Stimmung, und mit Behagen genoss er die liebliche Ruhe der Nacht. Er atmete langsam und glaubte zu fühlen, dass seinen ganzen Körper eine angenehme Frische, eine sanfte Ruhe und seine Seele ein überirdischer Trost durchdringe. Er kämpfte absichtlich gegen dieses behagliche Gefühl, indem er immer »meine Mutter, meine arme Mutter!« wiederholte, und sich in einer Regung natürlichen Anstandsgefühles zum Weinen zu zwingen suchte; aber er konnte nicht mehr weinen, er konnte selbst seinen Gedanken nicht mehr jene traurige Richtung geben, die ihn vorhin hatte so heftig schluchzen lassen.
Endlich erhob er sich, um nach Hause zu gehen; er machte kurze Schritte, wie wenn er sich von der Heiterkeit der ihn umgebenden Natur nicht trennen könnte, und sein Herz blieb wider Willen friedlich bewegt.
Als er an die Brücke kam, bemerkte er das Licht der letzten schon zur Abfahrt bereiten Tramway und weiter hinten die erleuchteten Fenster des Café du Globe.
Da überkam ihn das Bedürfnis, irgendjemanden sein Unglück zu erzählen, sein Mitleid zu erwecken, sich gewissermassen interessant zu machen. Er verfiel wieder in seine traurige Haltung, öffnete die Türe und ging auf das Buffet zu, wo der Chef allzeit thronte. Er hatte auf einen effektvollen Augenblick gerechnet, wie alle Welt auf ihn zukommen, ihm die Hand reichen und ihn fragen würde: »Nun, was haben Sie?« Aber niemand bemerkte sein verstörtes Wesen. Er stützte sich mit dem Ellnbogen auf das Buffet, begrub das Gesicht in den Händen und murmelte: »Mein Gott, mein Gott!«
Der Chef sah ihn an.
»Sie sind krank, Herr Caravan?«
»Nein, mein armer Freund!« antwortete er, »aber meine Mutter ist heute gestorben.«
Der andere machte ein zerstreutes »Ach!« und als ein Gast aus dem Hintergrunde des Zimmers »Bitte, ein Glas Bier« rief, antwortete er sofort überlaut: »Hier, sogleich! … es kommt schon« und stürzte fort, den verwunderten Caravan allein stehen lassend.
An demselben Tische, wo er sie vor dem Essen gesehen hatte, sassen noch die drei Dominoliebhaber bei ihrem Spiele. Caravan näherte sich ihnen mit einer Miene zum Erbarmen. Als ihn keiner zu bemerken schien, entschloss er sich, zuerst zu sprechen.
»Mir ist soeben ein großes Leid geschehen«, sagte er.
Sie hoben alle drei gleichzeitig den Kopf ein wenig, aber ihre Augen blieben auf die Steine geheftet, die sie in den Händen hatten. »Nun, was denn?« -- »Meine Mutter ist gestorben«. -- »Ach Teufel!« murmelte einer von ihnen mit jenem halbbetrübten Gesicht, wie es die Gleichgültigen zu machen pflegen. Ein zweiter, der nichts Rechtes zu sagen wusste, ließ eine Art mitleidigen Seufzer hören, indem er die Stirn in Falten zog, während der dritte sich dem Spiele wieder zuwandte, als dächte er: »Das ist auch weiter nichts.«
Caravan hatte ein oder andres jener Worte erwartet, die »von Herzen« zu kommen pflegen; als er sich aber so empfangen sah, ging er wieder fort. Ihre Gleichgültigkeit bei dem Kummer eines Freundes empörte ihn, wenngleich er selbst für den Augenblick ja keinen so tiefen Schmerz empfand.
Er trat wieder auf die Strasse hinaus.
Seine Frau erwartete ihn schon im Schlafgewande; sie sass auf einem kleinen Sessel nahe des offenen Fensters und dachte immerfort an die Erbschaft.
»Zieh Dich aus«, sagte sie, »wir können im Bett noch plaudern.«
Er schaute auf, und mit dem Auge nach der Zimmerdecke weisend, sagte er:
»Aber … da oben … es ist niemand da.«
»Verzeih, Rosalie ist bei ihr, Du kannst sie um drei Uhr morgens ablösen, wenn Du erst mal ein Weilchen geschlafen hast.«
Er zog sich trotzdem nur teilweise aus, um für alle Fälle bereit zu sein, knüpfte sich ein Halstuch um, und begab sich dann zu seiner Frau, welche schon zu Bett gegangen war.
Eine Zeit lang sassen sie aufrecht nebeneinander. Sie dachte für sich hin.
Ihre Frisur war auch zu dieser Zeit durch ein Rosaband zusammengerafft und dieses Band hing gleichfalls auf dem einen Ohr herunter, als müsse das nun einmal so bei allen Bändern sein, die sie trug.
»Weißt Du, ob Deine Mutter ein Testament gemacht hat?« fragte sie plötzlich, sich zu ihm umwendend.
»Ich … ich … weiß nicht … ich glaube nicht …« sagte er zögernd. »Nein, sie hat ohne Zweifel keins gemacht.«
Madame Caravan sah ihrem Mann voll ins Gesicht.
»Das ist schmachvoll, weißt Du!« sagte sie mit tiefer zorniger Stimme. »Denn, sieh mal, seit zehn Jahren plagen wir uns damit, sie zu pflegen, sie bei uns wohnen zu lassen und sie zu ernähren. Deine Schwester hätte nicht so viel für sie getan und ich wahrhaftig auch nicht, wenn ich gewusst hätte, wie sie uns das lohnen würde! Das wirft einen trüben Schatten auf ihr Andenken. Du könntest mir freilich einwenden, dass sie uns ihre Pension bezahlte; aber die Pflege seiner Kinder kann man doch nicht mit Geld bezahlen, man kann sie nur nach seinem Tode durch ein Testament vergelten. So werden es alle anständigen Leute halten. Das habe ich nun von allen Mühen und Scherereien gehabt. Wahrhaftig, das ist eigentümlich, muss man sagen; wirklich eigentümlich!«
»Mein Schatz! ich bitte Dich«, rief Caravan ein über das andere Mal bestürzt aus, »ich bitte Dich, ich flehe Dich an, höre auf.«
Auf die Dauer beruhigte sie sich und sagte schliesslich in ihrem alltäglichen Tone:
»Morgen früh müssen wir Deine Schwester benachrichtigen.«
»Das ist wahr«; sagte er, wenig erbaut, »daran hatte ich nicht gedacht. Ich werde ihr gleich früh eine Depesche senden.«
Aber als eine Frau, die an alles denkt, hielt sie ihn zurück.
»Nein, schicke die Depesche erst gegen zehn oder elf Uhr ab, damit wir Zeit haben, uns umzusehen, ehe sie ankommt. Von Charenton bis hierher braucht sie höchstens zwei Stunden. Wir werden ihr sagen, Du hättest vollständig den Kopf verloren gehabt. Wenn wir sie so zeitig benachrichtigen, werden wir nicht mit allem fertig werden.«
Aber Caravan schlug sich vor die Stirne und mit dem furchtsamen Tone, in den er stets verfiel, wenn er von seinem Chef sprach, bei dessen Namensnennung er schon zitterte, sagte er:
»Man muss auch im Ministerium Nachricht geben.«
»Warum Nachricht geben!« antwortete sie. »Bei solchen Gelegenheiten ist man stets entschuldigt, wenn man etwas vergisst. Gib lieber keine Nachricht, glaube mir. Dein Chef kann gar nichts sagen und Du wirst ihn in eine grausame Verlegenheit bringen.«
»Ach ja!« sagte er, »was das anbetrifft, entschieden, und in einen riesigen Zorn dazu, wenn er sieht, dass ich nicht komme. Ja! Du hast recht, das ist eine herrliche Idee. Er muss sich beruhigen und schweigen, wenn ich ihm später den Tod der Mutter anzeigen werde.«
Und ganz entzückt von dem Scherz rieb sich der Beamte die Hände, wenn er an den Zorn seines Chefs dachte, während oben über ihm, neben dem Leichnam seiner Mutter, das eingeschlafene Dienstmädchen heftig schnarchte.
Madame Caravan wurde wieder nachdenklich, als sei sie mit etwas beschäftigt, was sich nicht gut sagen lässt.
»Deine Mutter«, entschloss sie sich endlich, »hat Dir doch ganz sicher ihre Uhr vermacht, nicht wahr, das junge Mädchen mit dem Ballspiel?«
»Ja, ja«, sagte er nach einigem Nachdenken, »sie hat es mir gesagt, aber es ist schon so lange her, damals als sie zu uns kam; ja sie sagte: ›Die Pendule da wird für Dich sein, wenn Du gut für mich sorgst.‹
Das beruhigte Madame Caravan und sie wurde wieder etwas heiterer.
»Dann müssen wir sie aber herunterholen, weißt Du, weil, wenn wir Deine Schwester kommen lassen, sie uns daran hindern wird.«
»Glaubst Du?« … sagte er zögernd.
»Gewiss«, sagte sie heftig, »glaube ich das; einmal hier, ist alles zu spät. Das ist gerade wie mit der Kommode in ihrem Zimmer, die die Marmorplatte hat; sie hat sie mir gegeben, mir, als sie einmal sehr gut gelaunt war. Wir wollen sie auch gleich mit herunterholen.«
Caravan machte ein etwas ungläubiges Gesicht.
»Aber, meine Liebe!« sagte er, »das ist doch eine große Verantwortung!«
»Ach wirklich!« wandte sie sich heftig zu ihm, »Du wirst stets derselbe bleiben. Deine Kinder könnten vor Hunger sterben, ehe Du Dich rühren würdest. Von dem Augenblick an, wo sie mir die Kommode gegeben hat, ist diese unser Eigentum; oder nicht? Und wenn Deiner Schwester das nicht passt, so mag sie’s nur sagen, mir nämlich, verstehst Du? Ich mache mir den Kuckuck aus Deiner Schwester. Vorwärts, steh auf! Wir wollen das, was Deine Mutter uns gegeben hat, gleich herunter holen.«
Zitternd und ohne weiteren Widerspruch verliess Caravan das Bett; als er aber seine Beinkleider anziehen wollte, hinderte sie ihn daran:
»Warum Dich lange anziehen? Du hast ja die Unterhosen an, das genügt. Ich gehe auch, wie ich bin.«
Und alle beide gingen im Nachtkostüm heraus, stiegen geräuschlos die Treppe hinauf, öffneten vorsichtig die Türe und traten in das Zimmer, wo die vier Kerzen und der Palmwedel im Weihwasser allein bei der starren Toten Wache zu halten schienen. Denn Rosalie lag in ihrem Sessel, die Beine von sich gestreckt, die Hände gefaltet, den Kopf zur Seite hängend, und schnarchte aus Leibeskräften mit offenstehendem Munde.
Caravan nahm die Uhr. Es war dies einer jener grotesken Kunstwerke, wie man sie zurzeit des ersten Kaisers so vielfach darstellte: Ein junges Mädchen in Goldbronze, das Haupt mit allerlei Blumen geschmückt, trug in der Hand einen Kugelfänger, während die Schnur mit der Kugel daran als Perpendikel diente.
»Gib mir das«, sagte ihm seine Frau, »und nimm Du die Marmorplatte von der Kommode.«
Er gehorchte keuchend, denn es kostete ihm keine kleine Mühe, die schwere Platte auf die Schultern zu heben.
Dann gingen beide fort. Caravan schritt gebückt durch die Tür und stieg zitternd die Treppe hinunter; seine Frau blieb hin und wieder stehen und leuchtete ihm mit dem Licht in der einen Hand, während sie die Uhr unter dem linken Arme trug.
Als sie wieder in ihren Räumen waren, sagte sie mit einem tiefen Seufzer:
»So, das Schwerste wäre getan; nun wollen wir das Übrige holen.«
Aber die Schubladen des Möbels waren bis oben an mit den Sachen der alten Frau vollgepfropft. Man musste diese erst irgendwo unterbringen. Madame Caravan kam ein Gedanke.
»Geh, hole doch den Holzkasten, der im Flur unten steht; er ist keine vierzig Sous wert und man kann ihn ganz gut hierher stellen.«
Und als der Kasten oben war, begannen sie umzuräumen.
Sie holten nach einander die Manchetten, die Krägelchen, die Mützen und alle die verschiedenen Kleinigkeiten der alten Frau aus den Behältnissen, legten sie hinter sich und ordneten sie später sorgfältig in dem Holzkasten, um dadurch Madame Braux, das andere Kind der Verstorbenen, zu täuschen, wenn sie am nächsten Tage kommen würde.
Hiermit fertig, trugen sie zuerst die Schubladen heraus, dann das Möbelstück selbst, indem jedes an einem Ende anfasste; und nun suchten beide längere Zeit, wo es sich am Besten hinstellen ließ. Endlich entschied man sich für das Schlafzimmer, wo es dem Bett gegenüber zwischen den beiden Fenstern zu stehen kam.
Nachdem die Kommode einmal an ihrem Platze war, tat Madame Caravan ihre eigene Wäsche hinein. Die Uhr wurde auf dem Kamin im Speisezimmer aufgestellt, und das Ehepaar betrachtete sich nun, welchen Eindruck sie machte.
»Sehr gut«, sagte sie.
»Ja, es macht sich so sehr gut«, antwortete er.
Dann gingen sie wieder zu Bett. Sie löschte das Licht aus und bald schlief alles in beiden Etagen des Hauses.
Es war schon lichter Tag, als Caravan die Augen öffnete. Beim Erwachen war ihm anfangs etwas wirr im Kopfe, und erst allmählich kam ihm die Erinnerung an alles wieder. Diese Erinnerung gab ihm einen neuen Stich ins Herz und er sprang, dem Weinen wieder sehr nahe, aus dem Bett.
Schnell ging er nach oben und trat in das Zimmer, wo Rosalie noch in demselben tiefen Schlummer lag, in dem sie die ganze Nacht verbracht hatte. Nachdem er diese an ihre Arbeit geschickt hatte, steckte er neue Kerzen auf die Leuchter und betrachtete dann seine Mutter, während in seinem Gehirn jene vorübergehenden Spuren tieferer Gedanken, halb religiöse, halb philosophische Vorstellungen, auftauchten, welche selbst Leute von mittelmässigem Verstande beim Anblick des Todes zu empfinden pflegen.
Aber schon rief seine Frau wieder nach ihm und er stieg herunter. Sie hatte eine Liste von allem angefertigt, was am Morgen zu geschehen hätte, und überreichte nun dieses Verzeichnis ihrem verblüfften Gatten. Er las:
1. Auf der Mairie den Todesfall anzeigen;
2. den Leichenbeschauer herbei bitten;
3. den Sarg bestellen;
4. bei der Kirche vorbeigehen;
5. bei der Begräbnis-Anstalt alles bestellen;
6. bei der Druckerei Todesanzeigen bestellen;
7. zum Notar gehen;
8. den Verwandten telegrafieren.
Ferner noch eine Menge kleiner Besorgungen.
Nach kurzer Zeit nahm er seinen Hut und ging.
Dann, als die Nachricht sich verbreitet hatte, kamen allmählich die Nachbarinnen, um die Leiche zu sehen.
Beim Friseur im Erdgeschoss hatte zwischen diesem, der gerade einen Kunden rasierte, und seiner Frau über diesen Punkt sich eine kleine Szene abgespielt.
»Das war noch eine«, sagte die Frau, emsig ihren Strumpf strickend, »und eine Geizige dazu, wie es nicht leicht eine zweite gibt. Ich konnte sie nicht gut leiden, das ist wahr; aber ich werde doch wohl ’mal zu ihr hinaufgehen müssen.«
»Was für Ideen!« brummte ihr Mann, während er den Kunden einseifte. »Nur eine Frau kann auf so etwas kommen. Sie ärgern uns nicht nur, so lange sie leben; nein, auch noch im Tode müssen sie uns belästigen.«
»Es ist stärker wie ich«, entgegnete seine Frau, ohne sich um sein Gebrumme zu kümmern; »ich muss herauf! Es quält mich schon den ganzen Morgen. Ich müsste sonst zeitlebens daran denken; aber wenn ich mir ihr Gesicht gut eingeprägt habe, werde ich nachher Ruhe haben.«
Der Barbier zuckte mit den Achseln und flüsterte dem Herrn zu, dessen Backe er gerade bearbeitete:
»Ich bitte Sie, was das für Ideen sind; ja, diese Teufels-Frauen. Mir würde es wenig Freude machen, einen Toten anzuschauen.«
Aber seine Frau hatte es gehört und entgegnete munter:
»Es ist nun ’mal nicht anders.«
Dann legte sie ihren Strumpf fort und begab sich in die erste Etage hinauf.
Zwei Nachbarinnen befanden sich schon oben und plauderten mit Madame Caravan, welche ihnen genau alle Einzelnheiten erzählen musste.
Man begab sich ins Sterbezimmer. Die vier Frauen schlichen auf den Zehen herein, besprengten eine nach der andren die Bettdecke mit Weihwasser, knieten nieder, machten das Kreuzzeichen und sprachen ein kurzes Gebet; dann erhoben sie sich wieder und betrachteten lange mit weitaufgerissenen Augen, den Mund halb offen, die Leiche, während die Schwiegertochter der Toten sich bemühte, hinter ihrem vorgehaltenen Taschentuche ein herzzerbrechendes Schluchzen hervorzubringen.
Als sie sich zum Herausgehen wandte, sah sie an der Türe Marie-Louise und Philipp-August stehen, beide im Hemd, welche neugierig zuschauten. Sie vergass ihren künstlich erzeugten Schmerz und ging mit hochgehobener Hand auf sie zu, indem sie ihnen zurief:
»Marsch hinaus mit Euch, Ihr infamen Rangen!«
Zehn Minuten später stieg sie mit einer neuen Schar Nachbarinnen abermals hinauf; man besprengte wiederum die Schwiegermutter mit Weihwasser, man betete und weinte. Aber plötzlich bemerkte sie, noch ganz mit ihren Aufgaben beschäftigt, abermals die beiden Kinder hinter sich. Sie verabreichte jedem gewissenhaft eine Schelle; aber das nächste Mal gab sie darum nicht besser Acht. Bei jeder Wiederholung der Besuche folgten ihr immer wieder die beiden Nichtsnutze, knieten ebenfalls in einer Ecke nieder und machten genau alles nach, was sie die Mutter tuen sahen.
Nachmittags verminderte sich die Schar der Neugierigen etwas; schliesslich kam niemand mehr. Madame Caravan zog sich in ihr Zimmer zurück, um alle Vorbereitungen für das Leichenbegängnis zu treffen und die Tote blieb wieder allein.
Das Fenster des Sterbezimmers stand offen; eine drückende Hitze drang mit einzelnen Staubwolken durch dasselbe ein. Die Flammen der vier Kerzen in der Nähe der Toten flackerten unruhig hin und her, und auf den Decken, über das Gesicht mit den geschlossenen Augen, über die gefalteten Hände krochen kleine Fliegen, flogen fort und kamen wieder, setzten sich bald hier, bald dorthin und schienen zu erwarten, dass die Stunde ihrer Mahlzeit bald kommen werde.
Marie-Louise und Philipp-August hatten sich herausbegeben und trieben sich auf der Strasse umher. Bald waren sie von einer Schar Spielgefährten umgeben, hauptsächlich kleinen Mädchen, die mit dem aufgeweckten Sinn der Kinder am schnellsten alle Neuigkeiten in der Stadt aufgriffen. Sie fragten genau wie Erwachsene: -- »Ist Deine Großmutter tot?« -- »Ja, seit gestern Abend.« -- »Wie ist das eigentlich, wenn jemand tot ist?« -- Und Marie-Louise erzählte ihnen alles, von den Lichtern, dem Weihwedel, von der Leiche selbst. Da erwachte natürlich eine große Neugierde bei den Kindern und sie verlangten sehnsüchtig, auch in das Zimmer zu der Leiche herauf zu können. Marie-Louise arrangierte alsbald eine erste Partie, fünf Mädchen und fünf Jungens, die grössten und kühnsten. Sie mussten, um nicht entdeckt zu werden, unten an der Treppe ihre Schuhe ausziehen; die kleine Gesellschaft schlich sich ins Haus und stahl sich leise, wie eine Schar Mäuse, die Treppe herauf.
Einmal im Zimmer, ahmte das kleine Mädchen seine Mutter nach und regelte das Zeremoniell. Es führte seine Spielgefährten feierlich herein, kniete nieder, machte das Kreuzzeichen, bewegte die Lippen, erhob sich, besprengte das Bett, und während die Kinder dicht zusammengedrängt sich ängstlich näherten, um mit neugierigem Schauer das Gesicht und die Hände zu betrachten, begann es plötzlich das Schluchzen nachzumachen, indem es die Augen mit seinem kleinen Taschentuche bedeckte. Dann schien es ebenso plötzlich wieder getröstet, indem es der draussen Wartenden gedachte und drängte schleunigst alle heraus, um gleich darauf eine zweite Schar und dann noch eine dritte hereinzuführen; denn die ganze liebe Strassenjugend bis auf die kleinen zerlumpten Bettelkinder rannte zu diesem neuartigen Vergnügen herbei. Jedes Mal inszenierte die Kleine von Neuem die ganze Ziererei, die sie mit vollkommener Sicherheit ihrer Mutter nachgemacht hatte.
Auf die Dauer hielt auch dieser Zeitvertreib nicht vor. Ein anderes Spiel riss die Kinder mit fort, und von Neuem blieb die alte Großmutter allein, ganz vergessen von aller Welt.
Dunkelheit erfüllte allmählich das Zimmer, und auf dem dürren runzeligen Gesicht der Leiche tanzten die Reflexe der auf- und niederflackernden Lichter.
Gegen acht Uhr kam Caravan herauf, schloss das Fenster und steckte neue Kerzen auf. Seine Haltung war jetzt ruhiger. Er hatte sich an den Anblick der Toten gewöhnt, als hätte sie schon seit Monaten da gelegen. Er überzeugte sich sogar, dass noch nicht die geringste Zersetzung sichtbar war und sprach dies auch seiner Frau gegenüber aus, als sie sich gerade zu Tische setzen wollten.
»Natürlich«, antwortete diese, »sie ist wie von Holz, sie würde sich ein ganzes Jahr so halten.«
Schweigend ass man die Suppe. Die Kinder, die man den ganzen Tag hatte sich herumtreiben lassen, schliefen auf ihren Stühlen ein und alles verhielt sich schweigsam.
Plötzlich fing die Lampe an niedriger zu brennen. Madame Caravan schraubte den Docht höher, aber die Schraube machte ein knirschendes Geräusch, die Flamme zuckte einige Male heftiger auf und dann verlöschte sie plötzlich ganz. Man hatte vergessen, Öl zu holen. Zum Krämer zu schicken hätte nur noch das Essen verzögert; man suchte nach Kerzen, aber es gab weiter keine als die, welche vorhin oben Herr Caravan frisch aufgesteckt hatte.
Madame Caravan sandte kurz entschlossen Marie-Louise herauf, um schnell zwei davon zu holen, und man sass so lange im Dunkeln.
Man konnte genau den Schritt des Kindes hören, welches die Treppe heraufstieg; dann dauerte es eine Weile und plötzlich kam das Kind eiligst wieder heruntergestürzt. Es öffnete die Tür, noch lebhafter und erregter als am Abend vorher, wo es den Unglücksfall angekündigt hatte und rief keuchend:
»Oh Papa! Großmama kleidet sich an!«
Caravan wandte sich so erschreckt um, dass sein Stuhl gegen die Wand fiel.
»Was sagst Du?« … stotterte er. »Was hast Du gesagt?« …
»Groß … Großma … Großmama … kleidet sich an … sie kommt gleich herunter« … stotterte Marie-Louise, halberstickt vor Erregung.
Er rannte wie närrisch die Treppe herauf, gefolgt von seiner halbbetäubten Frau; aber an der Tür des zweiten Stockes hielt er, von Aufregung überwältigt, einen Augenblick inne. Er wagte nicht einzutreten. Was würden seine Augen erblicken? Madame Caravan, beherzter wie er, drückte auf die Klinke und öffnete entschlossen die Türe.
Das Zimmer war noch finsterer als vorher, und in der Mitte desselben bewegte sich eine große hagere Gestalt. Sie war wieder lebendig geworden, die alte Frau; und indem sie aus ihrer Lethargie erwacht war, bevor ihr noch das Bewusstsein recht zurückkehrte, hatte sie sich zur Seite gewendet und, auf einen Ellnbogen gestützt, drei der Lichter, die in der Nähe des Totenbettes brannten, ausgelöscht. Dann gewann sie allmählich ihre Kräfte wieder und stand auf, um ihre Kleider zu suchen. Das Fehlen ihrer Kommode hatte sie anfangs in Verlegenheit gebracht, aber allmählich hatte sie ihre Sachen auf dem Boden des Holzkoffers gefunden und sich ruhig angekleidet. Nachdem sie dann das Gefäss mit Weihwasser ausgeleert, den Palmzweig wieder hinter den Spiegel gesteckt und die Stühle wieder an ihre Plätze gerückt hatte, wollte sie gerade heruntergehen, als ihr Sohn und ihre Schwiegertochter erschienen.
Caravan stürzte vor, ergriff ihre Hände und küsste sie mit Tränen in den Augen, während hinter ihm seine Frau trotz ihres verdriesslichen Gesichtes ein über das andere Mal ausrief:
»Welches Glück, oh, welches Glück!«
Aber die alte Frau erwiderte diese Zärtlichkeit nicht; sie schien gar kein Verständnis dafür zu haben. Steif wie eine Bildsäule mit stierem Auge fragte sie nur, ob das Essen bald bereit sei.
»Aber gewiss, Mama! Wir warten nur auf Dich!« stotterte er, vollständig den Kopf verlierend. Und mit ungewohntem Eifer nahm er ihren Arm, während Madame Caravan jr. das Licht ergriff und langsam, Schritt für Schritt die Treppe herabgehend, vor ihnen her leuchtete, wie sie es in der letzten Nacht bei ihrem Manne getan hatte, als er die Marmorplatte trug.
Als sie an die erste Etage kam, hätte sie beinahe einige Leute umgerannt, die gerade die Treppe heraufstiegen. Es waren die Verwandten aus Charenton, Madame Braux, gefolgt von ihrem Gatten.
Die Frau war von ziemlicher Körpergrösse, dick, und in Folge von Wassersucht so aufgeschwollen, dass sie den Oberkörper immer zurücklehnen musste. Sie riss vor Schreck die Augen weit auf und wäre beinahe davon gelaufen. Ihr Gatte, ein sozialistisch angehauchter Schuhmacher, ein kleines haariges Männchen, welches viel Ähnlichkeit mit einem Affen hatte, murmelte kaltblütig:
»Was ist da weiter? Sie ist wieder lebendig geworden.«
Sobald Madame Caravan sie erblickte, machte sie ihnen allerhand Zeichen, sich nichts merken zu lassen; dann sagte sie sehr laut:
»Seht ’mal an! … Seid Ihr da? … Eine herrliche Überraschung!«
Aber Madame Braux, von Natur nicht sehr schlau, hatte sie nicht verstanden.
»Wir kamen auf Eure Depesche hin; wir meinten, es sei alles zu Ende«, sagte sie halblaut.
Ihr Mann gab ihr von rückwärts einen kleinen Rippenstoss, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Es war sehr liebenswürdig von Euch uns einzuladen«, sagte er, ein listiges Lächeln unter seinem dichten Bart verbergend, »wir sind, wie Ihr seht, sofort gekommen.«
Hierin lag zugleich eine kleine Anspielung auf das gespannte Verhältnis, das schon seit langer Zeit zwischen beiden Familien herrschte. Dann, als die alte Frau auf der letzten Stufe stand, ging er hastig auf sie zu, rieb seine haarige Wange an der ihrigen und schrie ihr wegen ihrer Taubheit ins Ohr:
»Es geht gut, Mama! immer munter, wie?«
Madame Braux war so erstaunt, die am Leben zu finden, die sie schon sicher totgeglaubt hatte, dass sie sie nicht einmal zu küssen wagte. Ihr hervorstehender Leib nahm den schmalen Flur so völlig ein, dass die anderen nicht weiter konnten.
Unruhig und misstrauisch musterte die Alte diese ganze Gesellschaft da vor ihr, aber sie sprach kein Wort. Sie heftete ihre kleinen grauen und stechenden Augen bald auf den einen, bald auf den anderen, und machte sich sichtlich allerlei Gedanken; ihren Kindern war das sehr fatal.
»Mama war etwas leidend«, sagte erläuternd Herr Caravan, »aber es geht jetzt schon wieder besser. Nicht wahr, Mama! es geht wieder gut?«
Da antwortete die alte Frau im Weitergehen mit ihrer dürren Stimme wie im Traume:
»Es war eine Ohnmacht; ich hörte Euch die ganze Zeit hindurch.«
Hierauf folgte ein verlegenes Schweigen. Man kam in das Speisezimmer und setzte sich zu einem schnell improvisierten Essen.
Herr Braux allein hatte seine Ruhe bewahrt. Mit seinem Gorilla-Gesicht schnitt er fortwährend Grimassen und ließ hin und wieder zweideutige Worte fallen, die sichtlich alle in Verlegenheit brachten.
Alle Augenblicke schellte es an der Vorsaaltüre, und Rosalie holte dann mit verlegener Miene Caravan heraus, der seine Serviette hinwarf und schleunigst fortstürzte. Sein Schwager fragte ihn schliesslich, ob er heute seinen Empfangsabend hätte.
»Nein, nur einige Bestellungen, sonst nichts«, stotterte er.
Als dann ein Packet gebracht wurde, welches er hastig öffnete, kamen die schwarzgeränderten Todesanzeigen zum Vorschein. Er wurde rot bis an die Ohren und schloss schleunigst den Umschlag, worauf er es in seine Brusttasche steckte.
Seine Mutter hatte es nicht bemerkt; sie heftete unausgesetzt ihre Augen auf ihre Uhr, deren vergoldetes Ballspiel auf dem Kaminsims sich hin- und herbewegte. Die Verlegenheit der ganzen Gesellschaft wurde immer grösser und gab sich in einem eisigen Schweigen kund.
Endlich wandte die Alte ihr runzeliges Hexen-Gesicht ihrer Tochter zu und sagte mit einem deutlichen Schimmer von Bosheit:
»Montag kannst Du mir ’mal Deine Kleine bringen; ich möchte sie sehen.«
»Gern, liebe Mama«, sagte Madame Braux mit strahlendem Gesicht, während Madame Caravan jr., die vor Angst verging, ganz bleich wurde.
Die beiden Männer fingen unterdessen allmählich doch zu plaudern an und begaben sich, in Ermangelung eines sonstigen Stoffes, auf das politische Gebiet. Braux, der die revolutionären und kommunistischen Ideen vertrat, geriet bald in Eifer; seine Augen glänzten unter den buschigen Brauen.
»Eigentum, Herr!« rief er, »ist ein Diebstahl an der Arbeit; -- Erbschaft ist eine Schmach und Schande! …«
Aber hier brach er plötzlich ab; er wurde verlegen, wie jemand, der gerade etwas recht Dummes gesagt hat.
»Aber ich dächte, es wäre jetzt nicht der Augenblick, um über solche Dinge zu streiten«, fügte er in verbindlicherem Tone hinzu.
Die Türe öffnete sich und der »Doktor« Chenet trat ein. Im ersten Augenblick war er sehr überrascht, aber er fasste sich schnell wieder und näherte sich der alten Frau.
»Ah, sieh da, die Mutter!« sagte er. »Es geht gut heute? Ja, ja, ich zweifelte keinen Augenblick und sagte, als ich die Treppe herunterging, zu mir selbst: Ich wette, sie kommt wieder hoch, die Großmutter.«
»Sie hält ebenso viel aus wie die Pont-Neuf«, fügte er hinzu, sie auf die Schulter klopfend. »Wir werden sehen, sie begräbt uns alle noch.«
Er setzte sich und schlürfte behaglich von dem dargebotenen Kaffee; dann mischte er sich in die Unterhaltung der beiden Männer, wobei er als alter Kommunard natürlich vollständig den Ansichten des Herrn Braux beipflichtete.
Die alte Frau fühlte sich müde und wünschte heraufzugehen. Caravan stürzte herbei, ihr seinen Arm zu geben. Da sah sie ihn fest an und sagte:
»Du, Du bringst mir sofort meine Kommode und meine Uhr wieder herauf.«
Während er hierzu ein verlegenes »Jawohl Mama!« stammelte, nahm sie den Arm ihrer Tochter und verschwand mit dieser.
Bestürzt und stumm, in heilloser Verwirrung, blieb das Ehepaar Caravan zurück, während Braux seinen Kaffee schlürfte und sich dazwischen behaglich die Hände rieb.
Plötzlich stürzte Madame Caravan, ausser sich vor Wut, auf ihn zu.
»Sie sind ein Dieb«, brüllte sie, »ein Lump, eine Kanaille … ich könnte Ihnen die Augen auskratzen … ich könnte Ihnen …« Ihre Stimme erstickte im Zorn, sie wusste keine Worte mehr zu finden; er dagegen lachte und trank munter weiter.
Dann, als seine Frau zurückkam, stürzte jene sich auf ihre Schwägerin, und alle beide überschütteten sich gegenseitig mit einer wahren Flut von Grobheiten. Es war ein komischer Anblick: die eine mit ihrem aufgetriebenen drohend hervorstehenden Leibe und der ganzen robusten Gestalt, die andere mit diesen schwächlichen, krankhaften Aussehen, klein und mager. Die Stimmen der beiden Frauen wurden kreischend, während ihre Hände vor Wut zitterten.
Chenet und Braux legten sich ins Mittel, letzterer griff seine bessere Hälfte bei den Schultern und schob sie zur Tür hinaus.
»Geh doch, Kamel!« sagte er, »Du schreist zu toll!«
Von der Strasse her vernahm man noch den Lärm, wie sie sich gegenseitig die schönsten Grobheiten sagten.
Auch Herr Chenet empfahl sich.
Das Ehepaar Caravan war nun wieder allein. Schliesslich warf sich der Gatte in einen Sessel und sagte, während der kalte Schweiß ihm von der Stirn rann:
»Was soll ich nun aber morgen meinem Chef sagen?«
*