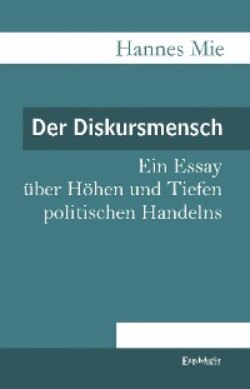Читать книгу Der Diskursmensch - Hannes Mie - Страница 7
2.0 Diskursdiagnose
ОглавлениеNun ist es in Foren, Artikeln und anderen Diskursrahmungen oft zu beobachten, wie die einen damit beschäftigt sind, ihre Meinungen und Sorgen kund zu tun, und die anderen damit, diese Stellungnahmen zu widerlegen. Da wird zum einen von den Errungenschaften und Fehlern einzelner Politiker gesprochen, in welchen Zusammenhängen die Proteste um S21 und E10 stehen und welche Erfahrungen mit Solarenergie gemacht wurden. Zum anderen wird der Verbraucherschutz, die Stromversorgung, die Geheimdienste, Terrorgefahren, diverse Kriegstemperaturen und die politische Arbeit der Parteien bis hin zur Kultur im Allgemeinen hinterfragt. Mit Blick auf ein kritisches und meinungsbildendes Bürgertum augenscheinlich eine kaum verdrossene Reaktion. Aus der angesprochenen Vielfalt der subjektiven Einschätzung von Sachlagen und Ereignissen kann so ein kommunikatives Potpourri resultieren, das sowohl faszinierend und erstrebenswert, als auch unvollkommen daherkommt. Es folgen – fast zwangsläufig – viele freundliche und feindliche Gemeinsamkeiten, Konfundierungen und Gegensätze.
Eine Unterhaltung entsteht, und das ist gut so.
Sich zu unterhalten und zu diskutieren, ist – bei vorliegender Befassung – aber zu unterscheiden, d.h. zunächst Mal: wir haben nicht nur das Recht der freien Meinungsäußerung, sondern können auch die moralische Pflicht daraus ableiten, bzw.: gewinnen, davon Gebrauch machen zu sollen. Eine auf Erklärung, konstruktive Kritik oder Ursachenlösung abzielende Diskussion jedoch unterscheidet sich in der feinen Art, die einer geäußerten Meinung zugrunde liegenden Argumente zu überprüfen und nicht die Person, die die Meinung geäußert hat, anzugreifen und dieser eine „falsche Einstellung“ vorzuhalten; also die Persönlichkeit anzugehen. Das bedeutet: Für diejenigen, die über die bloße Bestätigung der eigenen Meinung hinaus nach verbesserten Erklärungen suchen, ist das Vermischen oder gar Verlassen der Argumentationsebenen kontraproduktiv bzw. unzulässig. Man kann zwar durchaus Politiker untereinander oder den einen Störfall mit anderen Vorkommnissen vergleichen – vielleicht Konfliktverläufe prognostizieren, sich für Lösungen engagieren oder Ziele formulieren –, nimmt damit dann aber automatisch einen zum ursprünglich beobachteten Ereignis oder auch konfrontierten Sachlage unterschiedlichen Blickwinkel ein. Von der Einzelfallbetrachtung darf also nicht ohne weiteres, d.h. ohne Kennzeichnung und Begründung, auf in Sichtweise stehende Kontroversen übergegangen werden. Für uns Sterbliche heißt das: Wir alle sind unterschiedlich nicht nur im Wissen, sondern auch im Können. Mithilfe des eigenen Denkens und der eigenen Sprache dem eigenen Sinn Ausdruck zu verleihen, ist eine Sache. Mithilfe derselben Mittel den fremden Sinn zu erfassen, eine andere. Das bedingt den Willen und die Fähigkeit zur Differenzierung!3 Differenziert man also die Problemsicht, sollten sich auch die diesbezüglichen Argumente differenzieren.
Und zu guter Letzt kann eine Diskussion überhaupt nur so gut funktionieren, soweit über die verwendeten Begriffe konstruktive Einigkeit herrscht. Benennungen und Interpretationen einzelner Wörter werden in ihren Bedeutungen allzu oft unterschätzt, bedingen aber ebenso oft vertraute Verständigung und verständliches Misstrauen in einer jeden Erklärung wie Meinung; oder/und umgekehrt … Auch das ist menschlich. Auch das kann der Mensch lernen und so beherrschen. Wie wichtig der Gebrauch der Sprache im thematisierten Wechsel der fiktiven Kommunikation zwischen Bürger, Medium und Politik gespielt werden kann, scheint so ersichtlich.