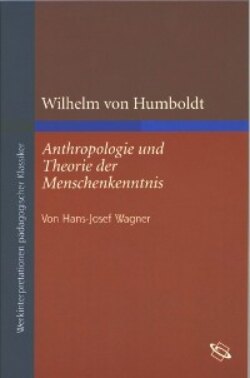Читать книгу Wilhelm von Humboldt: Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis - Hans-Josef Wagner - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[8.] Hauptsächlichste Thatsache, auf welche der Gedanke einer vergleichenden Anthropologie sich vorzüglich stützt.
ОглавлениеDiese Thatsache ist der Unterschied der Geschlechter, welche die Natur zu einer so unverkennbaren Eigenthümlichkeit eines jeden für sich, und einer sich so scharf entgegengesetzten Verschiedenheit bestimmt hat, dass vernünftiger Weise auch nicht einmal der Gedanke entstehen kann, den Charakter des einen mit dem des andern zu vertauschen, oder die Individualität beider durch eine dritte zu vertilgen. Ueberall, wo von individuellen Unterschieden die Rede ist, kann daher derselbe zum Muster dienen, an dem die Art, die Entstehung, die Entwicklung und das Verhältniss solcher Eigenthümlichkeiten unter einander und zur Gattung auf die auffallendste Weise sichtbar ist. Bei allem aber was sich auf Naturbeobachtung gründet, ist es ein Haupterfoderniss einer guten Methode, jeden einzelnen Punkt gerade da aufzusuchen, wo er sich am sichtbarsten zeigt.
Unter beiden Geschlechtern selbst ist es hier, wo es darauf ankommt, die Einheit in den einzelnen Eigenthümlichkeiten zu bestimmen, welche dazu gehört, um eine eigentliche Charakterverschiedenheit zu begründen, besser, bei dem weiblichen stehen zu bleiben, da dieses die Individualität der Art reiner und weniger mit der der Gattung vermischt, als das männliche, an sich trägt.
Betrachten wir nun die einzelnen Züge der Natur der Weiber in Vergleichung mit den Männern, so finden wir:
1. ihren Körperbau kleiner, schwächer und zarter; ihre Knochen feiner und biegsamer; die Muskelkraft mehr zum langsamen Ausdauern, als zur plötzlichen Anstrengung geschickt; ihre Gestalt von weichen; fliessenden Umrissen begränzt; voll Fülle und Anmuth; ihren Ausdruck in der Ruhe und der Bewegung mehr mannigfaltig, sprechend und sanft, als gerade, fest und bestimmt; ihre Schönheit überhaupt mehr durch die Freiheit des Stoffs in der Anmuth, als durch die Herrschaft der Form in der Bestimmtheit der Züge hervorstechend; ihre physische Organisation endlich durch eine überwiegende Reizbarkeit und Thätigkeit des Nervensystems, und eine gewisse Passivität, vermöge welcher sie Uebeln länger widerstehn, und leichter grosse Veränderungen erleiden kann, ausgezeichnet.
2. in Rücksicht auf ihre intellectuellen Fähigkeiten eine entschiedene Neigung zur Betrachtung der Natur und alles dessen, was einen unmittelbaren Werth und Gehalt besitzt, verbunden mit einer fast gleichen Abneigung gegen alles bloss Mittelbare und Symbolische; eine bewundernswürdige Stärke in demjenigen Theile der Erforschung der Wahrheit, welcher lebhafte und bewegliche Reizbarkeit, leichtes und schnelles Auffassen und Verknüpfen fodert, dagegen eine nicht minder auffallende Schwäche und einen fast noch größeren Widerwillen gegen denjenigen, der mehr auf Selbstthätigkeit und scheidender Strenge beruht. Daher ist es den Frauen in so hohem Grade eigen, ihr forschendes Streben überall nach dem wahren Wesen der Dinge zu richten; aber ebendaher erreichen sie doch diess letztere so selten in seiner objectiven Reinheit. Sie behandeln ihren Gegenstand nicht so willkührlich, als nicht selten der Mann; dagegen aber mit einer nachsichtsvolleren Schonung, als die Foderung ihn zu durchschauen und vollkommen in ihn einzudringen verstattet. Ueber dem Geiste der Wahrheit verfehlen sie ihren Buchstaben. So wenden sie sich bei Objecten der Beobachtung gewiss immer unmittelbar an die Wirklichkeit selbst, aber da sie sich mehr den Eindrücken, welche dieselbe in ihnen hervorbringt, überlassen, als sie aufzudecken, zu zerlegen, und ihr mit Versuchen nachzugehen geneigt sind, so gelingt es ihnen nur selten, sie genau zu ergründen; meistentheils knüpfen sie vielmehr ihre subjective Vorstellungsart an dieselbe an, und führen in ihr, wie in ihrem eigenthümlichsten Elemente, nur ihr eignes inneres Leben fort. Ebenso nehmen sie jedes Raisonnement gewiss immer von der Seite seiner bedeutendsten und fruchtbarsten Folgen, bringen es mit allen ihren übrigen Begriffen in gegenseitige Verbindung, sind aber nicht immer sorgfältig genug, es auf hinlänglich sichere Gründe zu stützen. Aus gleichen Gründen empfinden sie auch nach den letzten Resultaten der abstraktesten Philosophie ein dringendes Bedürfniss, weil schon ihre Natur ihnen nicht eher, als bis sie ihre ganze Gedankenmasse in eine Einheit verbunden haben, zu ruhen erlaubt; da indess die Abstraction ihrer Individualität doch durchaus widerspricht, so bleibt ihnen die eigentliche Speculation immer fremd. Der Wahrheitssinn existirt in ihnen im genauesten Verstande des Worts, als ein Sinn, sie sind durch ihre Natur selbst gedrungen, ihn zu lieben und ihm zu huldigen; aber aus einem ursprünglich in dieser gegründeten Mangel an derjenigen sondernden Kraft, welche das eigne Ich recht scharf von der Welt abscheidet, die es umgiebt, werden sie seinem letzten Ziel: der Erforschung der Wahrheit nicht so nah kommen, als der Mann.
Das Unterscheidende dieser intellectuellen Eigenthümlichkeit des andern Geschlechts beruht grösstentheils auf der Reizbarkeit und Lebhaftigkeit der Phantasie, welche den übrigen Kräften, am wenigsten dem Verstande und der Vernunft, nicht leicht abgesondert zu wirken verstauttet, aber dagegen auch selbst nicht so willkührlich, als oft im Manne verfährt, sondern den Sinnen und dem Gefühl folgsamer getreu bleibt.
Nicht also gerade baaren Gewinn an einzelnen Kenntnissen oder Wahrheiten darf man von dem Geiste der Frauen erwarten; er leistet mehr, und seine Bestimmung ist höher und edler. Das Höchste und Beste in der allgemeinsten Geistesthätigkeit überhaupt, das Umfassen eines mannigfaltigen Reichthums, das treue Anhalten an die Natur und den unmittelbaren Gehalt, das Streben, alles und überall zu verknüpfen, das Bedürfniss, das eigne Ich und die umgebende Welt nicht nur immer auf einander zu beziehn, sondern auch durchaus in Eins zu verschmelzen, ist unmittelbar durch seine Natur selbst gegeben. Es fehlt ihm nur, dass er auch das Einzelne immer hinreichend sichre.
Darum wirkt gerade der weibliche Geist so wohlthätig auf den männlichen. Wo der letztere durch willkührliche Einfälle und grübelndes Speculiren zweifelt, da beruhigt und befestigt ihn oft der gesunde und natürliche Blick des ersteren; wo jener hingegen, weil er seiner Meynung widersprechende Thatsachen übersieht oder gering achtet, zu früh gewiss ist, fodert dieser ihn zum Zweifel auf. Ausserdem aber sieht der Mann die unendliche Bahn, die er langsam und Schrittweise durchmessen soll, in dem Geiste des Weibes, der schnell und mit Ueberspringung der mittleren Schritte beide Enden zusammenknüpft, als einen kurzen Weg sinnlich dargestellt, und wird unaufhörlich durch denselben an das Letzte und Höchste erinnert, das er erreichen soll, ohne doch in seiner eigenthümlichen Thätigkeit gestört zu werden, in welcher er sich vielmehr durch den entgegengesetzten Mangel in der weiblichen aufgefodert fühlt, noch rüstiger fortzuarbeiten.
3. in Rücksicht auf den ästhetischen Charakter des Geschlechts.
Wenn der Schönheitssinn lebhaft und rege seyn soll, so muss die Energie des Geistes in einer gewissen mittleren Richtung zwischen der Thätigkeit der Sinnlichkeit und der des reinen Verstandes gehalten, kein Gegenstand weder von der Seite seines physischen Gebrauchs, noch von der seines Begriffs allein betrachtet werden; vielmehr ist es nothwendig, immer beide zugleich zusammenzunehmen und gleichsam zu vertauschen, und die Materie sowohl als den Begriff desselben bloss als Gestalt d. i. als etwas zwar sinnliches, aber doch unkörperliches zu behandeln. Diesem Verbinden heterogener Gemüthskräfte, diesem mittleren Schweben zwischen der Wirklichkeit und der reinen Geistigkeit ist nun die ganze intellectuelle Anlage der Frauen in hohem Grade günstig. Sie sind bei gleichen Graden der Kultur durchaus mehr als der Mann auf das Höchste und Idealische gerichtet (theils weil sie überhaupt mehr nach Einheit streben, theils weil die in ihnen vorzugsweise herrschende Phantasie dieselbe Richtung hat, theils endlich weil sie in einer niedrigeren Sphäre die Befriedigung durch reine Verstandesbeschäftigung weniger kennen) und trennen sich doch zu ungern so weit von der sinnlichen Wirklichkeit, um in dem Gebiete abgezogener Vernunftideen anhaltend zu verweilen. Nichts kann ihnen daher so willkommen seyn, als eine Beurtheilung, die so sehr, als nur irgend eine andre, Allgemeinheit und Nothwendigkeit mit sich führt, und doch nicht nach deutlich erkannten, vollkommen ausgesprochnen Grundsätzen bloss mechanisch geschieht. Dazu kommt die äussere Anmuth und Schönheit, welche die weibliche Gestalt selbst besitzt und die sie anzunehmen fähig ist, die richtig vertheilte Fülle und Feinheit des Baus und der Züge, die Grazie der Bewegungen, die wohlklingende Stärke und Sanftheit der Stimme. Denn ausserdem, dass dieser eigne Reiz beständig die Sinne umgiebt, wirkt er auch auf die Beschaffenheit und den Rhythmus der Empfindungen zurück, oder ist vielleicht richtiger selbst in beiden gegründet. Endlich gesellt sich die äussere Lage hinzu, in welcher die ernsthaften Geschäfte gerade die am wenigsten anstrengenden sind, die alle übrige als Spiel und Erholung anzusehen verstattet, und überhaupt der Musse des Geistes und dem Umherschweifen der Phantasie soviel Zeit zu widmen erlaubt. Darum ist der Schönheitssinn der Frauen unaufhörlich rege, und in so bewunderungswürdigem Grade lebhaft, darum beurtheilen sie alles nach den Regeln des Gefallenden, und suchen in die kleinsten Züge ihres Lebens Geschmack zu verweben. – Diess ist im eigentlichsten Verstande Anlage des Geschlechts, und muss unvermeidlich entstehen, sobald menschliche Kultur sich mit weiblichem Charakter verbindet. Nur ob dieser Schönheitssinn richtig und rein ist, ob er nicht z.B. das bloss Angenehme oft mit dem Schönen verwechselt? hängt mehr von der Individualität einzelner Subjecte ab.
Aber von diesem unbestimmteren Schönheitssinn ist noch ein weiter Weg bis zum eigentlichen Kunstgefühl, und noch mehr bis zum Kunstgenie. In allem, was der Kunst angehört, lässt sich das Technische, das bloss auf logischen Regeln beruht, von der Wahrheit in der Nachahmung der Natur und diese wiederum von dem eigentlich Künstlerischen oder Poetischen, der reinen Erzeugung der selbstthätigen Phantasie, abscheiden. Die Richtigkeit des Urtheils über das erste Erfoderniss hängt ganz und gar von einer bestimmt darauf gerichteten Verstandescultur ab. Weiblich wird es indess seyn, es hiemit nicht allzustreng zu nehmen, sondern vielmehr sogar bedeutende Fehler anderen Schönheiten zu verzeihen. Ueber das zweite Erforderniss werden die Frauen vermöge der Feinheit ihres Beobachtungsgeistes und der Zuverlässigkeit ihres Taktes vortrefliche Richterinnen seyn. Selbst der Natur so nah, ist ihnen kein Zug fremd, der aus ihr entlehnt wird; in so hohem Grade reizbar und beweglich, werden sie nicht leicht für eine Empfindung, welche der Dichter in ihnen weckt, den entsprechenden Ton in ihrem Innern vermissen. So werden sie ihn tiefer und inniger verstehen; aber sie werden ihn auch strenger beurtheilen. Denn da sie ihrem natürlichen Gefühle, frei von vorgefassten Meynungen (die den Mann so oft irre führen) folgen, so wird das Charakterlose und Unnatürliche sie weniger zu täuschen im Stande seyn. Die einzige Gefahr, die ihnen hier droht, ist nur die, ihrer Beurtheilung vielleicht eine zu einseitige, zu sehr aus ihrer Individualität entlehnte Erfahrung zum Grunde zu legen; doch ist selbst diese geringer, da ihr Charakter einen grösseren Kreis umschliesst. Die weibliche Natur ist an und für sich ungleich poetischer, als die männliche, und es kann daher nicht fehlen, dass nicht auch für das höchste und letzte Erfoderniss der Kunst der weibliche Geist ofner und empfänglicher seyn sollte. Er versenkt sich nicht leicht zu tief in die Wirklichkeit, und erhebt sich nur selten zum ganz reinen Gebiet der Ideen. Das Einzige, was ihm hier mangeln könnte, wäre vielleicht die Kraft, mit welcher die selbstthätige Einbildungskraft ihr Product durchaus individuell und doch ganz und gar idealisch, gleichsam in der Mitte zwischen der Natur und der Idee frei schwebend erhält; und in der That findet man auch von dieser Seite das weibliche Urtheil nicht immer rein, nicht selten mehr durch die Wahrheit, als durch das Poetische eines Kunstwerks bestimmt, und oft durch subjective Beziehungen, Uebereinstimmungen oder Verschiedenheiten, bestochen. Die Geschlechts-Anlage macht ein poetisches Urtheil überhaupt leichter und häufiger möglich, als in dem Manne, aber sie setzt der vollkommnen Freiheit und Reinheit desselben (da sie die Phantasie zu nah mit der Empfindung verknüpft und überhaupt den Gemüthskräften weniger abgesondert zu wirken verstattet) grössere Hindernisse in den Weg; indess nie so grosse, dass sie nicht mit völliger Beibehaltung ihrer Eigenthümlichkeit, was wenigstens das Urtheil betrift, sollten überwunden werden können.
Bei weitem schwieriger schon ist das eigne Schaffen, das Kunstgenie. Das Genie überhaupt kann zwar, als der freieste und höchste Schwung des menschlichen Geistes, nur der Individualität angehören, und muss in dem Gattungscharakter allemal Hindernisse antreffen; es fragt sich nur, in welchem mehr oder weniger? Ein gewisser Theil nun in der Ausübung der Kunst gelingt den Frauen unläugbar in hohem Grade. Ihre Productionen besitzen vorzugsweise Leichtigkeit und Anmuth, sind lieblich und gefällig, und wenigstens gewiss immer in einzelnen Zügen wahr und tief aus der Natur genommen. Ob sie aber auch, wie nur das Genie vermag, im Stande sind, eine Gestalt so hinzustellen, dass sie sich durchaus über die Natur erhebt, und doch ganz und gar Natur ist, ob es ihrer Phantasie nicht dazu an Stärke, oder wenigstens an der Herrscherkraft, die sich eigenmächtig von jedem fremden Gesetz losmacht, und sich selbst das Gesetz giebt, ob nicht ihrem Geiste überhaupt an Objectivität gebricht? ist eine andere Frage. Wenigstens ist es gewiss, dass der weibliche Charakter vermöge seiner grösseren Empfänglichkeit auch eine bei weitem höhere Selbstthätigkeit erfodert, um das zur Production des Genies nöthige Gleichgewicht zu erhalten. Inwiefern indess dennoch ein einzelnes Individuum diese Schwierigkeiten überwinden kann? erlaubt keine allgemeine Bestimmung. Nur lehrt die Erfahrung soviel, dass Frauen sich nicht leicht an denjenigen Gattungen versuchen, deren Gelingen vorzugsweise auf ihrer künstlerischen, nur durch Genie möglichen Form beruht, wie die epische und dramatische Poesie und die plastische Kunst ist, sondern fast ausschliessend nur an denen, die gleichsam mehr Fläche darbieten, dem blossen Reiz und dem Reichthum des Stoffes mehr Raum verstatten, der Musik und Mahlerei, dem Roman und der lyrischen Dichtkunst, obgleich auch hieran die grössere Kunstfertigkeit und der ausharrendere Fleiss Schuld seyn kann, den jene Gattungen fodern.
Ueberhaupt muss die Weiblichkeit schon eine gewisse Läuterung erfahren haben, ehe wissenschaftliche oder dichterische Productionskraft möglich wird. Ohne diese fehlt es ihr, selbst in den vorzüglichsten Subjecten, an der hinlänglichen Klarheit und Ruhe, und noch mehr an der Kraft und selbst an der Neigung eine Reihe einzelner Gedanken oder Empfindungen von der ganzen Masse abzusondern, und für sich zu bearbeiten.
4. in Rücksicht auf das Empfindungsvermögen und den Willen.
Um das weibliche Geschlecht von seiner eigenthümlichsten Seite zu sehen, muss man von dem moralischen Charakter ausgehen. Wie bei den Männern der Geist, so ist bei den Frauen die Gesinnung am meisten rege und thätig. Was sie irgendwoher aufnehmen, wird in dieselbe verwandelt; alles geht in sie über; alles entspringt wieder aus ihr. Dadurch ist ihnen eine so entschiedene und beständige Richtung nach der Wirklichkeit eigen. Denn indess der Geist, wenigstens seinen letzten Zwecken nach, immer im Gebiet der Allgemeinheit und Nothwendigkeit und die Phantasie im Reiche der Möglichkeit verweilt, gehört dem Gefühl und der Gesinnung nur die individuelle Gegenwart an.
Der erste und ursprüngliche Grund hievon liegt in der Naturbestimmung des Geschlechts. Um Leben und Daseyn zu geben und zu erhalten, muss es der Natur und der Wirklichkeit treu bleiben, und sich streng an sie binden. Zwar beruht diess zunächst nur auf der physischen Organisation; aber der Einfluss davon verbreitet sich unmittelbar auch auf den moralischen Charakter. Denn da sich mit dem Bedürfniss der Natur zugleich in der Liebe die menschlichsten und geistigsten Gefühle verknüpfen, so ergiesst sich diese Empfindung durchaus durch das ganze Wesen, und theilt demselben ihre Eigenthümlichkeit mit. Dasselbe ist zwar auch in dem Manne der Fall, aber der wichtige Unterschied ist der, dass die Frauen der empfangende und bewahrende Theil sind, dass nur ihnen das durchaus eigne Gefühl angehört, Mutter zu seyn, und dass der Charakter des Geschlechts überhaupt inniger in ihre Persönlichkeit verwebt ist.
Die weibliche Empfindung zeichnet sich vor der männlichen zwar durch grössere Reizbarkeit, aber noch mehr durch grössere Innigkeit aus. Nicht dass nicht auch in die Seele des Mannes ein einzelnes Gefühl so tief eindringen könnte, dass es alle Kräfte und Triebfedern des Gemüths auf einmal anspannt; eine Eigenthümlichkeit, die ihm vielmehr sogar ausschliessend eigen ist. Aber in der Seele der Frauen erklingen (wenn das Bild erlaubt ist) von den Schwingungen einer einzelnen Saite immer zugleich alle übrigen; ihr Gemüth gleicht dem stillen und klaren Wasser, in dem die leiseste Bewegung von Welle zu Welle bis an die äussersten Gränzen fortzittert. Daher ist ihre Innigkeit mehr von Leichtigkeit und Wärme, die des Mannes mehr von Heftigkeit, Feuer und Anstrengung begleitet.
Aus der Innigkeit entspringt die weibliche Schaam, so wie aus dieser die weibliche Züchtigkeit. Die Empfindung der Schaam entsteht immer, wenn man sich in sich versenkt, Ueberlegung und Verstand nicht kaltblütig genug von Gefühl und Neigung gesondert fühlt, und durch den Anblick des entgegengesetzten Zustandes in einen andern auf diesen Contrast des eignen aufmerksam gemacht wird. Weil nun der Mann, seiner Natur nach, kälter und besonnener ist, so ist die weibliche Schaam am meisten sichtbar im Verhältniss gegen das andre Geschlecht. Die physische Organisation des Weibes ist ebenso zum Aufnehmen und Empfangen geneigt, als die moralische, alles zurück auf den inneren Zustand zu reflectiren. Beides verbindet sich in der besondern Gattung dieser Empfindung, die wir die jungfräuliche Schaam nennen, und die man als die Quelle betrachten kann, aus der sich diess Gefühl überhaupt über die ganze Organisation und über alle Zustände derselben nur in verschiedenem Maass und in verschiednen Gestalten ergiesst.
Schlechterdings eigenthümlich ist den Weibern das Muttergefühl, vorzüglich ehe die Frucht noch gebohren ist. Eine Liebe, die durchaus durch keinen Eindruck der Individualität hervorgebracht (denn die Zuneigung zum Vater verstärkt und verändert nur, erzeugt aber nicht diese Empfindung) und doch mit der unbedingtesten Aufopferung verbunden ist, die allein darauf beruht, dass ein fremdes Wesen mit dem eignen in so durchgängiger Mittheilung, so inniger Berührung steht, dass es selbst nur einen Theil desselben ausmacht, und dies Wesen doch ein lebendiges und menschliches ist, das nur, um einem unabhängigem Daseyn entgegenzureifen, auf eine kurze Zeit an ein fremdes geknüpft ist – eine solche Liebe, die noch dazu mehr als bloss in der Anlage auch denen eingepflanzt ist, die sie nie aus eigner Erfahrung kennen, und die gewiss nicht bloss ihren physischen Endzweck erfüllt, sondern sich mit ihren Einflüssen über den ganzen Charakter verbreitet, öfnet den Frauen einen ganz anderen Sinn der Aneignung, und lehrt sie einen ganz anderen Weg kennen, äussre Objecte mit sich zu verknüpfen, in sich aufzubewahren, und wieder von sich zu scheiden, als wofür der Mann nur einen Begriff hat. Daher stammt es, dass in der weiblichen Seele jede tiefere Empfindung, jede eigenthümliche Idee ein Theil ihrer selbst wird, die sie nur mit Mühe und gleichsam mit Schmerzen aus sich loswindet, und dass sie eine Freude der entbehrenden und selbst der schmerzensvollen Aufopferung kennt, die der Mann nur selten und in einzelnen leidenschaftlichen Momenten empfindet.
Lebhafte Reizbarkeit der Empfindung und Anhänglichkeit an die einmal gefasste Meynung bringen natürlich einen leidenschaftlichen, leicht erregbaren und heftigen Charakter hervor. Da aber die intellectuelle Cultur die Einseitigkeit des Verstandes, und die ästhetische die Materialität der Empfindung vermindert; so verschwindet diese Leidenschaftlichkeit auch in gebildeten Frauen wiederum bis auf ihre letzten kaum noch erkennbaren Spuren. Das Gemüth erfährt in ihnen seltner jene ungleichen, stürmischen Regungen, die wir mit dem Namen der Leidenschaften bezeichnen; aber es befindet sich dafür in dem Zustande einer fortdauernden höheren, jedoch gleichmässigeren Spannung, und wenn sich eine Leidenschaft ihrer bemächtigt, so ist es nur für einen Gegenstand, auf den sich, wenigstens der Ansicht des Subjectes nach, alle Kräfte der Seele würdig vereinigen können, und nur auf eine edle und grosse Weise. In dem Zustande einer solchen Leidenschaft verliert alsdann, sobald die Umstände es erheischen, die schöne Weiblichkeit ihre gewohnte Schüchternheit, sie tritt, auf einmal frei geworden, hervor, erklärt sich laut für den geliebten Gegenstand, und schüttelt das Joch äusserer und conventioneller Rücksichten von sich ab.
Nichts ist der Weiblichkeit so sehr zuwider, als moralische Gleichgültigkeit. In den gemeineren Naturen kündigt sich diess durch Härte und Intoleranz an; in den besseren und höheren herrscht zwar die freieste und schönste Liberalität, aber sie unterscheidet sich von der männlichen dennoch dadurch, dass, wenn Dingen, die das sittliche Gefühl beleidigen, andere sonst achtungswerthe Eigenschaften zur Seite stehen, die Schätzung dieser der Geringschätzung jener nicht das mindeste abzieht, da hingegen der Mann hierin leicht zu weit geht, und den Fehler, den er bloss toleriren will, selbst mit theilt. Ueberhaupt sind Frauen – wenigstens gilt diess gewiss von den edleren – bei weitem strenger bei Beurtheilung der Grundsätze, als ihrer Anwendung in einzelnen Momenten, und es ist selbst weiblich, die Milde oder die Inconsequenz (denn beides ist sehr häufig der Fall) bei dieser sogar zu übertreiben.
Wenn man die Frage aufwirft, ob die sinnliche, ästhetische oder moralische Empfindung im Ganzen genommen bei den Frauen die Oberhand behauptet, so lässt sich dieselbe bei keiner einzelnen vorzugsweise bejahen. Ueberwiegende und heftige Sinnlichkeit ist den Weibern in der Regel und bei einer natürlichen Ausbildung so wenig eigen, dass der berüchtigte Streit über die Kälte oder die Leidenschaftlichkeit des Geschlechts in diesem Punkte ohne Zweifel zum Vortheil der ersteren Behauptung entschieden werden muss; die ästhetische wird, wo es auf Gefühl und Charakter ankommt, wenigstens nicht im Widerspruch mit der moralischen siegen; und der trockne und zugleich dürftige Ernst der moralischen genügt für sich allein genommen wenigstens der besseren und vielseitigeren nicht, wenn er auch der gewöhnlichen und alltäglichen durchgängige Genüge leistet. Wo bei der schönen Weiblichkeit das Gemüth zu wahrer und heftiger Leidenschaft entflammt werden soll, da müssen jene drei Arten der Empfindung mit einander zusammentreffen; alsdann aber wird sich dieselbe in jeder mit einem so mächtigen Feuer äussern, dass der unerfahrne Beurtheiler die jedesmal vorwaltende leicht für die einzige erklären kann. Der rohen noch ganz der Natur angehörenden Weiblichkeit ist zwar Ausgelassenheit der sinnlichen Begierde nicht fremd, aber sie entsteht nicht sowohl aus positiver Stärke der Sinnlichkeit (die in dem selbstständigeren und objectiveren Manne ungleich grösser seyn muss) als aus Leere der Empfindung, und aus Mangel einer entgegenstehenden Kraft, die sie zu zügeln vermöchte. Daher wird sie mehr als im Manne durch die Kultur herabgespannt.
Die Harmonie, welche die Frauen in der ganzen Summe ihrer Empfindungen fodern, die Totalität, auf die sie bei jedem Gegenstands dringen, dem sie sich mit einer gewissen Wärme widmen sollen, und die Tiefe und Innigkeit ihres Gefühls müssen zusammengenommen in hohem Grade dasjenige hervorbringen, was man stäte und dauernde Gesinnungen nennt, und auf der einen Seite dem Wechsel der Laune, auf der andern der absichtlichen Wirkungsart des Willens entgegensetzt. Daher ruht die weibliche Moralität mehr auf der Natur, als auf Ueberlegung und Charakterstärke, und daher gewährt das weibliche Gemüth so oft das schöne Schauspiel einer freiwilligen Herrschaft edler Gesinnungen, da das männliche mehr das erhabene einzelner glücklich errungener Kämpfe darbietet. Dass es dem andern Geschlechte indess ebensowenig nothwendig an der Kraft gebricht, welche zu diesen erfodert wird, zeigen häufige Beispiele, nur dass freilich die unverbrüchliche Anhänglichkeit an reine Sittlichkeit mehr aus einmal in die Natur selbst übergegangenen Gesinnungen, als aus unmittelbarer Achtung für das Gesetz hervorgehen wird.