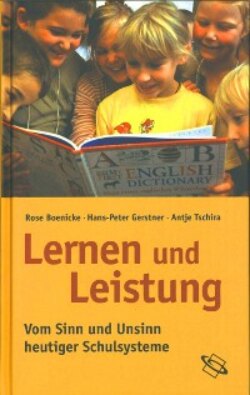Читать книгу Lernen und Leistung - Hans-Peter Gerstner - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Reformpädagogik: Schule vom Kinde aus?
ОглавлениеEintritt in die Schule bedeutet für Kinder ein Stück weit Abschied von der Familie. Und die Einrichtung eines flächendeckenden Schulsystems im 19. Jahrhundert bedeutete, dass dies von da ab nun zur grundlegenden Erfahrung für alle Kinder wurde. In der Schule machen Kinder das erste Mal die Erfahrung, sich in einer gesellschaftlichen Institution zu bewegen. Neben die absolute Autorität von Vater und Mutter tritt nun ein Geflecht von Regeln und Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen. Die findet man in der Schule immer schon fertig vor, man hat sich ihnen einzufügen. Mit seinen Bedürfnissen kommt man als Einzelner in diesem System nicht so recht vor, und dies ist wohl auch eine der ersten Lektionen, die ein Kind in der Schule lernt. Die Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhunderts trat an, diese zu einer Art Naturgesetz avancierte Grunderfahrung von Kindern der Moderne in Frage zu stellen.
Das, was sich im 18. Jahrhundert als Vorläufer des öffentlichen Schulsystems herausgebildet hatte – Stadtschulen und Dorfschulen, „Winkelschulen“ und „Gelehrtenschulen“ – genoss mehrheitlich keinen allzu guten Ruf in Bezug auf die Erfahrungen, die in ihnen zu machen waren. Sicher fielen diese Erfahrungen ganz unterschiedlich aus und waren in hohem Maße von der Persönlichkeit des jeweils Schule haltenden Lehrmeisters bestimmt. Aber die Mehrzahl der überlieferten Berichte spricht von bedrückenden, bestenfalls skurrilen Erfahrungen (vgl. Rutschky 1987). Für die Dorfschulen galt dies ganz besonders, aber auch die höheren Schulen standen unter Kritik. So beklagt ein zeitgenössischer Beobachter 1794 nicht nur die Ineffizienz, sondern auch Inhumanität der so genannten „Gelehrtenschulen“: „Viele Jahre werden mit dem Unterricht der Sprachen zugebracht ... da man dazu nur einige wenige Jahre nötig haben würde, wenn man die alte, in purem Auswendiglernen bestehende, und mit beständigem Prügeln und Schlagen vergesellschaftete, pedantische Lehrart ablegen wollte“ (zit. n. Friedeburg 1989, S. 138).
Mit dem Auftrag, ein öffentliches Schulsystem einzurichten, bemüht man sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Preußen auch um einen neuen Geist, der diese Schulen erfüllen soll. Lernen soll eine neue Bedeutung erhalten, soll zur prägenden Begegnung mit den großen antiken Vorbildern werden; desgleichen soll die Auseinandersetzung mit der kulturellen Überlieferung zum Kristallisationskern für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit werden. Jedoch zielen diese ersten Überlegungen zur Einrichtung von humanistischen Gymnasien sehr viel weiter und weisen eine Reihe von Elementen auf, die wesentliche Elemente der Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhunderts und der gegenwärtigen schulpädagogischen Diskussion vorwegnehmen. An die Schulen Pestalozzis in der Schweiz werden junge Lehrer entsandt, um dort einen Unterricht zu erlernen, der die freie Entfaltung individueller Anlagen, Selbsttätigkeit und Ganzheitlichkeit der Entwicklung ermöglichen soll. In Berlin werden Versuchsschulen eingerichtet, in denen die von Pestalozzi empfangenen Anregungen Gestalt annehmen.
Nachzulesen ist all dies in Wilhelm von Humboldts >Bericht der Sektion des Kultus und Unterrichts an den König, Dezember 1809<. Humboldt beschreibt den Unterricht einer neu gegründeten staatlichen Versuchsschule, die nach dem Vorbild Pestalozzis in einem Berliner Waisenhaus entstanden war. Gar nicht so anders als die Autoren von TIMSS (= Third International Mathematics and Science Study) und PISA, aber 200 Jahre früher, wirft Humboldt dem konventionellen Mathematikunterricht vor, dass der Lehrer hier häufig nur „die Art angibt, wie z. B. diese oder jene Rechnung gemacht werden soll“. In der Reformschule übt „hingegen das Kind die Zahlenverhältnisse überhaupt, durch welche hernach fast alle Rechnungen möglich sind, schnell und sicher aufzusuchen. Bei jener [der alten] Methode hat also der Schüler nur die wirklich erlernte Rechnung inne, kann sich, wenn ein etwas veränderter Fall kommt, nicht mehr helfen und vergisst ohne Uebung auch das Erlernte, hat überdies, ohne dass sein Verstand weiter an Kraft gewonnen hat, nur eine einzelne Fertigkeit erlangt. Der Schüler der neuen Lehrart hingegen weiss sich überall zu helfen und kann nie vergessen, weil er nichts auswendig gelernt, sondern die Kraft erlangt hat, die wirklichen Zahlenverhältnisse einzusehen“ (Humboldt 1809 a, S. 223 f.).
Als wichtige Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Unterrichts, dessen Ziel es ist, „dass das Kind immer das volle und deutliche Bewusstsein haben muss, was es in jedem Augenblick hört, sagt und thut, und warum so und nicht anders gehandelt wird“ (ebd., S. 224), benennt Humboldt vor allem die diagnostische Kompetenz des Lehrers, der „mit mathematischer Genauigkeit und Gewissheit angeben ... können [muss], was das Kind wirklich gefasst hat, und zum Begreifen, von was es noch nicht gelangt ist“ (ebd., S. 225). Unterstützt wird dieser Unterricht ferner durch Lernpartner- oder besser -patenschaften unter den Schülern, wobei „die weiter vorgerückten Kinder die schwächern unterrichten“ (ebd.). Dabei „werden sie jedes Lehrgegenstandes mächtiger, da sie, um sich ihren kleinen Lehrlingen verständlich zu machen, oft das auf verschiedene Art selbst Gelernte anders und anders herumdrehen müssen“ (ebd.). Alle Kinder übernehmen übrigens verschiedene Ämter; ähnlich wie in heutigen Reformschulen „wechseln [sie] darin miteinander ab und wählen sich selbst dazu“ (ebd., S. 222 f.), d. h., sie lernen Schule und Unterricht als etwas zu begreifen, das sie mitgestalten und mitbestimmen und für das es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen.
Insofern steht die Etablierung des staatlichen Schulsystems zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter einem starken reformpädagogischen Vorzeichen. Und wir finden in Humboldts Bericht bereits die wesentlichen Elemente benannt, die hundert Jahre später den reformpädagogischen Diskurs bestimmen sollten. Dennoch blieb diese Orientierung an den pädagogischen Impulsen aus der Schweiz für die Einrichtung des öffentlichen Schulsystems nur eine kurze Episode; letzten Endes gewann ein eher restriktives Verständnis von Lernen und Leistung die Oberhand. Dies hatte zur Folge, dass während des gesamten 19. Jahrhunderts nicht die Kritik an dem neu entstandenen Schulsystem verstummte: an seinem vor allem auf Unterwerfung zielenden Drill, der sinnentleerten Auswendiglernerei, der krankmachenden „Überbürdung“, wie es damals hieß.
Die Verstaatlichung der Bildung führte unter diesem Vorzeichen dazu, dass Gegenentwürfe nur noch außerhalb des öffentlichen Schulsystems Platz hatten. Ihre „Verankerung ... in der Staatsverfassung der Monarchien schloss ... jede grundlegende Reform aus. Die liberale bürgerliche Kritik wandte sich von der Bildungspolitik ab und suchte in der Kindererziehung ihr Betätigungsfeld. ... Erziehung, nicht unter dem Diktat von Staat und Gesellschaft, sondern vom Kinde aus, an die Möglichkeiten, Motive und Interessen der Lernenden anknüpfend, war das Credo der reformpädagogischen Bewegung, die um die Jahrhundertwende entstand“ (Friedeburg 1989, S. 202 f.). Die als überaltert, verkrustet, menschenfeindlich empfundene Gesellschaft des Kaiserreichs soll durch die pädagogische Erschaffung eines „Neuen Menschen“ überwunden werden. Unter dem Einfluss der Lebensphilosophie sollen „Natürlichkeit“ und „Entwicklungsgemäßheit“ an die Stelle der immer wieder kritisierten „Lebensferne“ und „Verkopftheit“ des Unterrichts treten. Diese Forderungen waren Teil einer umfangreichen Programmatik der „Lebensreform“, die das Prinzip des Lebens, des Hier und Jetzt, der Rückwärtsgewandtheit „antiquarischer“ Bildung entgegenstellte.
Diese Aufbruchstimmung um 1900 und ihre Berufung auf den Begriff des „Lebens“ hat der Philosoph Herbert Schnädelbach anschaulich charakterisiert: „Wichtig ist, dass hier mit ‚Leben‘ gar nicht primär etwas Biologisches gemeint ist. In Wahrheit ist ‚Leben‘ ein kultureller Kampfbegriff und eine Parole, die den Aufbruch zu neuen Ufern signalisieren soll. Im Zeichen des Lebens geht es gegen das Tote und Erstarrte, gegen eine intellektualistische, lebensfeindlich gewordene Zivilisation, gegen in Konventionen gefesselte, lebensfremde Bildung, für ein neues Lebensgefühl, um ‚echte Erlebnisse‘, überhaupt um das ‚Echte‘: um Dynamik, Kreativität, Unmittelbarkeit, Jugend. ‚Leben‘ ist die Losung von Jugendbewegung, Jugendstil, Neuromantik, Reformpädagogik und biologisch-dynamischer Lebensreform. Die Differenz zwischen dem Toten und dem Lebendigen wird zum Kriterium der Kulturkritik, und alles Überkommene wird ‚vor den Richterstuhl des Lebens‘ zitiert und befragt, ob es echtes Leben repräsentiert, ‚dem Leben dient‘, oder lebenshemmend, lebensfeindlich ist“ (Schnädelbach 1983, S. 172). Dadurch, dass sie noch nicht von Kultur und Zivilisation beeinflusst seien, so die Meinung, liege vor allem in der Kindheit und Jugend die Chance für einen Neuanfang.
Zugleich gewinnt damit ein ganz anderes Verständnis von „Lernen“ und „Leistung“ an Konturen. Die Erfordernisse einer Institution wie der Schule und die Erfordernisse eines Kindes, das sich entwickeln will, werden als unüberwindliche Gegensätze empfunden. Das kindliche Wissenwollen, der natürliche Lerntrieb und nicht die Vorgaben eines Lehrplans sollen Lernprozesse regulieren. Proklamiert wird eine Art „kopernikanischer Wende“ (Oelkers 1989, S. 101), insofern die neue Schule von den Bedürfnissen des Kindes aus konzipiert wird: Sie will jedem einzelnen mit seinen individuellen Fähigkeiten gerecht werden, seine Besonderheiten, aber auch Schwierigkeiten respektieren, seinen spezifischen Wachstumsprozess fördern. Ohne nachträgliche Glättung der durchaus vorhandenen Differenzen lässt sich sagen, dass in diesen Forderungen die verschiedenen reformpädagogischen Entwürfe übereinstimmen.
Ein solches Unterrichtsverständnis zielt auf Individualisierung und damit auf differenzierte Unterrichtsangebote, die der Verschiedenartigkeit der Leistungsvoraussetzungen der Kinder gerecht zu werden versuchen, anstatt auf Selektion. Lernsituationen, so die neue Überzeugung, dürfen nicht entmutigen, aussondern und die Unangepassten herausdrängen, sie müssen die unterschiedlichen Erfahrungen der Kinder berücksichtigen. Lernfähigkeit ist ein viel zu wichtiges menschliches Vermögen, als dass sie zum sozialen Filter missbraucht werden dürfte. Da Lernen als Aneignung der kulturellen Hervorbringungen in ihrer ganzen Vielfalt verstanden wird, geht es nicht lediglich um Leistungen im kognitiven Bereich, sondern etwa auch um die Fähigkeiten, Interessen zu formulieren, Arbeiten eigenständig zu planen und durchzuführen, soziale Verantwortung in der Lerngruppe zu übernehmen, kurz: auf allen Ebenen gestaltend einzugreifen. Lernen ist gebunden an Handeln, Probieren, an den Umweg, daran, Fehler machen zu dürfen und daraus zu lernen. Auch ist es keine rein innerpsychische Aktivität unter Ausschaltung des Körpers, der in der Schulbank zu weitgehender Bewegungslosigkeit verurteilt ist, sondern bedeutet mit allen Sinnen Tätigsein, Probleme lösen, Verantwortung übernehmen. Aus diesem Grunde bekommt das Leben in der Natur, das Wandern, das Klettern, das Gärtnern und Bauen in der Reformpädagogik solche Bedeutung.
Dass dabei die Reformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts so polarisierend „Natur“ gegen „Geist“ ausspielt, das „Leben“ gegen die kulturelle Überlieferung, Kindheit und Jugend gegen die großen Autoritäten, verstellt uns mit seinem Pathos oft den Zugang zu diesem reichen Fundus an pädagogischen Überlegungen. Eine Pädagogik „vom Kinde aus“ (Montessori) denkt nicht von vorgegebenen Lehrplänen aus, an die sich Kinder anzupassen haben, sondern von deren Fragen her. Kinder wollen lernen, so lautet das reformpädagogische Credo; es gilt, ihre natürliche Neugier zu bewahren und auf ihr aufzubauen. Alles Lernen außerhalb der Schule verläuft über Fehler, Umwege, neue Anläufe. Diesen Impuls darf die Schule nicht blockieren, indem sie an die Stelle von Neugier die Angst vor schlechten Noten setzt. Neues muss an bereits gemachte Erfahrungen anknüpfen, es muss eine Antwort auf eine wirkliche Frage, muss lebenspraktisch bedeutsam sein und nicht nur Teil eines Unterrichtsrituals, in dem auf alle Fragen die Antworten von vornherein feststehen. Dazu muss die Lebenssituation des Kindes berücksichtigt werden, es muss die Möglichkeit bekommen, sprechend, schreibend, malend an sie anzuknüpfen. Die Klassenräume müssen Bewegung zulassen, vielfältige Anregungen geben, sinnvoll gestaltet sein. Das Verhältnis der lehrenden Erwachsenen zum Kind muss von Liebe zu ihm geprägt sein – „von der Liebe zu ihm in seiner Wirklichkeit und von der Liebe zu seinem Ziel, dem Ideal des Kindes“ (Nohl 1949, S. 135 f.). Und zugleich muss der Lehrer dazu bereit sein, „sich selbst überflüssig zu machen“, so Nohl (ebd., S. 132). Denn Kinder können viel voneinander lernen, sind fähig, ihr Wissen an andere weiterzugeben und sich helfen zu lassen. Sie haben Interesse am eigenen Aufstellen von Regeln für ein gerechtes Miteinander und sind bereit, selbst über deren Einhaltung zu wachen, sie verhalten sich sozial verantwortlich, wenn man ihnen diese Verantwortung gibt.
Alle diese Grundüberzeugungen durchziehen die Schriften der Reformpädagogen, sosehr sich ihre Schwerpunktsetzungen auch im Einzelnen unterscheiden mögen. Vor allem aber fällt auf, dass sie im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder neu formuliert werden, und zwar immer dann, wenn Lehrer sich mit der Frage auseinander setzen, wie sie die anfängliche Lernmotivation, die sie an den Kindern wahrnehmen, bewahren können. Dies ist eine Frage, die vor allem Lehrer, die in sozialen Brennpunkten unterrichten, bewegt, denn hier können sie weniger auf die unterstützende Rolle der Eltern zählen, die in der Vergangenheit oft selber keine guten Erfahrungen mit Bildungsangeboten gemacht haben. Wenn hier die Schule es nicht mit eigenen Mitteln schafft, den Schülern die Erfahrung zu vermitteln, dass Lernen sinnvoll ist, kann sie nicht darauf zählen, dass sie trotzdem lernen, nur um die Erwartungen des sozialen Umfelds zu erfüllen, wie dies ja häufig bei Mittelschichtkindern der Fall ist.
Die Ideen der klassischen Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhunderts zeigen hier eine unverminderte Aktualität, ohne doch denen, die auf diese Weise unterrichten, in jedem einzelnen Fall bekannt zu sein. Sie werden sozusagen beständig neu erfunden – unter dem Druck der Verhältnisse und geleitet von dem Wunsch, den Kindern gerecht zu werden und sie individuell zu fördern. Dies lässt sich besonders außerhalb von Deutschland beobachten, da hierzulande Innovationen in Schule und Unterricht, besonders wenn sie die reformpädagogische Parole des „Vom-Kinde-aus“ aufnehmen, d. h. schülerzentriert sind, in der Regel zwischen den Fronten der politischen Grabenkämpfe zerrieben werden. Die Glaubenskriege, die im (West-)Deutschland der 70er und 80er Jahre um die Ansätze der Reformpädagogik geführt wurden, haben uns lange Zeit davon abgelenkt, wahrzunehmen, dass sie in anderen Ländern längst zum Standard geworden sind, wobei sie weitergedacht, variiert und pragmatisch umgeformt, integraler Bestandteil herkömmlichen oder Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Unterrichts geworden sind.
Ein interessantes Dokument dafür ist die 1996 erschienene Studie >Changing the Subject< der beiden US-amerikanischen Erziehungswissenschaftler Paul J. Black und J. Myron Atkin, in der die Erfahrungen gesichtet werden, die mit 23 von der OECD geförderten Pilotprojekten während der 80er Jahre in 13 Ländern weltweit gemacht wurden. Fast durchweg handelte es sich hierbei um Schulversuche an Schulen, die unter dem Druck standen, mit einer schwierigen, zumeist äußerst heterogen zusammengesetzten Schülerschaft zu arbeiten und sie mit herkömmlichen Methoden des Unterrichtens nicht mehr zu erreichen. Daraus entstand der Wille zum Experiment: mit neuen Unterrichtsformen, neuen Formen von Aufgabenstellungen, einem neuen Rollenverständnis von Lehrern und Schülern. Obwohl die in der Studie dokumentierten Reformprojekte unabhängig voneinander und in der Regel von den Lehrkräften selbst als unmittelbare Reaktion auf ihre unbefriedigende Unterrichtsrealität entwickelt wurden, gingen sie zur Überraschung der sie begleitenden Forscher doch alle in mehr oder weniger die gleiche Richtung: „Die starken Familienähnlichkeiten zwischen den 23 verschiedenen Reformprojekten in unserer Studie kam für die Forscher völlig unerwartet“ (Black/Atkin 1996, S. 32). Übereinstimmend findet sich die Ansicht, traditionelle Unterrichtsformen hätten nur ein schmales Segment der Schüler angesprochen und gefördert, während die Lernmotivation der anderen zunehmend verschüttet wurde: „Eine Reihe von Untersuchungen belegte, dass immer wenn das Spektrum von Unterrichtsformen erweitert wurde, dies einer größeren Anzahl von Schülern half, Interesse am Unterricht zu entwickeln und sich konzentriert mit den Aufgaben zu beschäftigen. Dies war überall da der Fall, wo eine große Auswahl möglicher Tätigkeiten zur Auswahl stand, weil es dadurch wahrscheinlicher war, dass jeder Schüler etwas fand, das ihn ansprach“ (ebd., S. 75).
Es nimmt nicht wunder, dass dieselbe OECD, die seit Ende der 60er Jahre die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht und die Unterstützung von Pilotprojekten im Bildungsbereich zu einem ihrer Arbeitsschwerpunkte gemacht hat, im Jahre 2000 mit der PISA-Studie überprüft, wieweit solche Unterrichtskonzepte inzwischen in den einzelnen Ländern Fuß gefasst haben. Dies umso mehr, als zwischenzeitlich ein breites Spektrum an Ergebnissen der Lern- und Kognitionsforschung hinzugekommen ist, das diese Konzepte stützt (vgl. Spitzer 2002). Beides – der reformpädagogische Diskurs und kognitionswissenschaftliche Befunde – sind die Wurzelm aus denen sich das Bildungsverständnis speist, das den Testaufgaben von PISA zugrunde liegt: seinem Interesse an Anwendungsbezug und authentischen Problemstellungen, Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler und Verantwortung für den eigenen Lernprozess.