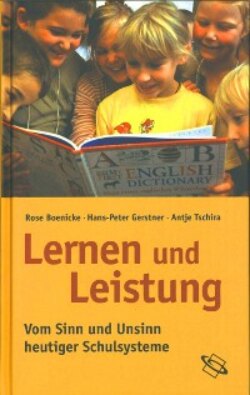Читать книгу Lernen und Leistung - Hans-Peter Gerstner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 19. Jahrhundert: Von Humboldt zum Schulkampf
ОглавлениеAls Antwort auf den verlorenen Krieg gegen die französischen Revolutionsarmeen wurde Anfang des 19. Jahrhunderts eine durchgreifende Reform des preußischen Gesellschaftssystems in Angriff genommen. Ziel war die stärkere Identifikation des Einzelnen mit dem Staatsinteresse; dies sollte auf dem Wege von mehr Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten erreicht und auf diese Weise der Staat gegen ein Übergreifen des Französischen „Revolutionsbazillus“ geschützt werden.
Preußen war damit in vielem Vorbild für die Entwicklung anderer Länder in Deutschland. Dass in Preußen zu Anfang des 19. Jahrhunderts unter staatlicher Aufsicht Schulen für alle Teile der Bevölkerung eingerichtet wurden, war Teil eines umfangreichen Reformpakets. Für kurze Zeit gewann eine Gruppe liberaler Staatsmänner an Einfluss, die unter dem Eindruck der Ideen der Aufklärung, Rousseaus und Kants, der Französischen Revolution und neuer ökonomischer Entwicklungen die verlorene Schlacht als Ausdruck einer tiefen Krise des bisherigen Herrschaftssystems werteten. Für sie wies alles darauf hin, dass zugleich mit den Verlusten von Jena und Auerstedt das feudale, ständisch geordnete Gesellschaftssystem eine Niederlage erfahren hatte.
Die preußischen Reformer um Stein und Hardenberg planten eine Verwaltungs- und Rechtsreform im Sinn einer sozialen, ökonomischen und politischen Liberalisierung. Ziel war die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Rechtsgleichheit aller Individuen, Freizügigkeit und die Stärkung der ökonomischen Selbständigkeit des Einzelnen gegen die beschränkenden Regelungen der Zünfte. Dieser neuen Betonung individueller Leistung und Initiative wurde eine Reform des noch sehr uneinheitlichen Bildungswesens zur Seite gestellt: „Die aus den Fesseln der ständischen Gesellschaft freigesetzten Individuen mußten auf diese liberale Wettbewerbsgesellschaft vorbereitet werden. Eine moderne Schule sollte ihnen das Rüstzeug für diese zukünftige Gesellschaft, elementare Kenntnisse, Fertigkeiten, Arbeitstugenden und normative Verhaltensmuster für ihre Rolle in einer freien Marktgesellschaft vermitteln“ (Baumgart 1997, S. 86).
Individuelle Leistung, gemessen in Zensuren und Prüfungen, sollte wichtiger als die soziale Herkunft werden. Seinen klassischen Ausdruck hat dies da gefunden, wo Wilhelm von Humboldt im Litauischen Schulplan von 1809 davon spricht, dass „auch Griechisch gelernt zu haben ... dem Tischler ebenso wenig unnütz seyn [könne] als Tische zu machen dem Gelehrten“. Zumindest über längere Phasen hinweg müssten alle Teile der Gesellschaft die gleiche Ausbildung erhalten, wenn nicht der Tagelöhner „unter der Menschenwürde roh“, der Bildungsbürger „sentimental, chimärisch und verschroben werden soll“ (Humboldt 1809 b, S. 189).
Damit wendeten sich die Schulreformer um Wilhelm von Humboldt vor allem gegen jene Auffassung von Schule, die der preußische Justizminister Karl Abraham Freiherr von Zedlitz 1787 in seinen >Vorschlägen zur Verbesserung des Schulwesens in den Königlichen Landen< dahingehend zusammengefasst hatte, dass jeder gesellschaftliche Stand seine eigene Schule brauche. Es sei genauso töricht, „den künftigen Schneider, Tischler, Krämer ... Latinisch, Griechisch, Hebräisch zu lehren“, nicht aber die Kenntnisse, die er für seinen zukünftigen Beruf brauche, wie es ungerecht sei, dem Bauern jede Schulbildung vorzuenthalten und ihn damit „wie ein Tier aufwachsen“ zu lassen (Zedlitz 1787, zit. Baumgart 1997, S. 70). Deshalb plädierte er für eine Einteilung in „1) Bauern- 2) Bürger- und 3) Gelehrte Schulen“ (ebd.). Humboldts Überlegungen zum Schulsystem gehen hingegen schon nicht mehr von dieser Vorstellung einer statischen Gesellschaft aus, in der der soziale Stand, in den man hineingeboren wurde, die zukünftige Position vorherbestimmt. Auch aus diesem Grund hat für ihn der individuelle Bildungsprozess, in dem der Einzelne „nur die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen, seinem Wesen Werth und Dauer verschaffen will“, solche Bedeutung (Humboldt 1792 / 94, S. 235). Vor dem Hintergrund der Modernisierungsschübe, die den Beginn des 19. Jahrhunderts prägen, soll „allgemeine Menschenbildung“ nicht mehr ein Privileg sein, das seinen Zweck in sich selbst trägt. Ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat oder Geschäftsmann könne man nur aufgrund einer gewissen Bildung sein, die über das unmittelbar Nützliche hinausgehe: „Giebt ihm der Schulunterricht, was hiezu erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher sehr leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum andern überzugehen“ (Humboldt 1809 c, S. 218). Aus diesem Grund misst Humboldt formalen Fähigkeiten wie dem Erlernen alter Sprachen eine solche Bedeutung zu: Er war „der Überzeugung, dass diese von den unmittelbaren ökonomischen Verwertungsinteressen abgekoppelte neue Erziehung eine nachfolgende Berufsausbildung entscheidend fördern werde“ (Baumgart 1990, S. 44).
Natürlich waren sich auch die Bildungsreformer um Humboldt dessen bewusst, dass die „Verschiedenheit der Talente und Lagen“ einem einheitlichen Bildungsangebot für alle Grenzen setzt. Darüber, was der Einzelne braucht, darf jedoch nicht zu früh entschieden werden, da „sich der künftige Beruf oft nur sehr spät richtig bei einem Kinde oder jungen Menschen bestimmen lässt und ... sein natürliches Talent, das ihn vielleicht einem andern widmen würde, bald nicht erkannt, bald erstickt wird“ (Humboldt 1809 c, S. 218 f.). Es liegt nahe, dass größtmögliche Einheitlichkeit des Unterrichts dem am ehesten Rechnung trägt. Als Voraussetzung dafür entwarfen die preußischen Schulreformer ein gestuftes Schulsystem mit einheitlichen Anforderungen auf jeder Stufe, gepaart mit dem Prinzip der Durchlässigkeit. In langen Beratungen zwischen der „Sektion für Kultus und Unterricht“, der Humboldt vorstand, und der von Friedrich Schleiermacher geleiteten „Wissenschaftlichen Deputation“, einer Art Sachverständigenrat, kristallisierte sich für sie ein System von Bildungsangeboten heraus, das nicht mehr auf „vertikal nebeneinanderstehende[n] Schultypen“ beruhte. Vielmehr sollte es „in Form horizontaler Schulstufen, als aufeinander aufbauende Teile eines Gesamtsystems organisiert werden, das den Übergang von der niederen zur höheren Stufe prinzipiell allen Schülern eröffnete“ (Baumgart 1990, S. 73). Nach Humboldts Verständnis sollte ein solch gestuftes System weniger den unterschiedlichen sozialen Ständen als den Entwicklungsstufen im Leben des einzelnen Individuums Rechnung tragen.
Als Voraussetzung für ein solches, auf maximale Einheitlichkeit und Durchlässigkeit ausgerichtetes System wurden einheitliche Lehrpläne und Prüfungen, die sicherstellen, dass überall das Gleiche gelehrt wurde, angesehen. Ferner wurden vergleichbare Standards für die Lehrerbildung, die Aufsicht und nicht zuletzt die Finanzierung der Schulen als notwendig erachtet. Dass die Umsetzung dieses Plans erhebliche Anstrengungen auf der Ebene der Schulverwaltung und -finanzierung bedeutete, bedarf kaum der Erwähnung.
Weitgehend gelang es jedoch in den wenigen Jahren, die den liberalen Reformern bis zum restaurativen Umschwung 1848 blieben, die erste, d. h. die schulorganisatorische Bedingung zu erfüllen. Lehrerseminare entstanden, um einheitliche Ausbildungsstandards zu etablieren, Prüfungskommissionen wachten über die Gleichheit der Anforderungen, Schuldeputationen über die Umsetzung der ministeriellen Vorgaben. Es entstand in Ansätzen jenes „fest geordnete System von Über- und Unterordnung“ (Max Weber), das bis heute der Schule auf Systemebene eher den Charakter einer Behörde als einer Bildungsstätte gibt. Waren die Reformer auf dieser Ebene der Schaffung von Verwaltungsstrukturen ausgesprochen erfolgreich (freilich indem sie vorhandene Regularien der absolutistischen Verwaltung z. T. einfach übernahmen), so erwies sich der zweite Punkt der Finanzierung dieses Schulsystems als kaum lösbar. Im Gegensatz zu den recht gut ausgestatteten „Gelehrten Schulen“ fehlte es in den Elementarschulen an nahezu allen Voraussetzungen für die Einlösung der Reformpläne – angefangen beim Hungerlohn der Lehrer über unzureichende Räumlichkeiten bis hin zu der Schwierigkeit, die Schulpflicht gegen Interessen, die Arbeitskraft der Kinder und Jugendlichen zu nutzen, durchzusetzen.
Als besonders gravierend für die Umsetzung der Reformpläne erwies sich aber, dass sie auf den Widerstand der gutsherrlichen Aristokratie stießen, denn diese war es, die in erster Linie die dafür nötigen Mittel im Zuge einer Steuerreform bereitstellen sollte und die doch zugleich am wenigsten davon profitierte. Seine eigenen Kinder gedachte der Landadel ja durchaus nicht in die dürftig ausgestatteten Dorfschulen zu schicken und an einem höheren Bildungsniveau seiner Bauern und Landarbeiter hatte er ebenso wenig Interesse (vgl. Herrlitz u. a. 1993, S. 39).
Schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden deshalb die liberalen Bildungspolitiker im preußischen Kultusministerium nach und nach durch konservative Kräfte ersetzt, die eine Frontstellung gegen die Ideen der Aufklärung und den bürgerlichen Liberalismus verband. „Den gesellschaftlichen Forderungen nach individueller und gesellschaftlicher Freiheit setzte der Konservatismus der Restaurationszeit programmatisch die Begriffe Ordnung und Autorität entgegen. Auf der Grundlage einer pessimistischen Anthropologie, die die Endlichkeit, Schwäche und Sündhaftigkeit des Menschen betonte, galt die liberale Entfesselung des Einzelnen wie der Gesellschaft nicht als Voraussetzung historischen Fortschritts, sondern als Bedrohung menschlichen Zusammenlebens. Der Mensch, so die konservative Doktrin, bedarf der festen Institutionen, einer durch göttliche Autorität legitimierten gesellschaftlichen Ordnung, um seine destruktiven Kräfte zu bändigen. Nicht Einsicht, sondern tief eingewurzelte Sitte verhindert den Bürgerkrieg aller gegen alle. Der Idee der Volkssouveränität wurde deshalb auf der Ebene der Politik das ‚Monarchische Prinzip‘, die durch keine repräsentative Vertretung des Volkes eingeschränkte Herrschaft des Monarchen, entgegengestellt“ (Baumgart 1990, S. 90 f.).
Größtmögliche Gleichheit als Ziel wurde aufgegeben, da sie auf der Basis des erwähnten pessimistischen Menschenbilds als Kampf aller gegen alle und als Nivellierung natürlicher Unterschiede angesehen wurde. Der liberalen Vorstellung, „dass die Schule jedem Heranwachsenden die Chance geben solle, durch eigene Leistung in einer offenen Wettbewerbsgesellschaft seine soziale Position zu finden“ (Baumgart 1990, S. 94), wurde die Befürchtung entgegengehalten, dass dies – in den Worten des konservativen Ministerialbeamten v. Beckedorff – nichts anderes „als Neid, Eifersucht, Hader und ewiger Kampf zwischen Gewalt und List“ bedeuten werde, „und folglich die geselligen Verhältnisse ... in eine unaufhörliche Quelle von Mißtrauen und wahrem inneren Kriege verwandelt werden müssen“ (Beckedorff 1821, zit. Baumgart ebd.). Als Ausweg erscheinen der Rückgriff auf vorrevolutionäre ständische Gesellschaftsstrukturen und die Wiederbelebung traditionaler moralischer Wertorientierungen wie Gehorsam, Pflichterfüllung, Selbstgenügsamkeit. Die Aufgabe dieser Gegensteuerung angesichts gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse wird der Schule zugewiesen: Sie soll die traditionelle feudale agrarisch-handwerkliche Ständegesellschaft im Bewusstsein lebendig halten. Dazu bekommt religiöse Unterweisung, zumindest in der Volksschule, wieder eine zentrale Stellung eingeräumt, da sie mit der Erfahrung von Ungleichheit aussöhnen soll.
Ihre klarste Formulierung fand diese Vorstellung in den Regulativen des Nachfolgers von v. Beckedorff, Ferdinand Stiehl, die dem „Prinzip einer strikten Bildungsbegrenzung“ (Herrlitz u. a. 1993, S. 60) das Wort redeten. Für die Volksschule nahm dies geradezu den Charakter von Lernverboten an: „Die ‚sogenannte klassische Literatur‘ soll selbst von der Privatlektüre der Zöglinge ausgeschlossen bleiben; dagegen findet Aufnahme, was nach Inhalt und Tendenz kirchliches Leben, christliche Sitte, Patriotismus und sinnige Betrachtung der Natur zu fördern, und nach seiner volkstümlich anschaulichen Darstellung in Kopf und Herz des Volkes überzugehen geeignet ist‘“ (1. Regulativ, S. 30, zit. n. Herrlitz u. a. 1993, S. 62). Für die Lehrer erübrigt sich insofern „alles, was bisher unter der Bezeichnung ‚Pädagogik, Didaktik, Katechetik, Anthropologie, Psychologie u.s.w.‘ gelehrt worden ist, überhaupt keine ‚Abstraktionen‘, kein ‚System‘, keine ‚Kritik‘, sondern eine praktische ‚Schulkunde‘, deren allgemeine Grundsätze am besten der Bibel zu entnehmen sind“ (1. Regulativ, S. 12 f., ebd.). Gleichzeitig wird der staatliche Einfluss auf die Schule zurückgenommen.
Wenn es aufgrund der unlösbaren Finanzierungsprobleme schon während der Reformära zu einer Auseinanderentwicklung der „höheren“ und „niederen“ Schulen gekommen war, so wurde diese „institutionelle Absonderung“ (Herrlitz u. a. 1993, S. 37) nun bewusst betrieben und auf alle Aspekte des Schulehaltens ausgedehnt. Das Gymnasium setzte sich mit einigen Konzessionen relativ erfolgreich gegen Aufforderungen zur Wehr, neue Inhalte an die Stelle des humanistischen Lehrplans zu setzen. Gleichzeitig ist dies der Ansatzpunkt für eine immer lauter werdende Schulkritik. Immer wieder wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts beklagt, dass die alten Sprachen zum Einfallstor für öden Grammatikdrill und sture Auswendiglernerei herabgewürdigt wurden. „Angestrengte Pflichtarbeit sollte die einen von ‚politischer Schwärmerei‘, die anderen, ‚die Minderbegabten und die Minderbemittelten‘ vom Studium abhalten“ (Friedeburg 1989, S. 165). Auf diese Weise sollte der Charakter einer Eliteanstalt, aus der sich die zukünftigen Staatsbeamten rekrutieren, bewahrt werden.